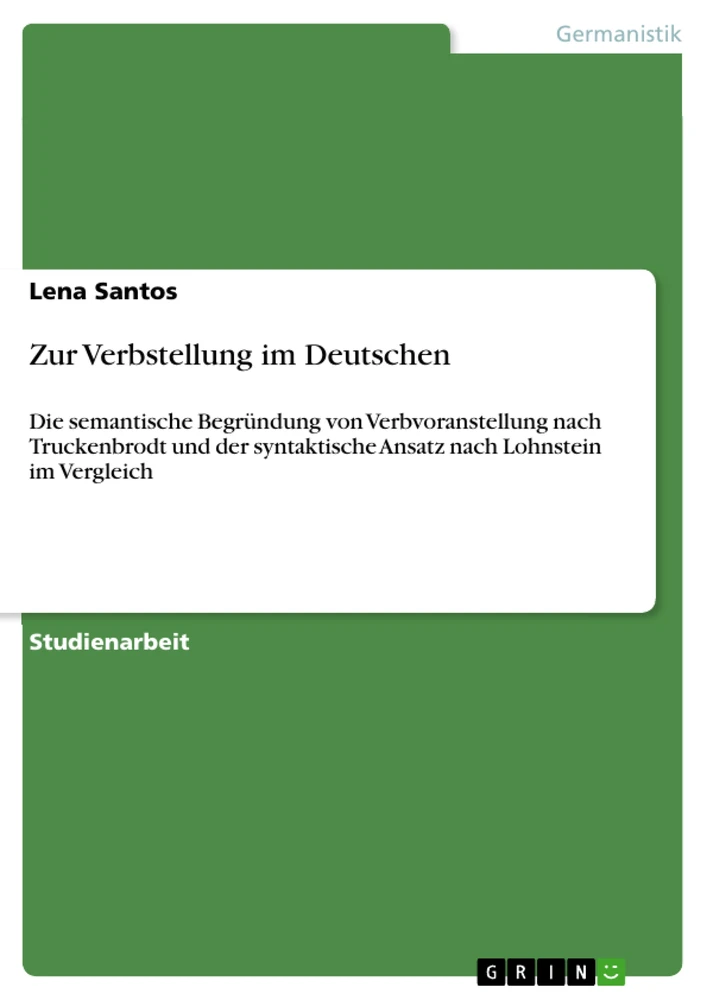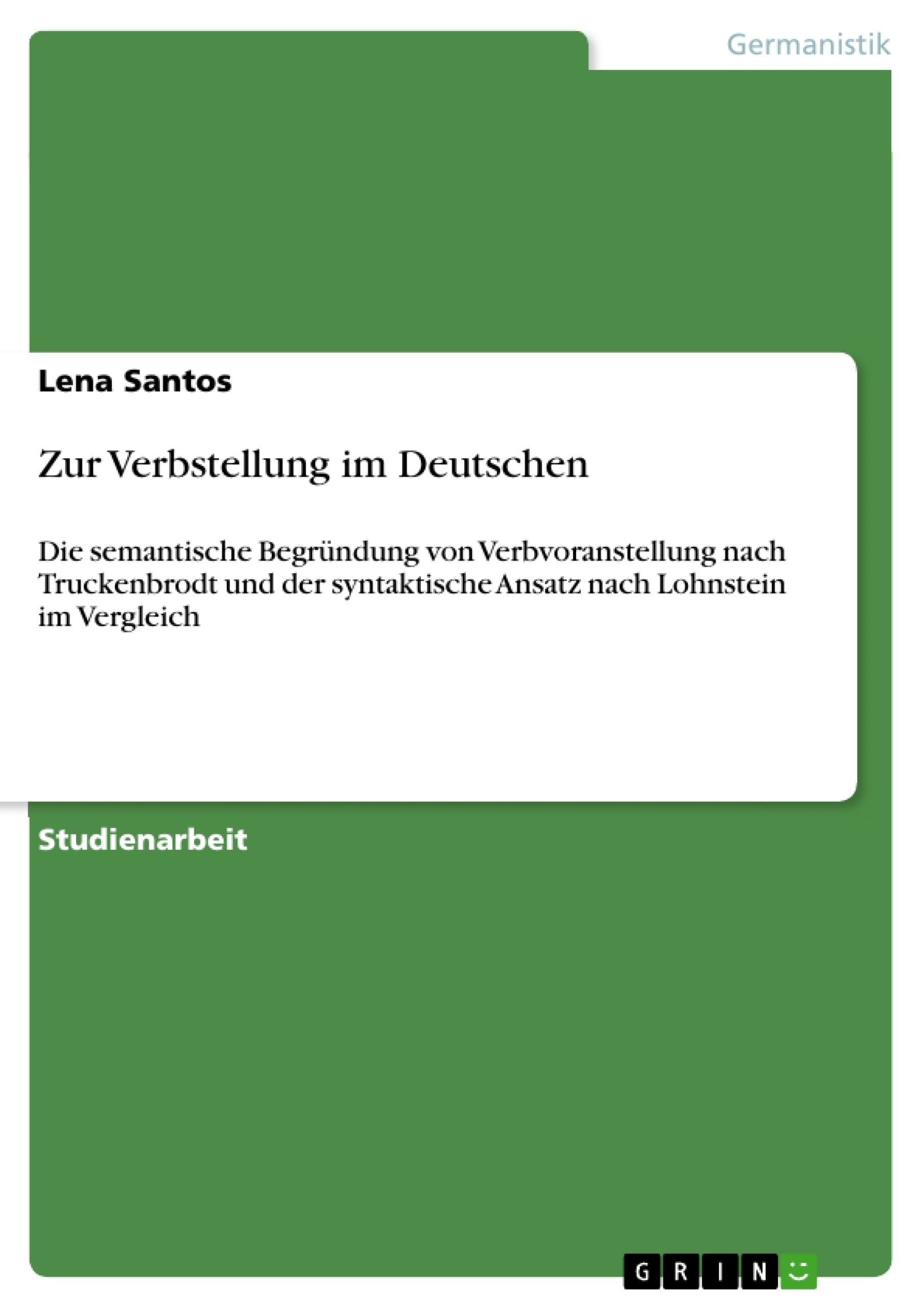Die für diese Arbeit verwendeten Ansätze zur Erklärung der Verbzweitstellung nach Truckenbrodt (2006) und Lohnstein (2020) fokussieren unterschiedliche Überlegungen und Herangehensweisen, um das Phänomen zu beschreiben. Truckenbrodt bezieht sich vorrangig auf Kontextindizes, welche eine V-in-C-Bewegung auslösen und zur Etablierung illokutionärer Kräfte beitragen. Lohnstein argumentiert auf Grundlage der Deixis von Tempus- und Modusangaben, welche die Verbzweitstellung beeinflussen. Dennoch gibt es einige Gemeinsamkeiten hinsichtlich der epistemischen Interpretation bei Deklarativ- und Konjunktiv I-Sätzen. Die Arbeit wird sich zu Beginn mit der semantischen Begründung von Verbvoranstellung nach Truckenbrodt befassen und im Anschluss daran wird der syntaktische Ansatz nach Lohnstein betrachtet. Daran anschließend folgt ein Vergleich beider Ansätze.
Die Flexibilität des Satzbaus im Deutschen aufgrund der Möglichkeit der Bewegung verschiedener Konstituenten in andere Positionen innerhalb des topologischen Feldermodells scheint nicht willkürlich und bedingungslos zu existieren. Insbesondere bedarf es bestimmten Voraussetzungen für die Bewegung des finiten Verbs in die SpC- oder die C0-Position. Die vier Satztypen verdeutlichen die Möglichkeiten der Bewegung von Konstituenten und des finiten Verbs in Hauptsätzen: Für eingebettete Nebensätze ergibt sich hinsichtlich der Voranstellung von [±wh]-Phrasen ein gleiches Bild, allerdings verbleibt das finite Verb in den meisten Nebensätzen in der Fin0-Position und wird demnach nicht bewegt. Innerhalb der Annäherung an die Ursachen dieser Regularitäten wird jedoch auch auf Beispiele eingegangen, in denen die Verbzweitstellung ebenfalls in eingebetteten Nebensätzen zu-lässig ist. Dafür müssen bestimmte Verben im Matrixsatz vorhanden sein, die sich auf die Proposition im Nebensatz beziehen und somit Verbzweitstellung lizenzieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Semantische Begründung von Verbvoranstellung nach Truckenbrodt (2006)
- Syntaktische Begründung von Verbvoranstellung nach Lohnstein (2020)
- kritischer Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbzweitstellung im Deutschen, ein Phänomen, das die Flexibilität des deutschen Satzbaus widerspiegelt. Sie vergleicht zwei zentrale Ansätze zur Erklärung dieser grammatischen Regel: den semantischen Ansatz von Truckenbrodt (2006) und den syntaktischen Ansatz von Lohnstein (2020). Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Bedingungen, die für die Bewegung des finiten Verbs in die SpC- oder C°-Position notwendig sind.
- Die semantischen Grundlagen der Verbvoranstellung
- Die syntaktischen Bedingungen für die Verbzweitstellung
- Ein kritischer Vergleich der beiden Ansätze
- Die Rolle von Illokutionären Kräften und Tempus-Deixis
- Die epistemische Interpretation von Deklarativ- und Konjunktiv I-Sätzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Verbzweitstellung im Deutschen vor und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext des topologischen Feldmodells. Sie führt in die zwei zentralen Ansätze von Truckenbrodt (2006) und Lohnstein (2020) ein, die in der Arbeit im Detail beleuchtet werden.
- Kapitel 2 widmet sich der semantischen Begründung der Verbvoranstellung nach Truckenbrodt (2006). Dabei wird die Verbindung zwischen V-in-C-Bewegung und illokutionärer Kraft herausgestellt und anhand von Beispielen verdeutlicht, wie verschiedene Satztypen und illokutionäre Kräfte miteinander in Beziehung stehen.
- Kapitel 3 analysiert den syntaktischen Ansatz von Lohnstein (2020) zur Erklärung der Verbzweitstellung. Der Fokus liegt auf der Rolle der Tempus- und Modusdeixis sowie der Auswirkungen auf die Bewegung des Verbs.
Schlüsselwörter
Verbzweitstellung, Satzbau, Topologisches Feldmodell, Illokutionäre Kräfte, Semantik, Syntax, Tempus-Deixis, Truckenbrodt, Lohnstein, Deklarativsätze, Interrogativsätze, Imperativsätze.
- Quote paper
- Lena Santos (Author), 2022, Zur Verbstellung im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188907