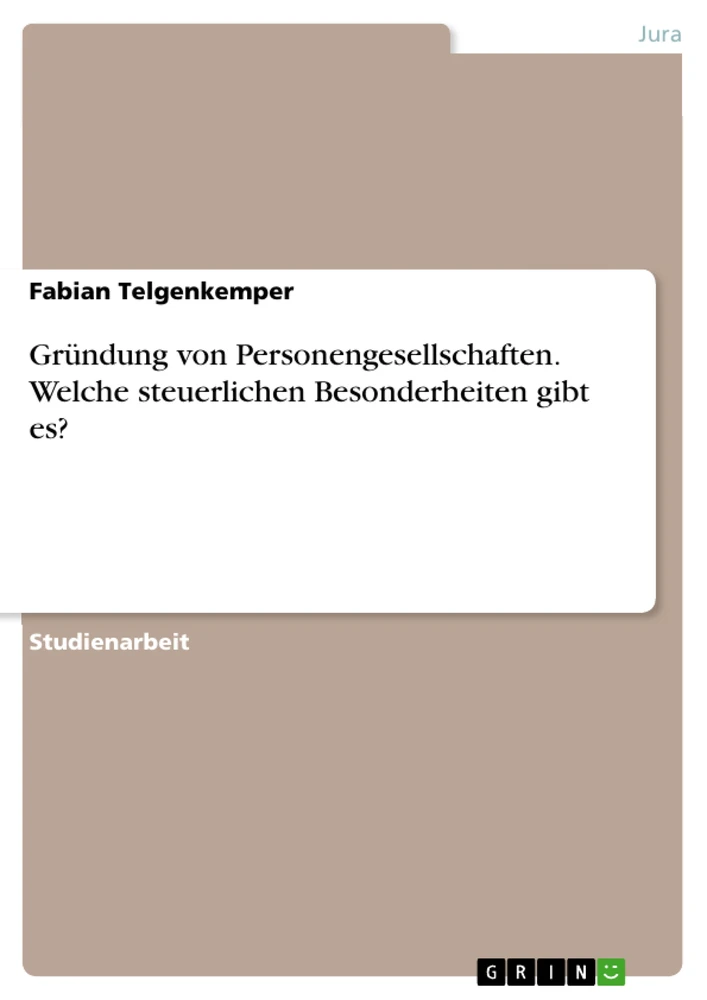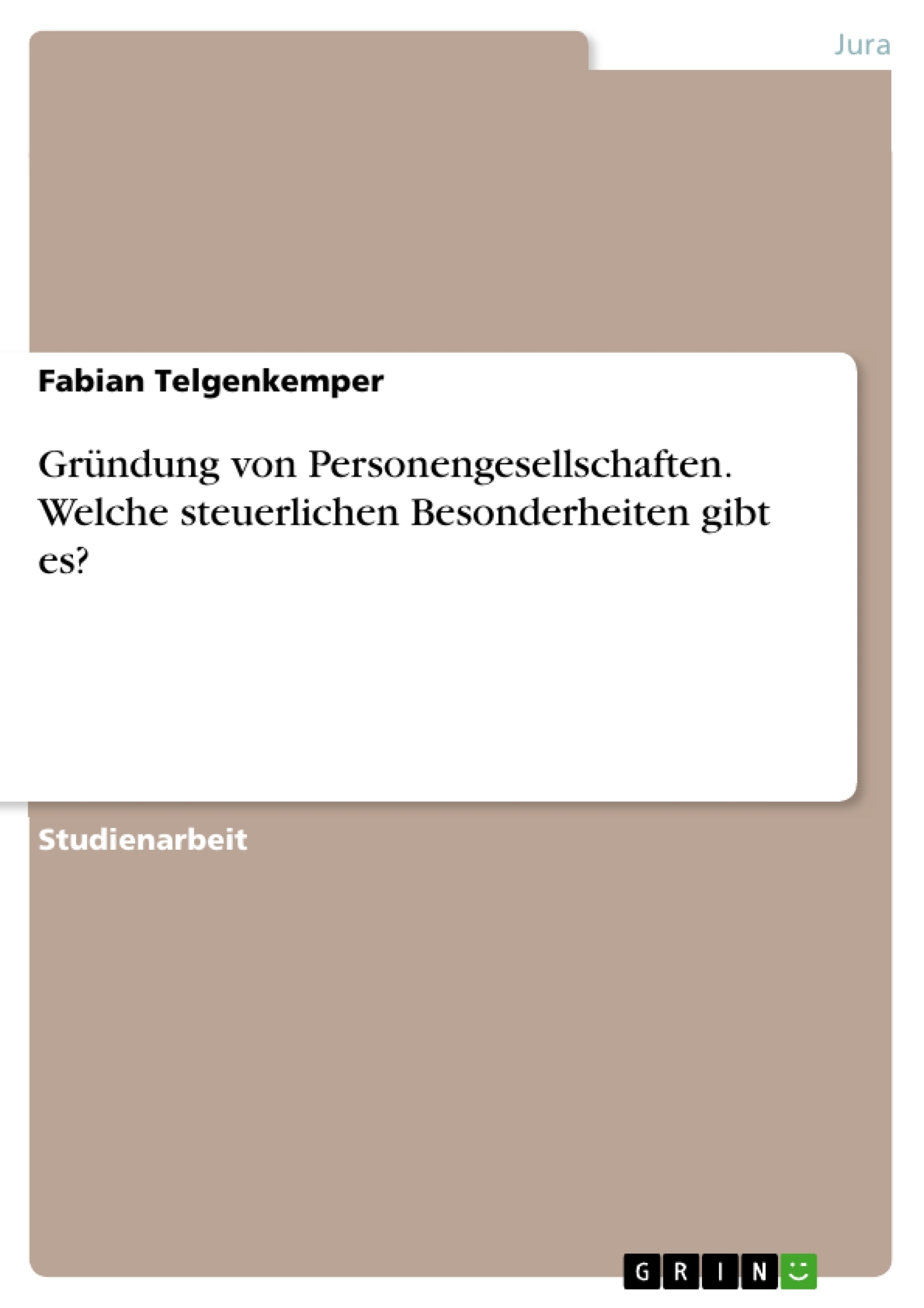Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Gründung von Personengesellschaften, insbesondere im Hinblick auf die steuerlichen Besonderheiten.
Für eine erfolgreiche Gründung von Unternehmen ist die richtige Wahl der Rechtsform entscheidend. Grundsätzlich unterscheiden sowohl das Zivil- als auch das Steuerrecht zwischen Kapital- und Personengesellschaften. Unter einer Personengesellschaft wird ein Zusammenschluss von mindestens zwei juristischen oder natürlichen Personen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, verstanden. Es handelt sich dabei im Gegensatz zu einer Kapitalgesellschaft nicht um eine juristische Person. Einen weiteren Unterschied stellen die Anforderungen an den Gesellschaftsvertrag dar. So kann, im Gegensatz zur Kapitalgesellschaft, ein Vertrag zur Gründung einer Personengesellschaft auch mündlich geschlossen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung / allgemeine Einordnung
- 2. Formen der Gründung
- 2.1. Bargründung
- 2.2. Sachgründung
- 2.2.1. Einlage einzelner Wirtschaftsgüter aus dem Privatvermögen
- 2.2.2. Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 EStG
- 2.2.2.1 Überführung von Wirtschaftsgütern ohne Rechtsträgerwechsel
- 2.2.2.2. Überführung von Wirtschaftsgütern mit Rechtsträgerwechsel
- 2.2.3. Ergänzungsbilanz
- 2.3. Einbringung eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunternehmeranteils
- 3 Urteile des BFH zur Übertragung von Mitunternehmeranteilen und von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens nach § 6 Abs. 3 und 5 EStG
- 3.1. BFH-Urteil vom 19.09.2012 - IV R 11/12
- 3.2. BFH-Urteil vom 21.06.2012 – IV R 1/08
- 3.3. BFH-Urteil vom 02.08.2012 – IV R 41/11
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründung von Personengesellschaften in Deutschland, insbesondere die steuerlichen Aspekte. Ziel ist es, die verschiedenen Gründungsformen darzustellen und die steuerlichen Konsequenzen zu beleuchten.
- Rechtsformen der Personengesellschaften und deren Unterschiede
- Verschiedene Wege der Gründung (Bar- und Sachgründung)
- Steuerliche Besonderheiten bei der Sachgründung
- Relevanz der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)
- Vorteile und Nachteile der Gründung einer Personengesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung / allgemeine Einordnung: Die Einleitung betont die Bedeutung der Rechtsformwahl bei der Unternehmensgründung und differenziert zwischen Kapital- und Personengesellschaften. Sie erläutert die Merkmale von Personengesellschaften, wie den Zusammenschluss von mindestens zwei Personen, die fehlende Rechtspersönlichkeit und die vereinfachte Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG. Der entscheidende Nachteil, die persönliche, solidarische und uneingeschränkte Haftung aller Gesellschafter, wird ebenfalls hervorgehoben. Schließlich werden die fünf wichtigsten Personengesellschaftstypen (GbR, OHG, KG, stille Gesellschaft und PartG) vorgestellt und ihre jeweiligen gesetzlichen Grundlagen im BGB und HGB skizziert. Die Einleitung unterstreicht die hohe Anzahl von Personengesellschaften in Deutschland, besonders im Bereich kleinerer Unternehmen, und begründet die Wahl dieser Rechtsform oft mit geringeren Gründungshürden im Vergleich zu Kapitalgesellschaften. Der Fokus der Arbeit liegt auf den steuerlichen Besonderheiten der Gründung.
2. Formen der Gründung: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Wege zur Gründung einer Personengesellschaft, indem es zwischen Bar- und Sachgründung unterscheidet. Bei der Sachgründung wird detailliert auf die Einlage einzelner Wirtschaftsgüter aus Privat- oder Betriebsvermögen eingegangen, wobei die Unterscheidung zwischen Einzel- und Gesamtrechtsnachfolge im Kontext von § 24 UmwStG und der Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums erläutert wird. Es wird auch die Einbringung ganzer Betriebe, Teilbetriebe oder Mitunternehmeranteile beleuchtet. Der Abschnitt verdeutlicht die komplexen Vorgänge und die notwendigen rechtlichen und steuerlichen Überlegungen bei der Sachgründung im Vergleich zur Bargründung.
3 Urteile des BFH zur Übertragung von Mitunternehmeranteilen und von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens nach § 6 Abs. 3 und 5 EStG: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) zu den Themen der Übertragung von Mitunternehmeranteilen und Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 EStG. Es geht detailliert auf die jeweiligen Sachverhalte, die Entscheidungen des BFH und deren Bedeutung für die steuerliche Behandlung von Gründungen von Personengesellschaften ein. Die Analyse der Urteile liefert wichtige Erkenntnisse für die praktische Anwendung der steuerlichen Vorschriften. Die einzelnen Urteile werden im Detail betrachtet und deren Relevanz für die Thematik der Arbeit herausgestellt.
Schlüsselwörter
Personengesellschaft, Gründung, Sachgründung, Bargründung, Steuerrecht, Einkommensteuergesetz (EStG), Bundesfinanzhof (BFH), Haftung, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG), stille Gesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft (PartG), Umwandlungssteuergesetz (UmwStG), § 6 Abs. 5 EStG, Gesamtrechtsnachfolge, Einzelrechtsnachfolge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gründung von Personengesellschaften
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über die Gründung von Personengesellschaften in Deutschland, mit besonderem Fokus auf die steuerlichen Aspekte. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen, und Schlüsselbegriffe.
Welche Arten der Gründung von Personengesellschaften werden behandelt?
Der Text unterscheidet zwischen Bargründung und Sachgründung. Die Sachgründung wird detailliert untersucht, inklusive der Einlage einzelner Wirtschaftsgüter aus Privat- oder Betriebsvermögen, der Übertragung von Wirtschaftsgütern mit und ohne Rechtsträgerwechsel (§ 6 Abs. 5 EStG), und der Einbringung von Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen. Die komplexen rechtlichen und steuerlichen Überlegungen bei der Sachgründung werden im Vergleich zur Bargründung erläutert.
Welche Rolle spielt das Einkommensteuergesetz (EStG)?
Das Einkommensteuergesetz (EStG) spielt eine zentrale Rolle, insbesondere § 6 Abs. 5 EStG, der die Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen regelt. Die steuerlichen Konsequenzen verschiedener Gründungsformen werden im Kontext des EStG beleuchtet.
Welche Bedeutung hat die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)?
Der Text analysiert ausgewählte Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) zur Übertragung von Mitunternehmeranteilen und Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens nach § 6 Abs. 3 und 5 EStG. Diese Urteile liefern wichtige Erkenntnisse für die praktische Anwendung der steuerlichen Vorschriften bei der Gründung von Personengesellschaften.
Welche Arten von Personengesellschaften werden erwähnt?
Der Text erwähnt die fünf wichtigsten Personengesellschaftstypen: Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG), stille Gesellschaft und Partnerschaftsgesellschaft (PartG). Ihre jeweiligen gesetzlichen Grundlagen im BGB und HGB werden skizziert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die Rechtsformen der Personengesellschaften und deren Unterschiede, verschiedene Wege der Gründung (Bar- und Sachgründung), steuerliche Besonderheiten bei der Sachgründung, die Relevanz der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), sowie die Vorteile und Nachteile der Gründung einer Personengesellschaft.
Was sind die Schlüsselwörter des Textes?
Schlüsselwörter sind: Personengesellschaft, Gründung, Sachgründung, Bargründung, Steuerrecht, Einkommensteuergesetz (EStG), Bundesfinanzhof (BFH), Haftung, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG), stille Gesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft (PartG), Umwandlungssteuergesetz (UmwStG), § 6 Abs. 5 EStG, Gesamtrechtsnachfolge, Einzelrechtsnachfolge.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, die verschiedenen Gründungsformen von Personengesellschaften darzustellen und die steuerlichen Konsequenzen zu beleuchten. Er soll ein umfassendes Verständnis der steuerlichen Aspekte bei der Gründung von Personengesellschaften vermitteln.
- Arbeit zitieren
- Fabian Telgenkemper (Autor:in), 2021, Gründung von Personengesellschaften. Welche steuerlichen Besonderheiten gibt es?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188781