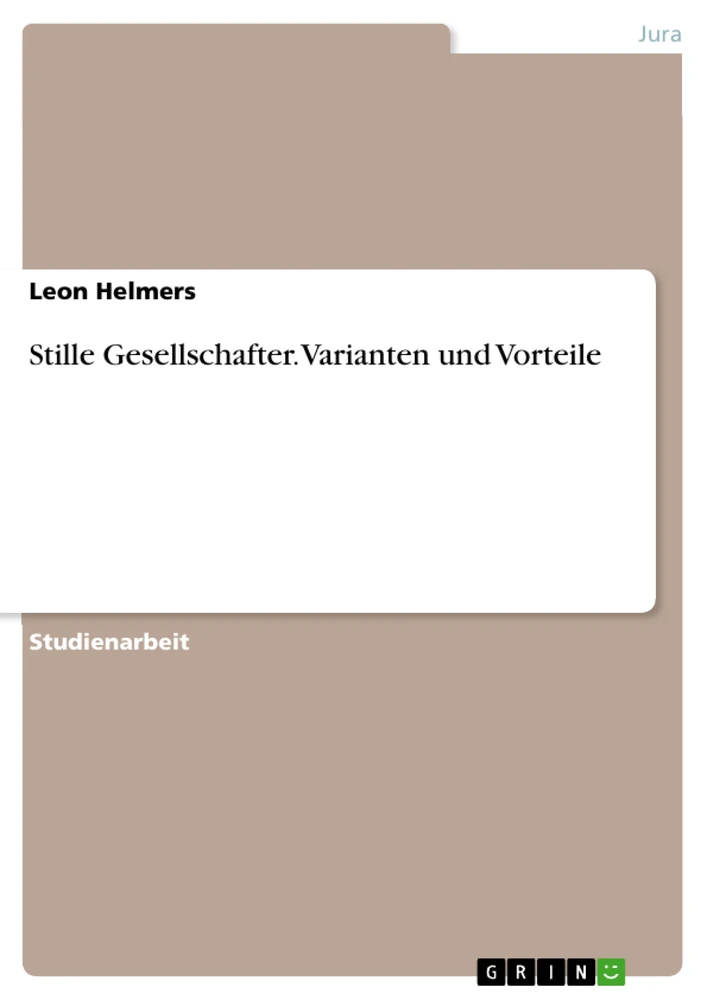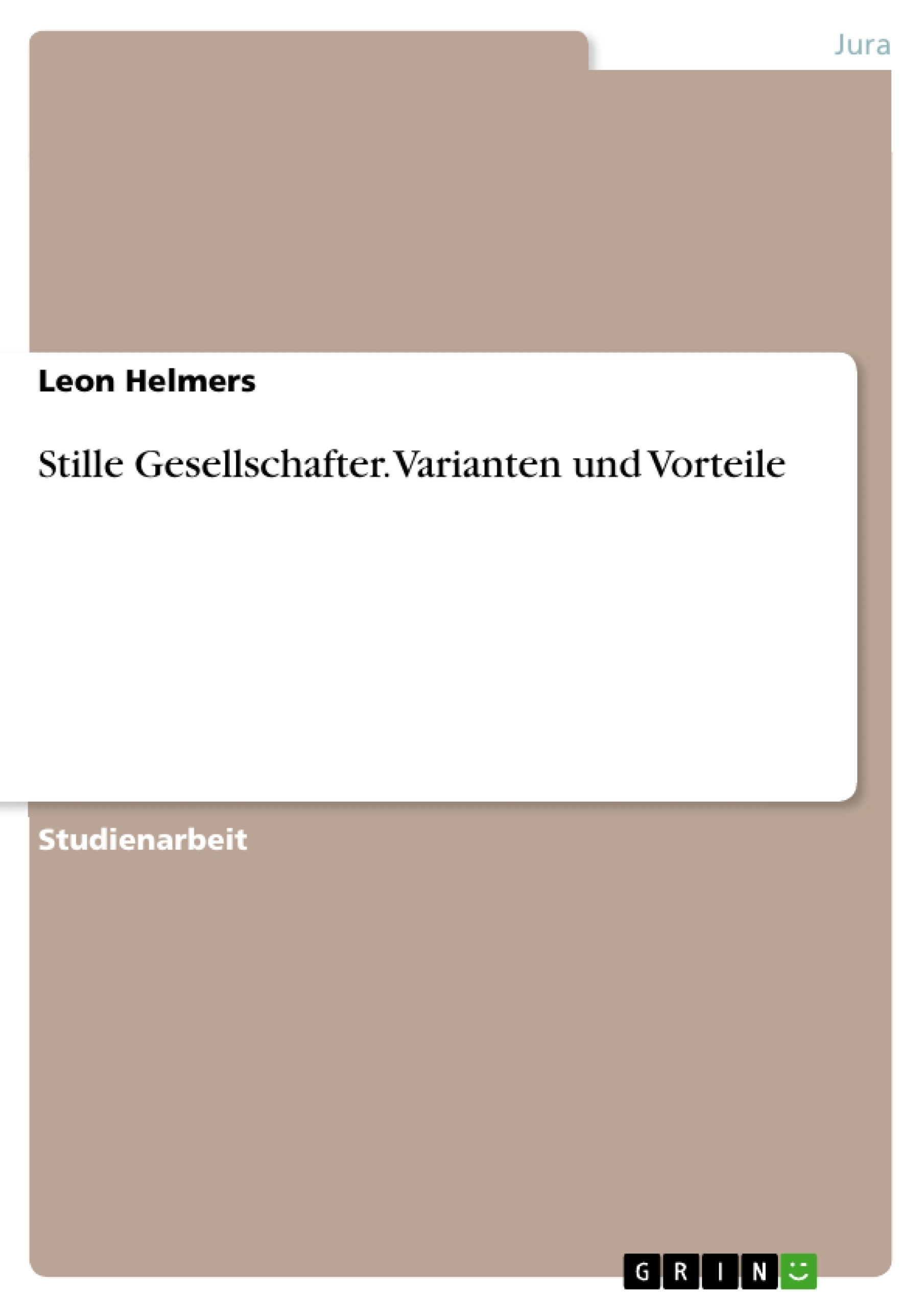Im Verlauf dieser Arbeit wird aufgezeigt, welche Folgen durch die Varianten der stillen Gesellschaft ausgelöst werden, anhand welcher Merkmale diese abgegrenzt werden und welche Vorteile durch Vereinbarung einer stillen Gesellschaft zum einen steuerrechtlich, aber auch zivilrechtlich, sozialversicherungsrechtlich und im Hinblick auf die Struktur genutzt werden können. Steuerrechtlich ist für das Gesellschaftsverhältnis des Stillen insbesondere relevant, inwieweit ein stiller Gesellschafter als typisch oder atypisch einzustufen ist.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung und Definition
- B. Varianten der stillen Gesellschaft und rechtliche Einordnung
- I. Typisch stille Gesellschaft
- II. Atypisch stille Gesellschaft
- III. Mitunternehmerrisiko und Mitunternehmerinitiative
- C. Nutzung der stillen Gesellschaft in verschiedenen Konstellationen
- I. Rechtsformabhängige Faktoren und Besonderheiten
- 1. Einzelunternehmen
- 2. Personenhandelsgesellschaften
- 3. Kapitalgesellschaften
- II. Vorteile einer stillen Gesellschaft
- 1. Insolvenz und Haftung
- 2. Arbeitnehmerbeteiligungen
- 3. Scheinselbstständigkeit – stille Gesellschaft statt freier Mitarbeiter
- III. Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der stillen Gesellschaft als Beteiligungsform an einem Handelsgewerbe und analysiert deren Varianten und Vorteile. Die Arbeit untersucht die rechtliche Einordnung der stillen Gesellschaft und beleuchtet die Unterschiede zwischen der typischen und der atypischen Form. Darüber hinaus werden die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der stillen Gesellschaft in verschiedenen Konstellationen, insbesondere in Bezug auf die Rechtsform des beteiligten Unternehmens, untersucht.
- Rechtliche Einordnung der stillen Gesellschaft
- Unterschiede zwischen typischer und atypischer stiller Gesellschaft
- Nutzungsmöglichkeiten der stillen Gesellschaft in verschiedenen Konstellationen
- Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten der stillen Gesellschaft
- Vorteile der stillen Gesellschaft in Bezug auf Insolvenz, Haftung, Arbeitnehmerbeteiligungen und Scheinselbstständigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit definiert die stille Gesellschaft als Beteiligungsform an einem Handelsgewerbe und erläutert die grundlegenden rechtlichen Aspekte. Der zweite Teil geht näher auf die Varianten der stillen Gesellschaft ein, unterscheidet zwischen der typischen und der atypischen Form und beleuchtet die Kriterien Mitunternehmerrisiko und Mitunternehmerinitiative. Der dritte Teil der Arbeit untersucht die Anwendungsmöglichkeiten der stillen Gesellschaft in verschiedenen Konstellationen, wie Einzelunternehmen, Personenhandelsgesellschaften und Kapitalgesellschaften. Er beleuchtet dabei die rechtlichen Besonderheiten und Vorteile der stillen Gesellschaft in diesen Konstellationen. Schließlich wird der dritte Teil der Arbeit auf die verschiedenen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten der stillen Gesellschaft eingehen.
Schlüsselwörter
Stille Gesellschaft, Handelsgewerbe, Beteiligung, Typische stille Gesellschaft, Atypisch stille Gesellschaft, Mitunternehmerrisiko, Mitunternehmerinitiative, Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, Rechtliche Einordnung, Anwendungsmöglichkeiten, Einzelunternehmen, Personenhandelsgesellschaften, Kapitalgesellschaften, Insolvenz, Haftung, Arbeitnehmerbeteiligungen, Scheinselbstständigkeit.
- Arbeit zitieren
- Leon Helmers (Autor:in), 2022, Stille Gesellschafter. Varianten und Vorteile, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1187935