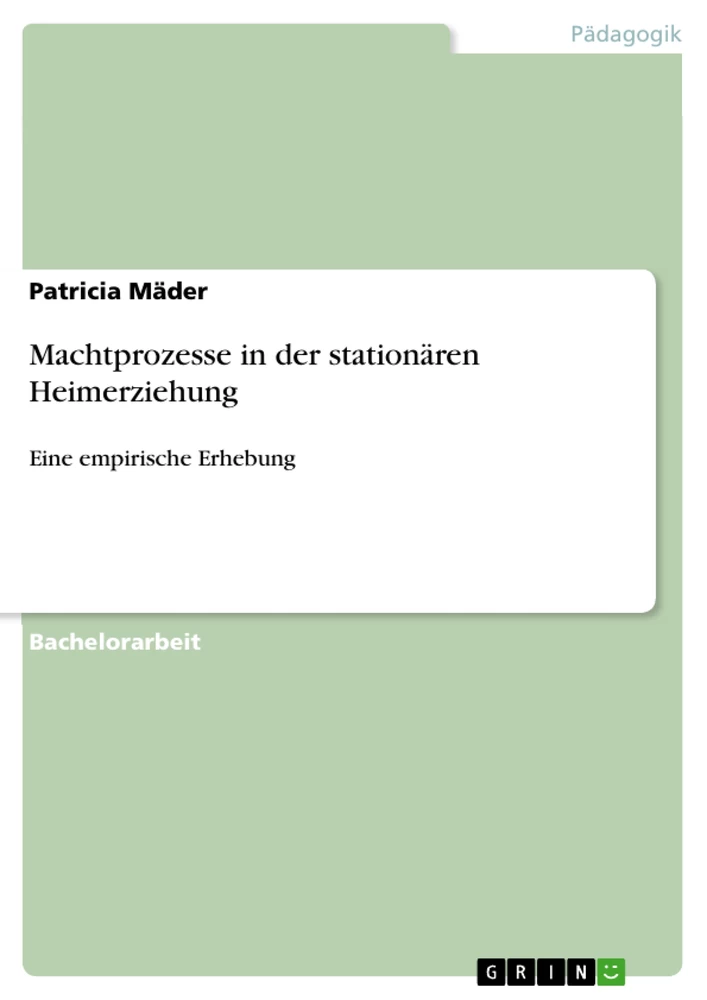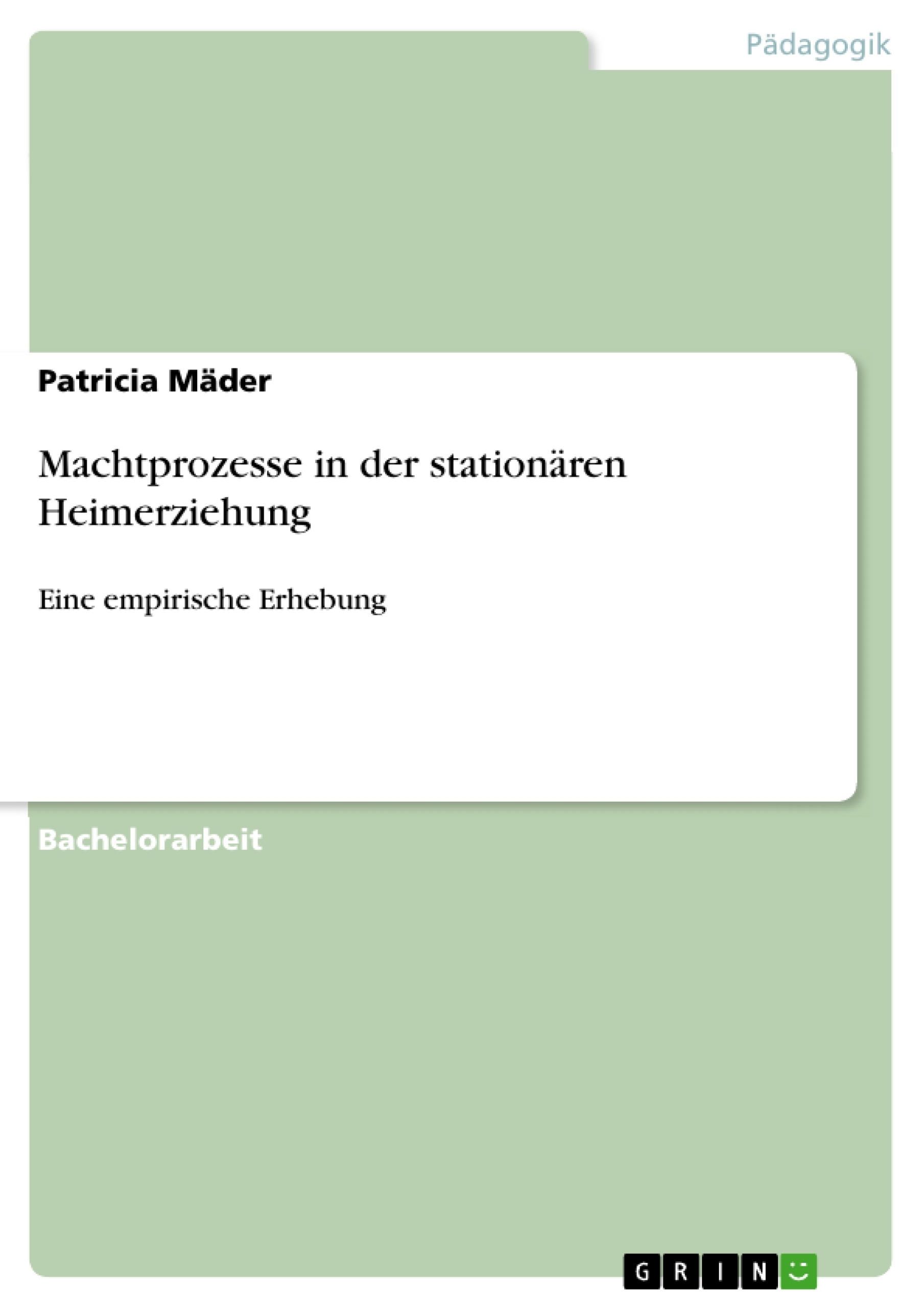Diese Arbeit beschäftigt sich mit Machtkonzepten Professioneller in der stationären Heimerziehung.
Ziel dieser Arbeit ist der Versuch, zu skizzieren, inwiefern das Thema Macht in einer Einrichtung noch zentral ist. Genauer wird untersucht, welche subjektiven Machtkonzepte mithilfe von leitfadengestützten problemzentrierten Interviews sich bei Professionellen herausstellen lassen, ob diese innerhalb der Einrichtung äquivalent oder gänzlich verschieden sind und wie sich die herausgestellten Machtkonzepte mit dem implementierten Partizipationskonzept der Einrichtung vereinbaren lassen.
Beginnend mit einer theoretischen Einführung zum Forschungsstand der Machtthematik erfolgt schließlich der Übergang zur Perspektive auf die Praxis, die zunächst eine Vorstellung davon abzeichnen soll, wie und in welcher Form sich Machtprozesse in der Kinder- und Jugendhilfe zeigen.
Schließlich folgt der empirische Teil dieser Arbeit, der sich mit der eingangs gestellten Forschungsfrage nach subjektiven Machtkonzepten Professioneller in ihrer pädagogischen Arbeit beschäftigt und diese mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse aufzubereiten sowie zu beantworten versucht.
Die Debatte zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ergab sich schließlich daraus, dass Beteiligung und Mitsprache in der Heimerziehung der letzten Jahrzehnte eine signifikant untergeordnete Rolle spielten. So zeigte Klaus Wolf in seiner qualitativen Studie zu Machtprozessen in der Heimerziehung die unterschiedlichen Dimensionen, in denen Machtdifferentiale sowie Abhängigkeitsverhältnisse stattfinden.
Macht und Partizipation mögen sich augenscheinlich gegenseitig ausschließen, denn dort, wo ausgeprägte Macht herrscht, kann nicht die Rede von Mitbestimmung sein. Partizipation hingegen bedeutet dahingehend vielmehr ein demokratisches Aushandeln verschiedenster, für die Jugendlichen im Rahmen ihrer Fremdunterbringung alltagsrelevanter Themen.
Trotz verpflichtender, partizipativer Konzeptionen stehen die tatsächliche Beteiligung und Mitbestimmung der Jugendlichen nicht als automatisch gesichert. Externe Rahmenbedingungen, professionelle Haltungen und konzeptionell implementierte Regelungen bedingen sich hierbei gegenseitig und beeinflussen den pädagogischen Arbeitsalltag Professioneller maßgebend.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Macht
- Konturen eines Machtbegriffes
- Machtkonzept nach Heinrich Popitz
- Machttheorien
- Machtprozesse in der Heimerziehung
- Exkurs: Alltag und professionelle Erziehung: Ebenen der Legitimation
- Machtquellen in der Heimerziehung
- Körperkontrolle als Dominanz- und Machtthematik am Beispiel des Essens
- Organisationskulturen in der Heimerziehung
- Machtkonzepte Professioneller in der stationären Heimerziehung
- Vorstellung des Beispielmaterials
- Bestimmung des Ausgangsmaterials
- Fragestellung der Analyse
- Ablaufmodell der Analyse
- Ergebnisse und Auswertung der Materialanalyse
- Verregelung des Alltags
- Partizipation als Entscheidungsmacht
- Beziehungsarbeit
- Beantwortung der Forschungsfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit Machtkonzepten Professioneller in der stationären Heimerziehung und untersucht deren Einfluss auf die Partizipation von Jugendlichen. Das Ziel ist es, zu analysieren, ob und in welcher Form Macht in der Heimerziehung noch immer eine zentrale Rolle spielt und wie sich diese Machtkonzepte mit dem implementierten Partizipationskonzept der Einrichtung vereinbaren lassen.
- Machtverhältnisse in der Heimerziehung
- Subjektive Machtkonzepte von Professionellen
- Partizipation und Mitbestimmung von Jugendlichen
- Einfluss von Organisationskulturen auf Machtprozesse
- Vergleich von Machtkonzepten mit dem Partizipationskonzept der Einrichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Macht und beleuchtet verschiedene Machtkonzepte und -theorien. Im Anschluss werden Machtprozesse in der Heimerziehung im Allgemeinen beleuchtet, wobei der Fokus auf den Einfluss von Organisationskulturen und der Rolle von Körperkontrolle liegt. Im Kern der Arbeit werden die subjektiven Machtkonzepte von Professionellen in einer Einrichtung im Ruhrgebiet mithilfe von leitfadengestützten Interviews untersucht. Die Ergebnisse der Materialanalyse, die mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse gewonnen wurden, fokussieren auf die Verregelung des Alltags, die Bedeutung von Partizipation und die Rolle von Beziehungsarbeit in der Heimerziehung.
Schlüsselwörter
Machtkonzepte, Heimerziehung, Partizipation, Professionelle, Organisationskultur, qualitative Inhaltsanalyse, Körperkontrolle, Beziehungsarbeit, Partizipationskonzept.
- Arbeit zitieren
- Patricia Mäder (Autor:in), 2019, Machtprozesse in der stationären Heimerziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1187632