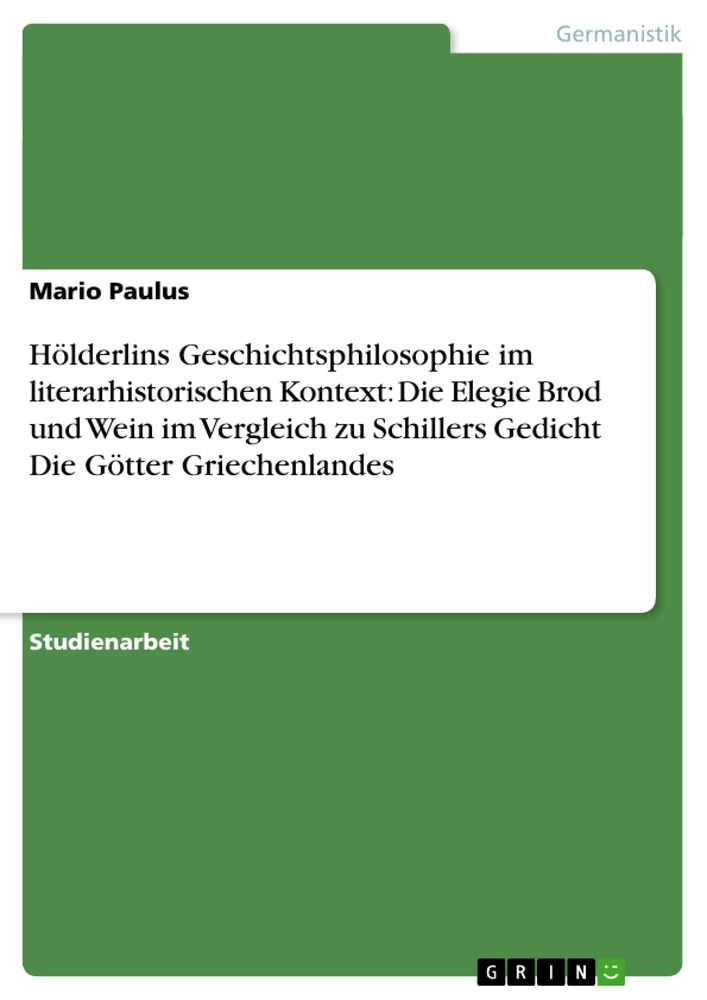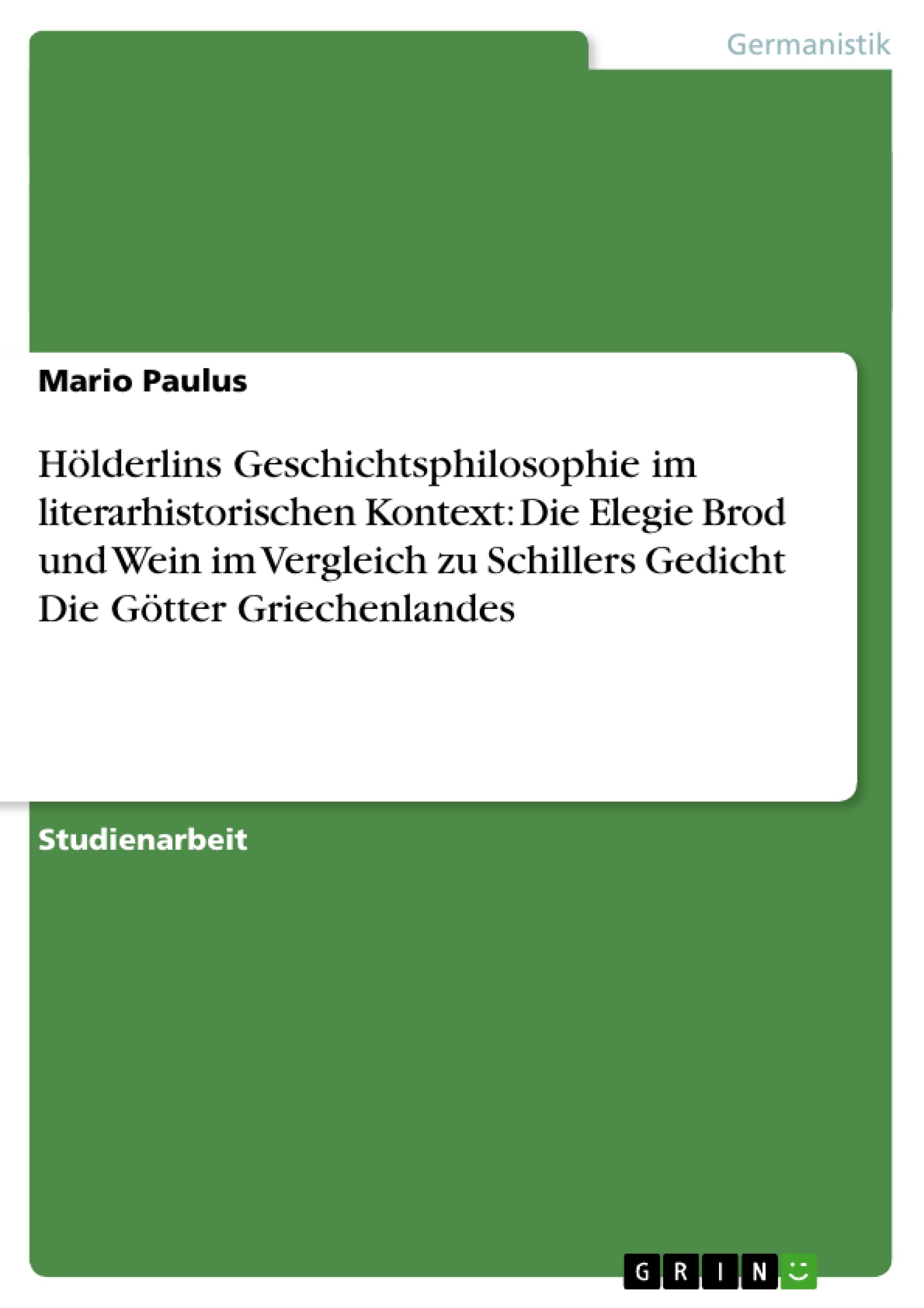Setzt man sich mit der Frage auseinander, welcher Geschichtsphilosophie Friedrich Hölderlin in seinem literarischen Werk Ausdruck verleiht, so befindet man sich im Kontext seiner Oden und späten Hymnen, vor allem aber seiner Elegien. Unter diesen Elegien wiederum ist die Elegie "Brod und Wein" das umfangreichste, vielleicht auch das bedeutendste Werk, da es in besonders eindrucksvoller und zugleich umfassender Weise Hölderlins Auffassung von Geschichte deutlich werden läßt (vgl. z.B. Schmidt 1968, 6).
Gerade die Epoche, in der Hölderlins Hauptwerk anzusiedeln ist - also etwa der Zeitraum von 1788 bis 1806 -, ist besonders bedeutend nicht nur für die europäische Geschichte bzw. die Weltgeschichte, sondern auch für die Philosophie und die Literatur. Gerade deshalb ist es angemessen, sich mit dem philosophischen und dem literaturtheoretischen Hintergrund auseinanderzusetzen, vor dem Hölderlins Werk betrachtet werden muß. Dabei ist es unumgänglich, über den damaligen deutschsprachigen Raum hinaus zu blicken, weil die deutschen Philosophen und Schriftsteller jener Zeit insbesondere von Frankreich beeinflußt worden sind.
Für die literarische Entwicklung Friedrich Hölderlins war Friedrich Schiller von großer Bedeutung, und es liegt besonders deshalb nahe, einen Vergleich zwischen beiden anzustellen, weil Hölderlin zunächst in vielem den knapp elf Jahre älteren Schiller als Vorbild ansah, sich dann aber von ihm in mancherlei Hinsicht distanziert hat.
Dieser Zusammenhang zwischen Hölderlins und Schillers Werk besteht auch zwischen Schillers Gedicht "Die Götter Griechenlandes", dessen erste Fassung aus dem Jahre 1788 stammt, und Hölderlins Elegie "Brod und Wein", die wohl 1800/1801 entstanden ist: Hölderlins Elegie gehört zur poetischen Rezeption des Schiller-Gedichtes, und wie zu zeigen sein wird, gibt es grundlegende Parallelen zwischen beiden Werken, zugleich werden aber auch deutliche Unterschiede sichtbar, die nicht zuletzt aus einer unterschiedlichen Geschichtsphilosophie resultieren.
Wenn im Titel der vorliegenden Arbeit vom "literarhistorischen Kontext" von Hölderlins Werk die Rede ist, so wird damit eigentlich auch die Literatur der Frühromantik mit einbezogen. Dies gilt insbesondere für Novalis, den wohl wichtigsten Frühromantiker. Denn dieser hat insbesondere mit der fünften seiner "Hymnen an die Nacht", die 1799/1800 entstanden sind, eine Dichtung verfaßt, die in engem Zusammenhang mit den beiden zu untersuchenden Gedichten steht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Literaturtheoretische und philosophische Voraussetzungen
- 2.1 Die Bedeutung der „Querelle des anciens et des modernes“
- 2.2 Zur Entwicklung der Geschichtsphilosophie von Voltaire bis Kant
- 3. Interpretation des Gedichtes „Die Götter Griechenlandes“
- 3.1 Zur Entstehungssituation des Gedichtes
- 3.2 Zur formalen Charakterisierung des Gedichtes
- 3.3 Der elegische Charakter des Gedichtes
- 3.4 Gegenwart versus griechische Antike
- 4. Interpretation der Elegie „Brod und Wein“
- 4.1 Zur Entstehungssituation der Elegie
- 4.2 Form und Struktur der Elegie
- 4.3 Dreiteilung als zentrales Charakteristikum
- 5. Vergleich der beiden Dichtungen
- 5.1 Formale Unterschiede
- 5.2 Die Rolle der Kunst und des Künstlers
- 5.3 Die Bedeutung der Religion
- 5.4 Hölderlins Geschichtsauffassung zwischen Schiller und Novalis
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Hölderlins Geschichtsphilosophie im Kontext seiner Elegie „Brod und Wein“ und stellt diese im Vergleich zu Schillers Gedicht „Die Götter Griechenlandes“ dar. Dabei werden die literaturtheoretischen und philosophischen Voraussetzungen des 18. Jahrhunderts beleuchtet, insbesondere die „Querelle des anciens et des modernes“ und die Entwicklung der Geschichtsphilosophie von Voltaire bis Kant.
- Die „Querelle des anciens et des modernes“ als literaturtheoretischer und philosophischer Ausgangspunkt
- Die Entwicklung der Geschichtsphilosophie von Voltaire bis Kant
- Die Interpretation der Gedichte „Die Götter Griechenlandes“ und „Brod und Wein“
- Der Vergleich der beiden Gedichte hinsichtlich ihrer formalen Unterschiede, der Rolle von Kunst und Künstler sowie der Bedeutung der Religion
- Die Analyse von Hölderlins Geschichtsauffassung im Kontext der Werke von Schiller und Novalis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Elegie „Brod und Wein“ als zentrales Werk von Hölderlins Geschichtsphilosophie vor und erläutert die Bedeutung des literarischen und philosophischen Kontextes des späten 18. Jahrhunderts. Kapitel 2 untersucht die „Querelle des anciens et des modernes“ und die Entwicklung der Geschichtsphilosophie von Voltaire bis Kant. Kapitel 3 interpretiert Schillers Gedicht „Die Götter Griechenlandes“ unter Berücksichtigung von Entstehungszeit, formaler Besonderheiten und des elegischen Charakters. Kapitel 4 analysiert Hölderlins Elegie „Brod und Wein“ in ähnlicher Weise. Kapitel 5 vergleicht die beiden Gedichte hinsichtlich ihrer formalen Unterschiede, der Rolle von Kunst und Künstler sowie der Bedeutung der Religion. Darüber hinaus wird Hölderlins Geschichtsauffassung im Kontext der Werke von Schiller und Novalis beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der deutschen Literatur und Philosophie des 18. Jahrhunderts, insbesondere der „Querelle des anciens et des modernes“, der Geschichtsphilosophie, der Lyrik von Friedrich Schiller und Friedrich Hölderlin, sowie dem Vergleich der Gedichte „Die Götter Griechenlandes“ und „Brod und Wein“. Die Arbeit untersucht, wie die literarischen und philosophischen Auseinandersetzungen des 18. Jahrhunderts die Geschichtsauffassung von Hölderlin prägten und wie diese in seinen Werken zum Ausdruck kommen.
- Quote paper
- M.A. Mario Paulus (Author), 2001, Hölderlins Geschichtsphilosophie im literarhistorischen Kontext: Die Elegie Brod und Wein im Vergleich zu Schillers Gedicht Die Götter Griechenlandes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11868