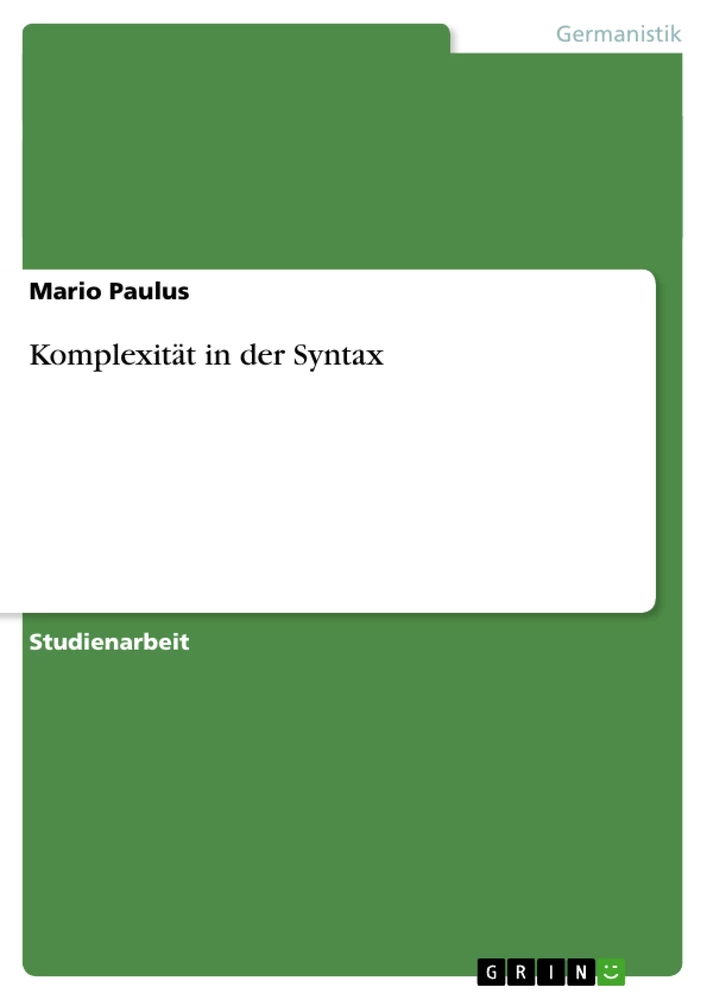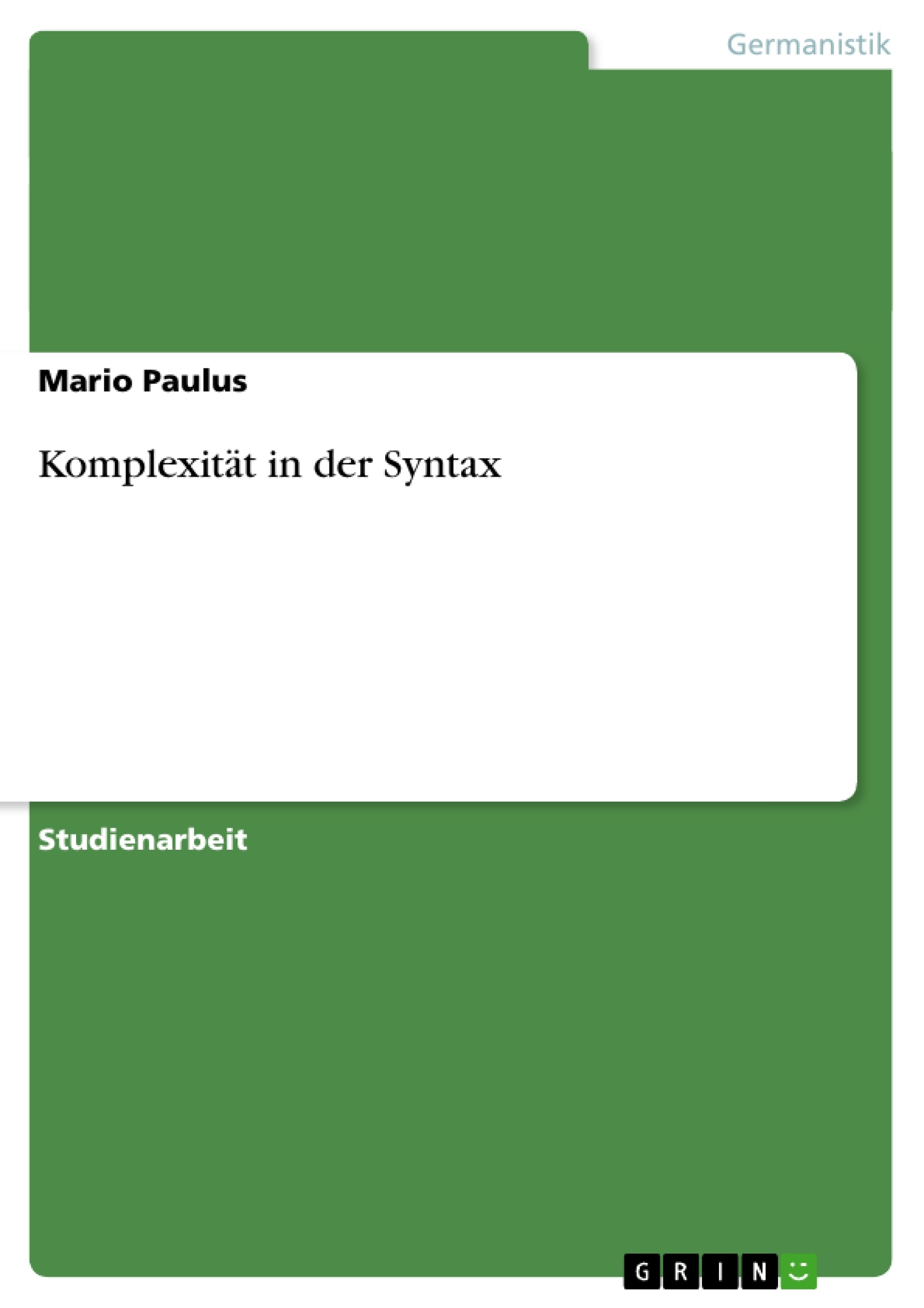Wenn es in der vorliegenden Arbeit um „Komplexität in der Syntax“ gehen soll, so muß zunächst einmal geklärt werden, wie der Begriff der „Komplexität“ verwendet werden soll. Denn unter einer „komplexen Syntax“ wird zumeist ein verschachtelter Satzbau verstanden, also ein aus mehreren, einander neben- oder untergeordneten Teilsätzen zusammengesetzter Satz. Dies hat zur Folge, daß Untersuchungen durchgeführt werden, die die Anzahl der Wörter innerhalb eines Satzes ermitteln sollen, um den Grad der „Komplexität“ eines Satzes – bzw. mehrerer Sätze eines ganzen Textes – zu ermitteln. Die folgende Untersuchung ist unter der Prämisse verfaßt worden, daß ein solches Begriffsverständnis problematisch, wenn nicht gar unangemessen ist. Denn es stellt sich die Frage, wie sinnvoll es eigentlich ist, von einem „komplexen Satz“ zu sprechen, wenn man sich damit nur auf die Form des betreffenden Satzes bezieht. Ergiebiger scheint der Begriff „Komplexität“ dann zu sein, wenn man sich mit einem Satz – oder allgemeiner: einer sprachlichen Äußerung – unter dem Aspekt auseinandersetzt, worin eigentlich die „Komplexität“ besteht und was aus dieser resultiert. So soll im folgenden unter einer komplexen sprachlichen Äußerung eine schwer verständliche Ausdrucksweise verstanden werden, die nicht nur von der Form, sondern auch vom Inhalt her Probleme bereitet.
Dieser Sichtweise liegt die Überzeugung zugrunde, daß Sprache der Kommunikation zu dienen hat. Es stellt sich dann die Frage, woran es liegt, daß die Kommunikation zuweilen mißlingt und sich das (gewünschte) Verständnis der sprachlichen Äußerung nicht einstellt. 1 Damit wiederum befindet man sich im Bereich der Sprachreflexion, in der es u.a. darum geht, daß „der Sprachgebrauch der Kommunikationsbeteiligten zur Diskussion gestellt werden muß“. 2 Letzteres soll anhand zweier Bespiele geschehen, um zu verdeutlichen, in welcher Hinsicht ein Satz „komplex“ (im Sinne von „schwer verständlich“) sein kann. Insofern wird unter der „Komplexität eines Satz“ verstanden, daß sein Verständnis Probleme bereitet. Zugleich wird aber hinsichtlich der Ursache für diese Probleme zwischen „formaler und inhaltlicher Komplexität“ unterschieden. „Formale Komplexität“ bedeutet dann, daß der grammatikalische Bau eines Satzes „komplex“ in dem Sinne ist, daß dieser – im Gegensatz zu einem „einfachen“ Satz – zusammengesetzt ist aus mehreren Teilsätzen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was bedeutet „Komplexität in der Syntax“?
- 2.1 Zum Verhältnis von Syntax und Semantik
- 2.2 „Syntaktische“ versus „semantische“ Komplexität
- 2.3 Komplexität als Charakteristikum der „Moderne“
- 3. Ein Beispiel für formale Komplexität: Heinrich von Kleists Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“
- 3.1 Einordnung der Textstelle
- 3.2 Analyse der Syntax
- 3.3 Inhaltliche Deutung
- 4. Ein Beispiel für inhaltliche Komplexität: Artikel 51, Absatz 3 des Grundgesetzes
- 4.1 Struktur des Problems
- 4.2 Konsequenz der inhaltlichen Komplexität
- 5. Zusammenfassung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den komplexen Begriff der „Komplexität in der Syntax“ und hinterfragt gängige, rein formal ausgerichtete Definitionen. Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis von Komplexität in sprachlichen Äußerungen zu entwickeln, das sowohl formale als auch inhaltliche Aspekte berücksichtigt.
- Definition und Abgrenzung des Komplexitätsbegriffs in der Syntax
- Das Verhältnis von Syntax und Semantik bei der Bestimmung von Komplexität
- Unterscheidung zwischen formaler und inhaltlicher Komplexität
- Analyse von Beispielen für formale und inhaltliche Komplexität in Texten
- Entwicklung eines umfassenderen Verständnisses von sprachlicher Komplexität im Kontext der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Komplexität in der Syntax ein und problematisiert gängige, rein formal orientierte Definitionen von „komplexen Sätzen“. Sie argumentiert, dass Komplexität nicht nur auf den Satzbau beschränkt werden sollte, sondern auch inhaltliche Aspekte des Verständnisses miteinbeziehen muss. Der Fokus liegt auf der Kommunikation und den Gründen, warum diese mitunter scheitert. Die Arbeit kündigt ihre Struktur und die Analyse zweier Beispiele an, die formale und inhaltliche Komplexität verdeutlichen sollen.
2. Was bedeutet „Komplexität in der Syntax“?: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Definition von „Komplexität in der Syntax“. Es untersucht das Verhältnis von Syntax und Semantik und differenziert zwischen „syntaktischer“ und „semantischer“ Komplexität. Weiterhin wird der Begriff der Komplexität im Kontext der „Moderne“ beleuchtet, und es wird argumentiert, dass eine rein formale Betrachtungsweise unzureichend ist, um sprachliche Komplexität angemessen zu erfassen.
3. Ein Beispiel für formale Komplexität: Heinrich von Kleists Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“: Dieses Kapitel analysiert eine Textstelle aus Kleists Erzählung, um die formale Komplexität anhand eines konkreten Beispiels zu demonstrieren. Die Analyse konzentriert sich auf den Satzbau und untersucht, wie dieser zu Verständnisschwierigkeiten führen kann. Inhaltliche Aspekte werden ebenfalls berücksichtigt, um den Zusammenhang zwischen Form und Bedeutung hervorzuheben.
4. Ein Beispiel für inhaltliche Komplexität: Artikel 51, Absatz 3 des Grundgesetzes: Im Gegensatz zu Kapitel 3 wird hier ein Beispiel für inhaltliche Komplexität präsentiert: Artikel 51, Absatz 3 des Grundgesetzes. Die Analyse konzentriert sich auf die Struktur des Problems und die daraus resultierenden Konsequenzen. Die Komplexität liegt hier nicht in der syntaktischen Struktur, sondern im semantischen Gehalt und den impliziten Bedeutungszusammenhängen des Gesetzestextes.
Schlüsselwörter
Komplexität, Syntax, Semantik, Satzbau, formale Komplexität, inhaltliche Komplexität, Kommunikation, Sprachreflexion, Moderne, Heinrich von Kleist, Grundgesetz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Komplexität in der Syntax
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den komplexen Begriff der „Komplexität in der Syntax“ und hinterfragt gängige, rein formal ausgerichtete Definitionen. Sie zielt darauf ab, ein umfassenderes Verständnis von Komplexität in sprachlichen Äußerungen zu entwickeln, das sowohl formale als auch inhaltliche Aspekte berücksichtigt.
Welche Aspekte der Komplexität werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen formaler und inhaltlicher Komplexität. Formale Komplexität bezieht sich auf den Satzbau und die syntaktische Struktur, während inhaltliche Komplexität sich auf den semantischen Gehalt und die impliziten Bedeutungszusammenhänge bezieht.
Wie wird das Verhältnis von Syntax und Semantik behandelt?
Die Arbeit untersucht eingehend das Verhältnis von Syntax und Semantik bei der Bestimmung von Komplexität. Sie argumentiert, dass eine rein formale Betrachtungsweise unzureichend ist, um sprachliche Komplexität angemessen zu erfassen, und dass sowohl syntaktische als auch semantische Aspekte berücksichtigt werden müssen.
Welche Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei Beispiele: eine Textstelle aus Heinrich von Kleists Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“ (als Beispiel für formale Komplexität) und Artikel 51, Absatz 3 des Grundgesetzes (als Beispiel für inhaltliche Komplexität).
Was ist das Ziel der Analyse der Kleist-Textstelle?
Die Analyse der Kleist-Textstelle soll die formale Komplexität anhand eines konkreten Beispiels demonstrieren. Es wird untersucht, wie der Satzbau zu Verständnisschwierigkeiten führen kann, wobei auch inhaltliche Aspekte berücksichtigt werden, um den Zusammenhang zwischen Form und Bedeutung hervorzuheben.
Was ist das Ziel der Analyse des Grundgesetzartikels?
Die Analyse von Artikel 51, Absatz 3 des Grundgesetzes soll die inhaltliche Komplexität veranschaulichen. Der Fokus liegt auf der Struktur des Problems und den daraus resultierenden Konsequenzen. Die Komplexität liegt hier in den semantischen Gehalten und impliziten Bedeutungszusammenhängen des Gesetzestextes, nicht in der syntaktischen Struktur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Komplexität, Syntax, Semantik, Satzbau, formale Komplexität, inhaltliche Komplexität, Kommunikation, Sprachreflexion, Moderne, Heinrich von Kleist, Grundgesetz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Definition von Komplexität in der Syntax (inkl. Verhältnis von Syntax und Semantik und Komplexität in der Moderne), Analyse der formalen Komplexität bei Kleist, Analyse der inhaltlichen Komplexität im Grundgesetz, Zusammenfassung und Literaturverzeichnis.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit plädiert für ein umfassenderes Verständnis von sprachlicher Komplexität, das sowohl formale als auch inhaltliche Aspekte in den Kontext der Kommunikation einbezieht und gängige, rein formal orientierte Definitionen von "komplexen Sätzen" hinterfragt.
- Quote paper
- M.A. Mario Paulus (Author), 2002, Komplexität in der Syntax, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11846