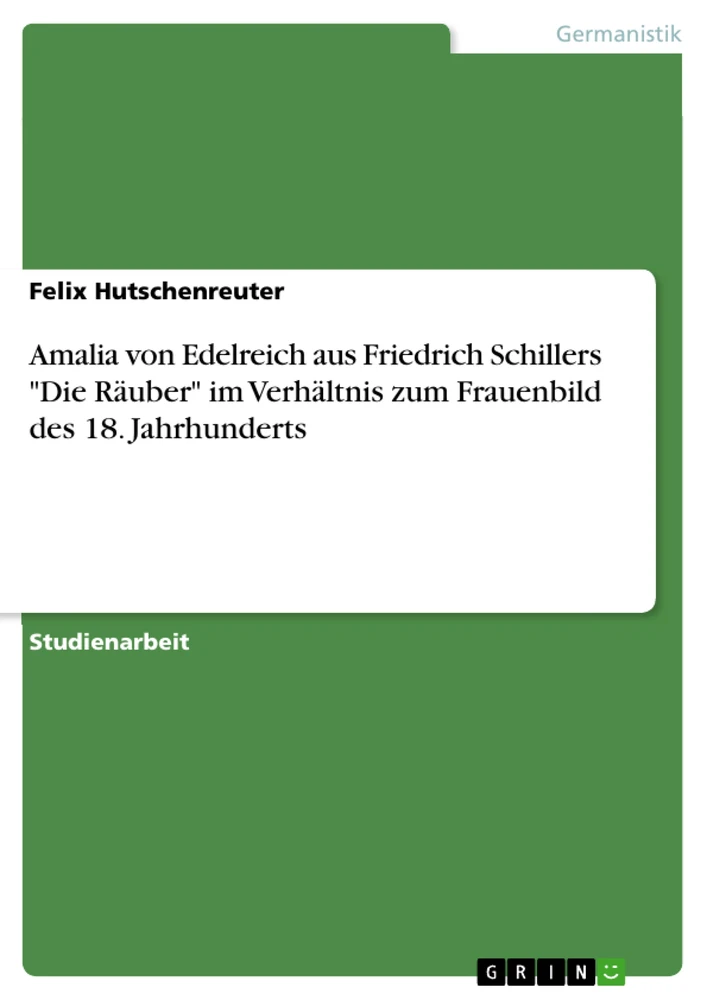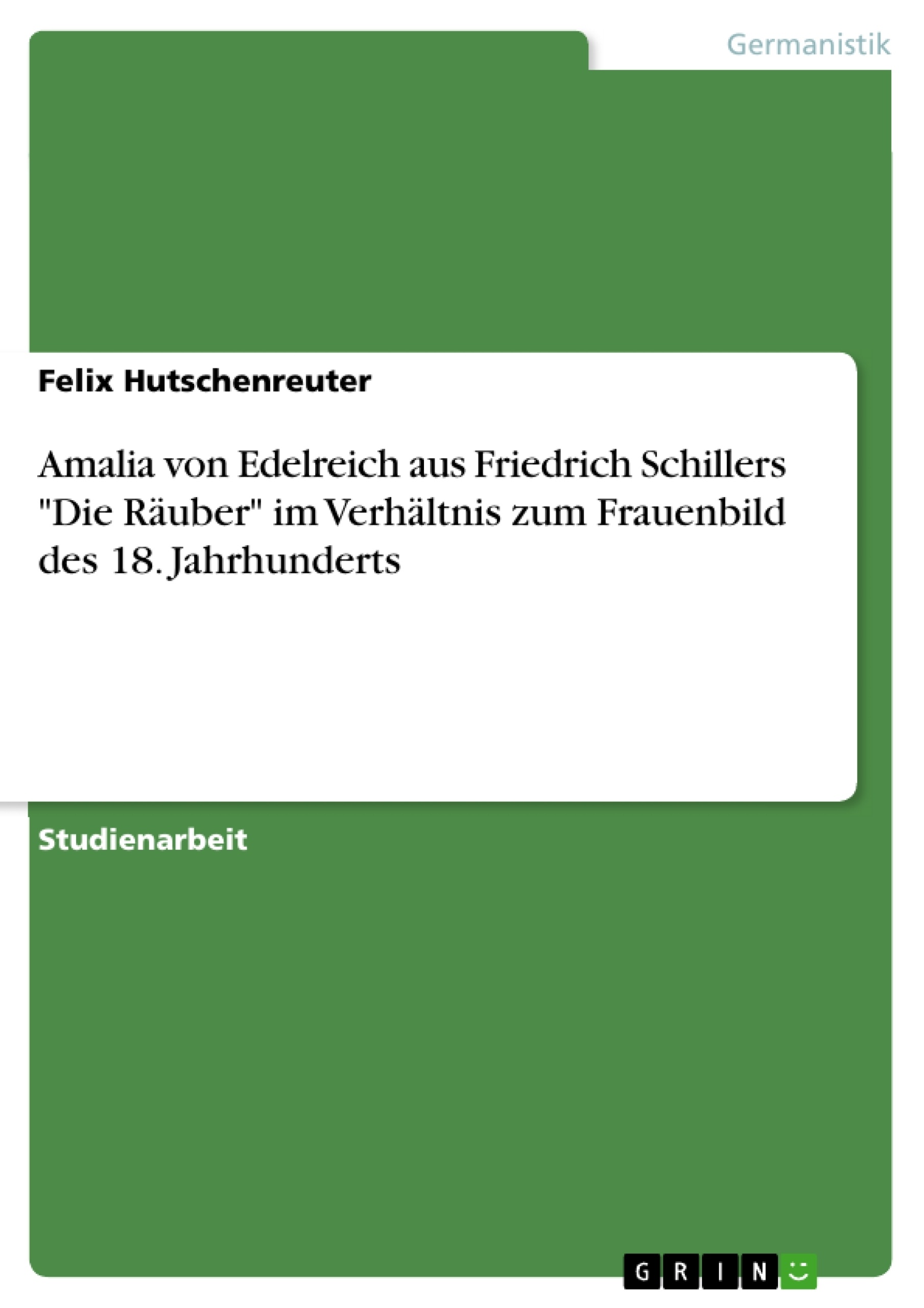Im Mittelpunkt der folgenden Hausarbeit steht die Frage, wie die Figur der Amalia von Edelreich im Verhältnis zum Frauenbild des 18. Jahrhunderts steht. Die Relevanz der Fragestellung wird durch einen Blick in die Forschungsliteratur deutlich. Dort liegt der Fokus vor allem auf dem Bruderkonflikt des Dramas und Amalias Rolle scheint nebensächlich. Da sie jedoch im gesamten Handlungsverlauf immer wieder auftaucht und an fast allen entscheidenden Szenen beteiligt ist, wird diese Arbeit nicht nur ihre Rolle als Frau untersuchen, sondern zusätzlich danach fragen, warum Schiller Amalia so konzipiert hat.
Zunächst wird im ersten Teil der Hausarbeit jedoch das Frauenbild des 18. Jahrhunderts genauer beleuchtet. Im zweiten Teil werden dann die angesprochenen Textstellen gründlich analysiert. Die Hausarbeit wird dadurch interdisziplinär. Sie bewegt sich einerseits in der Disziplin der Geschlechtergeschichte und geht auf der anderen Seite in den textanalytischen Bereich über. Des Weiteren haben sich während des Bearbeitungsprozesses zwei Thesen herausgebildet, auf die in der Arbeit ebenfalls eingegangen werden soll. Zum einen geht es um die Behauptung, dass das Frauenbild im 18. Jahrhundert aus den drei Erwartungen Hausfrau, Ehefrau und Mutter bestand. Diese Ansicht wird im ersten Kapitel be- oder widerlegt werden. Im zweiten Abschnitt der Arbeit wird dann die Annahme "Amalia von Edelreich entspricht nicht dem theoretischen Frauenbild des 18. Jahrhunderts" näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Frauenbild des 18. Jahrhunderts
- Amalia von Edelreich - ein Gegenentwurf?
- Amalias Liebe zwischen Vergötterung und Verzweiflung
- Amalia als selbstbestimmte und selbstbewusste Frau
- Amalia zwischen vernunftgeleitetem und gefühlsbetontem Handeln
- Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Primärquelle
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Figur der Amalia von Edelreich in Friedrich Schillers Drama „Die Räuber“ im Kontext des Frauenbildes des 18. Jahrhunderts. Sie befasst sich mit der Frage, inwiefern Amalia den Erwartungen an Frauen in dieser Zeit entspricht oder sie durchbricht. Die Analyse zielt darauf ab, Amalias Rolle im Drama, ihre Handlungsweise und ihre charakterlichen Eigenschaften im Verhältnis zum damaligen Ideal des weiblichen Geschlechts zu beleuchten.
- Das Frauenbild des 18. Jahrhunderts und seine idealtypischen Merkmale
- Amalias Rolle als selbstbestimmte und selbstbewusste Frau im Drama
- Die Analyse von Amalias Liebe und ihrem Verhalten in den einzelnen Szenen
- Die Bedeutung von Amalias Figur für die Entwicklung der Handlung im Drama
- Schillers Intention bei der Konzeption von Amalias Rolle und ihren Beweggründen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Frauenbild des 18. Jahrhunderts anhand von wissenschaftlichen Quellen und zeigt, wie Frauen in dieser Zeit von der Gesellschaft wahrgenommen wurden. Das Kapitel analysiert die Erwartungen, die an Frauen gestellt wurden, insbesondere in den Bereichen der Hausführung, Ehe und Mutterschaft.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Figur der Amalia von Edelreich in „Die Räuber“ und untersucht, inwieweit sie dem im ersten Kapitel dargestellten Frauenbild des 18. Jahrhunderts entspricht oder nicht. Durch die Analyse von relevanten Szenen wird Amalias Persönlichkeit, ihre Beziehungen zu den männlichen Figuren im Stück und ihre Entscheidungen in Bezug auf die gesellschaftlichen Normen der Zeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Das Frauenbild des 18. Jahrhunderts, Amalia von Edelreich, Friedrich Schiller, „Die Räuber“, Geschlechtergeschichte, Literaturanalyse, Selbstbestimmung, Frauenrolle, Liebe, Verzweiflung, Vernunft, Gefühl, Ehe, Mutterschaft, Familie.
- Quote paper
- Felix Hutschenreuter (Author), 2017, Amalia von Edelreich aus Friedrich Schillers "Die Räuber" im Verhältnis zum Frauenbild des 18. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1184287