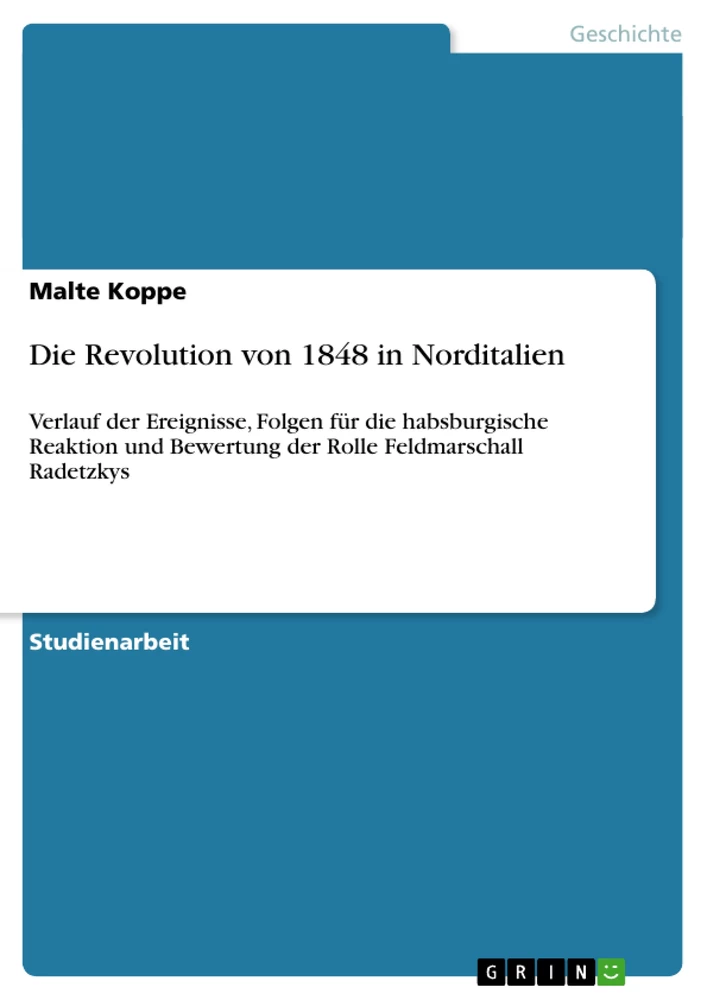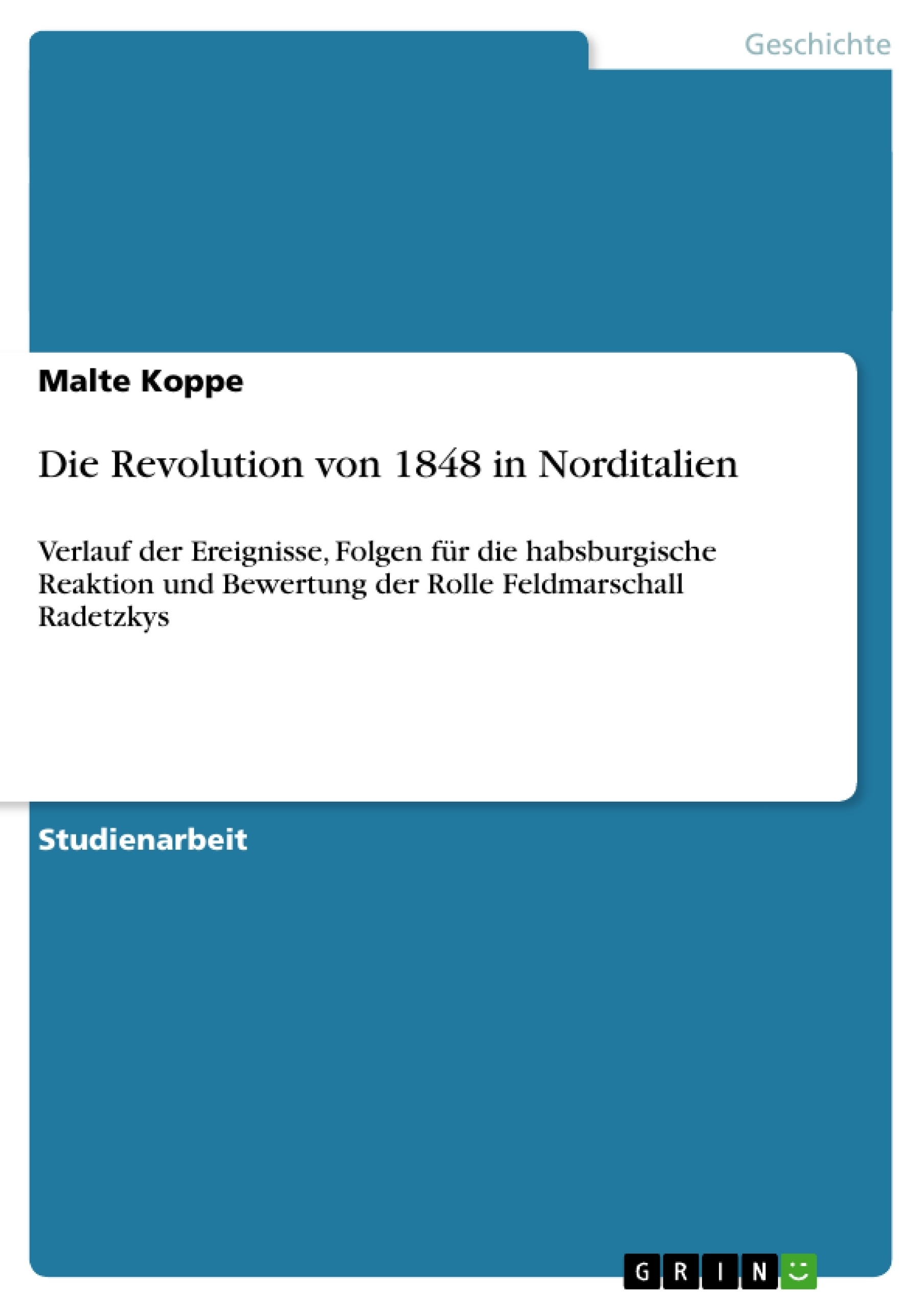3
Die Jahre 1848 und 1849 erschütterten die Grundfeste der alten Ordnung in Europa.
Ausgehend von Frankreich, wo nach dem Sturz des Bürgerkönigs Louis Philippe die
Republik ausgerufen wurde, verbreiteten sich revolutionäre Ideen in ganz Europa. Besonders
in Österreich verbanden und überkreuzten sich soziale, konstitutionelle und eine Vielzahl
nationaler Forderungen an das alte Herrschaftssystem. Nachdem die konservativ geprägte
Habsburgermonarchie die Französische Revolution und die darauf folgenden Napoleonischen
Kriege überdauert hatte, schien es nun, dass das Ende des zentralistischen Kaiserreiches nahe
sei. In Wien war die Regierungsgewalt Mitte März 1848 auf ein liberales Ministerium und
verschiedene demokratische Organe übergegangen. In Ungarn, Böhmen, Norditalien und
Galizien forderten die einzelnen Nationalitäten zuerst Gleichberechtigung und
Mitspracherechte, später sogar Autonomie und Unabhängigkeit. Die Monarchie stand einer
Vielzahl von Krisenherden gegenüber, trotzdem gelang es ihr, sich in den ereignisreichen
Jahren 1848 und 1849 zu behaupten. Einer der ersten Erfolge der Reaktion war die
Niederschlagung des Aufstandes in Norditalien und der Sieg über Piemont. Der Erfolg in der
Schlacht bei Custozza am 25. Juli 1848 und wenig später die Wiedereroberung Mailands am
9. August markierten vorerst das Ende der national-italienischen Einigungsbestrebungen
Lombardo-Venetiens und Piemonts.
Vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen, die in dieser Darstellung beantwortet werden
sollen. Wie verlief der Unabhängigkeitskampf der italienischen Nationalisten? Welche Folgen
hatte dieses Ereignis für den weiteren Verlauf der Gegenrevolution? Welche Gründe lassen
sich für den Sieg des österreichischen Heeres nach anfänglicher Unterlegenheit finden?
Der erste Teil dieser Arbeit enthält eine Betrachtung der Ereignisse des Jahres 1848 in
Lombardo-Venetien und Piemont, unterteilt in die Phasen „Vormärz“, „Revolutionäre
Ereignisse“ und „Gegenoffensive“. Im zweiten Teil wird die Frage nach der Relevanz des
Sieges in Italien für die Gegenrevolution gestellt. Abschießend wird untersucht, welche Rolle
die Feldmarschall Radetzkys für den Sieg spielte. Die Darstellungen des ersten Teils stützen
sich vor allem auf die Bände „1804 - 1914 - Bürgerliche Emanzipation und Staatszerfall in
der Habsburgermonarchie“ in der Reihe „Österreichische Geschichte“ und „Die Revolution
im Kaisertum Österreich 1848-1849“. Aus letzterem ist die beigefügte Karte „Der
Kampfraum zwischen Mincio und Vicenza“ entnommen worden.
Für eine Bewertung der Folgen des Sieges in Italien im dritten Teil der Arbeit sowie für die
nähere Informationen zum Wirken Radetzkys erwies sich außerdem die Monographie „The
Survival of the Habsburg Empire“ als hilfreich.
Details zum österreichischen Militär fanden sich in „Die Habsburgermonarchie 1848-1918 –
Die bewaffnete Macht“.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Krieg und Revolution in Norditalien
2.1 Der Vormärz in Norditalien
2.2 Die revolutionären Ereignisse bis zum Kriegseintritt Piemonts
2.3 Der Verlauf der Gegenoffensive
3 Die Bedeutung des Sieges für die Reaktion in Österreich
4 Der Sieg des österreichischen Heers in Italien – Ein Verdienst Radetzkys?
5 Schluss
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die Jahre 1848 und 1849 erschütterten die Grundfeste der alten Ordnung in Europa. Ausgehend von Frankreich, wo nach dem Sturz des Bürgerkönigs Louis Philippe die Republik ausgerufen wurde, verbreiteten sich revolutionäre Ideen in ganz Europa. Besonders in Österreich verbanden und überkreuzten sich soziale, konstitutionelle und eine Vielzahl nationaler Forderungen an das alte Herrschaftssystem. Nachdem die konservativ geprägte Habsburgermonarchie die Französische Revolution und die darauf folgenden Napoleonischen Kriege überdauert hatte, schien es nun, dass das Ende des zentralistischen Kaiserreiches nahe sei. In Wien war die Regierungsgewalt Mitte März 1848 auf ein liberales Ministerium und verschiedene demokratische Organe übergegangen. In Ungarn, Böhmen, Norditalien und Galizien forderten die einzelnen Nationalitäten zuerst Gleichberechtigung und Mitspracherechte, später sogar Autonomie und Unabhängigkeit. Die Monarchie stand einer Vielzahl von Krisenherden gegenüber, trotzdem gelang es ihr, sich in den ereignisreichen Jahren 1848 und 1849 zu behaupten. Einer der ersten Erfolge der Reaktion war die Niederschlagung des Aufstandes in Norditalien und der Sieg über Piemont. Der Erfolg in der Schlacht bei Custozza am 25. Juli 1848 und wenig später die Wiedereroberung Mailands am 9. August markierten vorerst das Ende der national-italienischen Einigungsbestrebungen Lombardo-Venetiens und Piemonts.
Vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen, die in dieser Darstellung beantwortet werden sollen. Wie verlief der Unabhängigkeitskampf der italienischen Nationalisten? Welche Folgen hatte dieses Ereignis für den weiteren Verlauf der Gegenrevolution? Welche Gründe lassen sich für den Sieg des österreichischen Heeres nach anfänglicher Unterlegenheit finden?
Der erste Teil dieser Arbeit enthält eine Betrachtung der Ereignisse des Jahres 1848 in Lombardo-Venetien und Piemont, unterteilt in die Phasen „Vormärz“, „Revolutionäre Ereignisse“ und „Gegenoffensive“. Im zweiten Teil wird die Frage nach der Relevanz des Sieges in Italien für die Gegenrevolution gestellt. Abschießend wird untersucht, welche Rolle die Feldmarschall Radetzkys für den Sieg spielte. Die Darstellungen des ersten Teils stützen sich vor allem auf die Bände „1804 - 1914 - Bürgerliche Emanzipation und Staatszerfall in der Habsburgermonarchie“ in der Reihe „Österreichische Geschichte“ und „Die Revolution im Kaisertum Österreich 1848-1849“. Aus letzterem ist die beigefügte Karte „Der Kampfraum zwischen Mincio und Vicenza“ entnommen worden.
Für eine Bewertung der Folgen des Sieges in Italien im dritten Teil der Arbeit sowie für die nähere Informationen zum Wirken Radetzkys erwies sich außerdem die Monographie „The Survival of the Habsburg Empire“ als hilfreich.
Details zum österreichischen Militär fanden sich in „Die Habsburgermonarchie 1848-1918 – Die bewaffnete Macht“.
2 Krieg und Revolution in Norditalien
2.1 Der Vormärz in Norditalien
Seit dem Wiener Kongress von 1814/15 war Italien in mehrere Teile geteilt. Im Süden befand sich das doppelte Königreich Sizilien, welches von einer Bourbonischen Dynastie reaktionär regiert wurde. In Mittelitalien lag der päpstliche Kirchenstaat. Norditalien bestand aus einer Reihe kleinerer Staaten, die mehr oder weniger unter österreichischem Einfluss standen. Die folgende Darstellungen bezieht sich ausschließlich auf die beiden direkt zum Habsburgerreich gehörenden Provinzen Lombardei und Venetien sowie auf die Rolle des unabhängigen Königreichs Piemont.
Im Jahre 1831 übernahm Graf Radetzky den Oberbefehl über die in Lombardo-Venetien stationierten habsburgischen Truppen. Der 1766 geborene General blickte bereits auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück und hatte sich in zahlreichen Schlachten ausgezeichnet.
1836 wurde er schließlich zum Feldmarschall befördert und begann in der darauf folgenden Zeit, seine Soldaten verstärkt auf den Ernstfall einer Volkserhebung vorzubereiten, denn die Spannungen innerhalb Lombardo-Venetiens nahmen ständig zu. Schon im November 1847 warnte Radetzky, die Revolution werde im März des folgenden Jahres ausbrechen, „wenn es bis dahin hält“.[1] Die Unzufriedenheit der Bewohner der Lombardei und Venetiens mit dem österreichischen Besatzung und der eigenen politischen Stellung innerhalb der Habsburgermonarchie waren ihm nicht entgangen.
Hauptforderung des emanzipierten Bürgertums[2] der Provinzen waren Reformen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Stellung des Landes. Schon seit dem Zusammenstoß der von Papst Pius IX. bewilligten Bürgerwehr mit österreichischen Garnisonen 1846 äußerten italienische Intellektuelle offen ihre Abneigung gegen die österreichische Besatzung. Am deutlichsten zeigte sich diese in den Worten des Mailänder Volksschriftstellers Cesare Correnti: „Was ein edles Vasallentum vieler föderierter Staaten unter einem Herrscher sein konnte, wurde die schlechteste aller Unterwerfungen, die Versklavung eines Volkes durch ein anderes.“[3]
Im Frühjahr 1848 wiederholte Radetzky nochmals seine Befürchtungen und bat Wien um zusätzliche Truppen. „In Mailand, [der] Lombardei und [im] Venetianischen ist Ruhe – aber es glimmt unter der Asche, jenseits der Lombardei geht die Revolution ihren Gang“.[4]
Tatsächlich entluden sich die Spannungen dann erstmals im „Mailänder Zigarrenrummel“, einem Boykott des hochbesteuerten Tabaks durch wohlhabende Bürger zur Schädigung des österreichischen Fiskus. Bei den folgenden Straßenunruhen gab es erste Opfer sowohl auf österreichischer als auch auf italienischer Seite. Alan Sked sieht die beiden Nationalitäten zu diesem Zeitpunkt bereits als „two seperate communities on the verge of war.“[5]
Nachdem Mitte Februar der Ausnahmezustand verkündet worden war, bedurfte es nur noch eines Funkens, um das von Radetzky beschworene „Glimmen unter der Asche“ zum Feuer der Revolution anzuheizen[6].
2.2 Die revolutionären Ereignisse bis zum Kriegseintritt Piemonts
Nachdem am 18. März 1848 in Mailand öffentlich verkündet wurde, was sich in Wien bisher zugetragen hatte, begann die Revolution auch in den italienischen Provinzen. Nach Straßenkämpfen rund um die örtliche Gemeindeverwaltung, die das Zentrum des Aufstandes bildete, konnten die Revolutionäre am 22. März die Landeshauptstadt erobern.
Die an verschiedenen Orten in ganz Lombardo-Venetien stationierte und zerstreute Armee Radetzkys hatte der allgemeinen Erhebung nichts entgegensetzen können und musste sich zurückziehen. Entsprechend schrieb der Feldmarschall am selben Tag an Minister Ficquelmont: „It is the most frightening decision of my life, but I can no longer hold Milan. The whole country is uprising“.[7]
Gestärkt durch den Erfolg in Mailand änderten sich auch bald die Forderungen der Revolutionsführer. Offen verlangten sie die Unabhängigkeit Lombardo-Venetiens und ignorierten die von Wien unter dem Druck der Ereignisse angebotenen Reformen. Der Advokat Daniele Manin formulierte es in seinem Pariser Exil so: „Wir fordern von Österreich nicht, sich ziviler oder humaner zu betragen, wir fordern einfach, dass es aus Italien abzieht!“[8]. Pietro Kandler, Führer der küstenländischen Italiener, ging sogar so weit, die Ausdehnung des zu schaffenden italienischen Staates auf die Adria-Küstengebiete Triest, Istrien und Dalmatien zu fordern.[9]
[...]
[1] Diakow, J.: Die Erhebung der Italiener gegen Österreich, in: Kiszling, R.: Die Revolution im Kaisertum Österreich, 1. Bd., Wien 1848, S. 88 (zit.: Diakow).
[2] Rumpler, H.: Eine Chance für Mitteleuropa – Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie, in: Wolfram, H. (Hg.): Österreichische Geschichte 1804-1914, Wien 1997, S. 289 (zit.: Rumpler, 1997).
[3] Ebenda.
[4] Ebenda.
[5] Sked, A.: The Survival of the Habsburg Empire, London 1979, S. 106 (zit.: Sked).
[6] Rumpler, 1997, S. 290.
[7] Helfert, J. A. Frhr. von: „Cesati und Pillersdorf und die Anfänge der italienischen Einheitsbewegung“, in: Archiv für Österreichische Geschichte, Wien 1902, S. 159 (zit. nach Sked, S. 125).
[8] Rumpler (1997), S. 290.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Analyse?
Die Analyse befasst sich mit den Ereignissen der Jahre 1848 und 1849 in Norditalien, insbesondere mit dem Unabhängigkeitskampf der italienischen Nationalisten gegen die österreichische Herrschaft in Lombardo-Venetien und der Rolle Piemonts. Sie untersucht die Folgen dieser Ereignisse für die Gegenrevolution in Österreich und die Bedeutung des Sieges des österreichischen Heeres.
Welche geografischen Gebiete werden hauptsächlich betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf Norditalien, insbesondere auf die zum Habsburgerreich gehörenden Provinzen Lombardei und Venetien, sowie auf das Königreich Piemont.
Wer war Graf Radetzky und welche Rolle spielte er?
Graf Radetzky war der Oberbefehlshaber der habsburgischen Truppen in Lombardo-Venetien. Er bereitete seine Soldaten auf eine mögliche Volkserhebung vor und spielte eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung des Aufstandes und dem Sieg über Piemont.
Was waren die Hauptforderungen des Bürgertums in Lombardo-Venetien?
Die Hauptforderungen des Bürgertums waren Reformen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Landes. Sie äußerten auch ihre Abneigung gegen die österreichische Besatzung und forderten schließlich die Unabhängigkeit Lombardo-Venetiens.
Was war der "Mailänder Zigarrenrummel"?
Der "Mailänder Zigarrenrummel" war ein Boykott des hochbesteuerten Tabaks durch wohlhabende Bürger als Protest gegen die österreichische Herrschaft.
Was geschah am 18. März 1848 in Mailand?
Am 18. März 1848 begann die Revolution in Mailand, nachdem die Ereignisse in Wien bekannt wurden. Nach Straßenkämpfen konnten die Revolutionäre am 22. März die Stadt erobern.
Was waren die Folgen des Sieges in Italien für die Gegenrevolution in Österreich?
Die Analyse untersucht, inwieweit der Sieg in Italien zur Stabilisierung der konservativen Kräfte in der Habsburgermonarchie beitrug.
Welche Quellen wurden für die Analyse verwendet?
Die Analyse stützt sich unter anderem auf die Bände "1804 - 1914 - Bürgerliche Emanzipation und Staatszerfall in der Habsburgermonarchie" in der Reihe "Österreichische Geschichte", "Die Revolution im Kaisertum Österreich 1848-1849", "The Survival of the Habsburg Empire" und "Die Habsburgermonarchie 1848-1918 – Die bewaffnete Macht".
Was forderte Daniele Manin?
Daniele Manin forderte, dass Österreich sich aus Italien zurückzieht, um die Unabhängigkeit Lombardo-Venetiens zu erreichen.
- Quote paper
- Malte Koppe (Author), 2004, Die Revolution von 1848 in Norditalien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118426