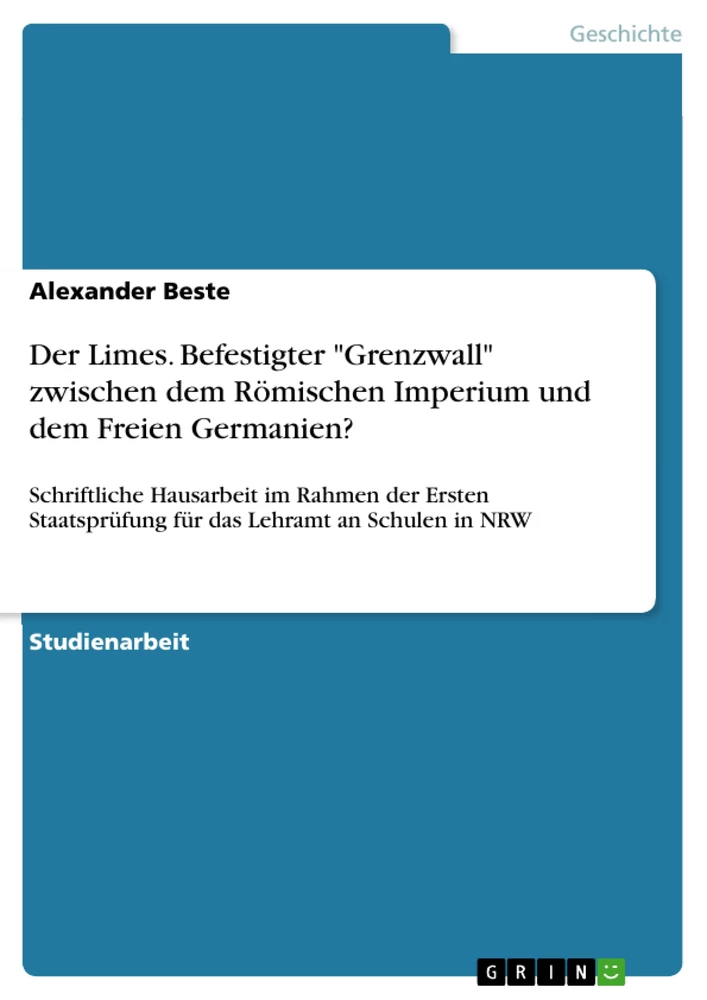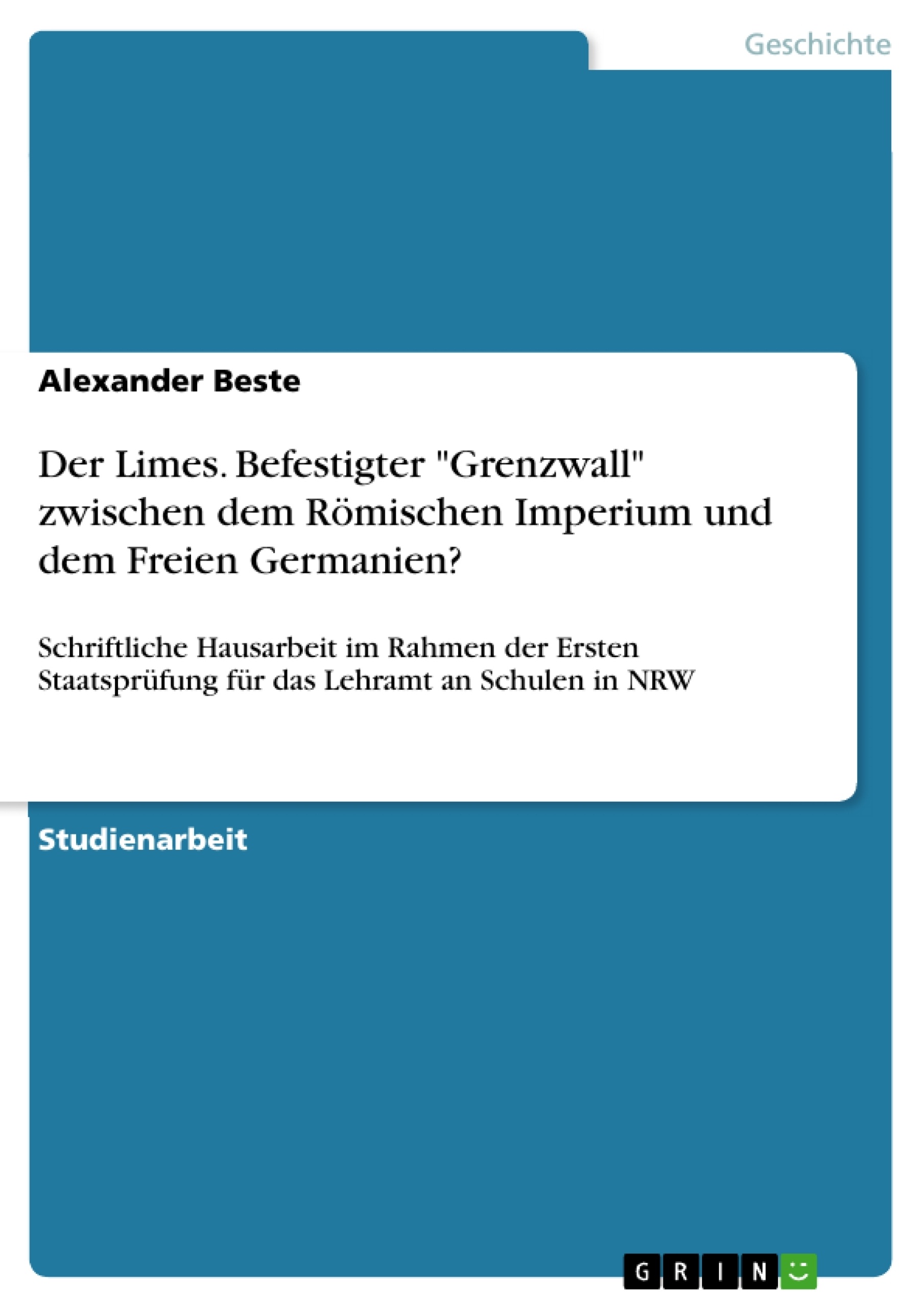Im Kern der vorliegenden Studie sollen zunächst Überlegungen zur terminologischen Klärung des Begriffes limes angestellt werden. Darauf aufbauend soll zumindest ansatzweise die "Germanica“ des Tacitus im Kontext der entsprechenden Fragestellungen beleuchtet werden; auch wenn freilich bereits an dieser Stelle darauf zu verweisen ist, dass man explizite Aussagen zum Bau des limes bei Tacitus vergeblich sucht. Allerdings muss sein Geschichtswerk für
einen Überblick über die Gesamtrelation zwischen römischem Imperium und dem Freien Germanien interessieren. Und schließlich sollen erste Faktoren analysiert werden, weshalb es überhaupt zur Errichtung des Grenzwalles kam. Die römische "Grenzpolitik" sowie die entsprechenden Entstehungshintergründe für die Konzeption und für die Errichtung des limes sind hierbei von übergeordneter Bedeutung.
Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Untersuchung des limes und seiner Grenzziehung zwischen dem Römischen Reich und dem Freien Germanien soll sich daher intensiv mit dem Obergermanischen und mit dem Rätischen limes befasst werden. Von besonderem Wert sollen dabei Analysen zu einzelnen Teilabschnitten beziehungsweise Teilbereichen des limes sein. In einem Exkurs soll anschließend – lediglich zum gesamtkontextuellen Verständnis der römischen Grenzbefestigungen – ein Vergleich mit ähnlichen Grenzbefestigungen an anderen Grenzen des Imperiums erfolgen; vor allem der sogenannte Hadrian‘s Wall in Nordengland soll als wichtige Vergleichsgrundlage dienen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Vorbemerkung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Forschungsstand
- 2. Die Historischen Grundlagen
- 2.1 Die Auseinandersetzungen zwischen Rom und Germanien
- 2.1.1 Militärische Konflikte in der Epoche der Römischen Republik
- 2.1.2 Römisch-Germanische Auseinandersetzungen im Zeitalter der Kaiserzeit
- 2.2 Der friedliche „Austausch“ zwischen Römern und Germanen im Kontext von Kultur und Wirtschaft
- 3. Die Grenzziehung der Römer als Allegorie von Angst und Respekt gegenüber germanischen Einfällen ins Reich oder als Anzeichen lediglich unterschiedlicher Kulturen?
- 3.1 Terminologische Klärung: Der Begriff limes
- 3.2 Tacitus“ „Germanica“ und ihre Bedeutung als wichtigste Quelle zur Untersuchung des Verhältnisses zwischen Römern und Germanen
- 3.3 Zur Funktion des limes als Grenze des römischen Imperiums: Zur Frage des Entstehungshintergrundes und der entsprechenden Grenzpolitik
- 4. Der limes und seine Grenzziehung zwischen Rom und Germanien
- 4.1 Der Streckenverlauf - ein Überblick
- 4.2 Die Besonderheiten des Obergermanisch-Rätischen limes
- 4.3 Exkurs: Vergleich des germanischen limes mit ähnlichen Befestigungsanlagen an anderen Grenzen des Römischen Reiches
- 5. Der limes und seine Geschichte im Kontext von römischer Expansionspolitik und germanischen Einfällen ins Römische Reich
- 5.1 Chronologische Betrachtung: Die unterschiedlichen Phasen der limes-Konstruktion
- 5.2 Die limes-„Bestandteile“
- 5.2.1 Die „unmittelbaren“ Grenzelemente von Patrouillenweg, Palisade und Wachttürmen
- 5.2.1.1 Der Kontrollweg
- 5.2.1.2 Der Kontrollturm
- 5.2.1.3 Palisade, Erdwall und Graben
- 5.2.1.4 Die „Grenzdurchgangsstellen“
- 5.2.2 Die Bedeutung der Truppenlager und Kastelle
- 5.3 Das limes-„Hinterland“ und dessen Bedeutung als Territorium kultureller und wirtschaftlicher Kontakte
- 6. Einzelfallbetrachtungen
- 6.1 Der limes im Gebiet von Lahn und Lippe als frühe Grenzregion zwischen Römischem Reich und „Barbarenland“
- 6.2 Die Bedeutung des limes während der Herrschaftsepoche der Adoptivkaiser
- 7. Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den römischen Limes, seine Funktion als Grenze zwischen dem Römischen Reich und Freien Germanien, und seine Bedeutung im Kontext der römisch-germanischen Beziehungen. Die Arbeit analysiert den Limes nicht nur als militärische Befestigung, sondern auch als Ausdruck der römischen Politik und Ideologie gegenüber den germanischen Nachbarn.
- Der Limes als militärische Verteidigungslinie
- Der Limes als Symbol römischer Macht und Herrschaft
- Der kulturelle und wirtschaftliche Austausch zwischen Römern und Germanen entlang des Limes
- Die Entwicklung des Limes im Laufe der römischen Geschichte
- Der Limes als Forschungsgegenstand der Archäologie und Geschichtswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Limes als herausragendes Forschungs- und Bodendenkmal. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Funktion des Limes – als militärische Verteidigungsanlage oder symbolische Demarkationslinie – und betont die Bedeutung der Kaiserzeit für dessen Entwicklung. Die Einleitung verweist auf die ideologisch-propagandistische Nutzung des Limes im 19. und frühen 20. Jahrhundert und dessen Rolle im Kontext der römisch-germanischen Beziehungen, insbesondere im Hinblick auf die Varusschlacht.
2. Die Historischen Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Auseinandersetzungen zwischen Römern und Germanen, sowohl die militärischen Konflikte in der Republik- als auch die im Kaiserzeit. Es analysiert den friedlichen Austausch zwischen den beiden Kulturen im Bereich Wirtschaft und Kultur. Dieses Kapitel legt den historischen Hintergrund für das Verständnis der Entstehung und Funktion des Limes.
3. Die Grenzziehung der Römer: Hier wird der Begriff „limes“ terminologisch geklärt. Die „Germanica“ des Tacitus wird als zentrale Quelle für die Untersuchung des Verhältnisses zwischen Römern und Germanen vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Funktion des limes als Grenze des römischen Imperiums, seinen Entstehungshintergrund und der damit verbundenen römischen Grenzpolitik. Das Kapitel diskutiert die Frage der militärischen Bedrohung und der symbolischen Machtdemonstration durch den Limesbau.
4. Der limes und seine Grenzziehung: Dieses Kapitel beschreibt den Streckenverlauf des Limes, besonders den Obergermanisch-Rätischen Limes. Es vergleicht den germanischen Limes mit ähnlichen Befestigungsanlagen an anderen Grenzen des Römischen Reiches, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und ein umfassenderes Verständnis der römischen Grenzpolitik zu entwickeln.
5. Der limes und seine Geschichte: Dieses Kapitel bietet eine chronologische Betrachtung der verschiedenen Phasen der Limes-Konstruktion und analysiert die einzelnen Bestandteile des Limes (Kontrollweg, Türme, Palisaden, Erdwälle, Grenzdurchgangsstellen, Truppenlager, Kastelle) und deren Funktion. Es beleuchtet zudem die Bedeutung des Limes-Hinterlandes als Raum kultureller und wirtschaftlicher Kontakte.
6. Einzelfallbetrachtungen: In diesem Kapitel werden exemplarisch der Limes im Gebiet von Lahn und Lippe als frühe Grenzregion und die Bedeutung des Limes während der Herrschaftsepoche der Adoptivkaiser untersucht, um ein detailliertes Bild der regionalen und zeitlichen Entwicklung des Limes zu vermitteln. Die einzelnen Fallstudien bieten eine vertiefte Analyse spezifischer Abschnitte des Limes und deren Bedeutung.
Schlüsselwörter
Römischer Limes, Germanien, Römisches Reich, Grenzbefestigung, Militärische Verteidigung, Symbolische Machtdemonstration, Kultureller Austausch, Wirtschaftlicher Austausch, Römisch-Germanische Beziehungen, Archäologie, Geschichtswissenschaft, Tacitus, Germania, Kaiserzeit, Republik, Expansionspolitik, Grenzpolitik.
Häufig gestellte Fragen zum römischen Limes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem römischen Limes, seiner Funktion als Grenze zwischen dem Römischen Reich und Germanien, und seiner Bedeutung im Kontext der römisch-germanischen Beziehungen. Sie analysiert den Limes sowohl als militärische Befestigung als auch als Ausdruck römischer Politik und Ideologie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Den Limes als militärische Verteidigungslinie, als Symbol römischer Macht, den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch entlang des Limes, die Entwicklung des Limes im Laufe der römischen Geschichte und den Limes als Forschungsgegenstand der Archäologie und Geschichtswissenschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Historische Grundlagen) beleuchtet die Auseinandersetzungen zwischen Römern und Germanen. Kapitel 3 (Die Grenzziehung der Römer) klärt den Begriff „limes“ und analysiert Tacitus' „Germanica“. Kapitel 4 (Der Limes und seine Grenzziehung) beschreibt den Streckenverlauf und vergleicht ihn mit anderen römischen Grenzbefestigungen. Kapitel 5 (Der Limes und seine Geschichte) bietet eine chronologische Betrachtung der Konstruktion und Bestandteile des Limes. Kapitel 6 (Einzelfallbetrachtungen) untersucht den Limes in spezifischen Regionen und Epochen. Kapitel 7 (Resümee und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Als zentrale Quelle wird Tacitus' „Germanica“ genannt. Die Arbeit stützt sich außerdem auf archäologische Funde und historische Aufzeichnungen, um die Entwicklung und Funktion des Limes zu rekonstruieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römischer Limes, Germanien, Römisches Reich, Grenzbefestigung, Militärische Verteidigung, Symbolische Machtdemonstration, Kultureller Austausch, Wirtschaftlicher Austausch, Römisch-Germanische Beziehungen, Archäologie, Geschichtswissenschaft, Tacitus, Germania, Kaiserzeit, Republik, Expansionspolitik, Grenzpolitik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Funktion des römischen Limes – war er primär eine militärische Verteidigungsanlage oder eine symbolische Demarkationslinie? Sie analysiert die Rolle des Limes im Kontext der römisch-germanischen Beziehungen und beleuchtet seine Bedeutung als Forschungsgegenstand.
Welche Bedeutung hat der Limes im Kontext der römisch-germanischen Beziehungen?
Der Limes wird in der Arbeit als Ausdruck der römischen Politik und Ideologie gegenüber den germanischen Nachbarn interpretiert. Die Arbeit analysiert sowohl die militärischen Konflikte als auch den friedlichen Austausch zwischen Römern und Germanen entlang des Limes.
Wie wird der Limes in dieser Arbeit betrachtet?
Der Limes wird nicht nur als militärische Befestigung, sondern auch als Ausdruck der römischen Politik und Ideologie gegenüber den germanischen Nachbarn betrachtet. Die Arbeit berücksichtigt den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch entlang des Limes.
Welche Epochen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Epochen der römischen Republik und der Kaiserzeit, mit besonderem Fokus auf die Kaiserzeit, in der der Limes seine größte Ausdehnung erreichte.
- Quote paper
- Alexander Beste (Author), 2010, Der Limes. Befestigter "Grenzwall" zwischen dem Römischen Imperium und dem Freien Germanien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1184124