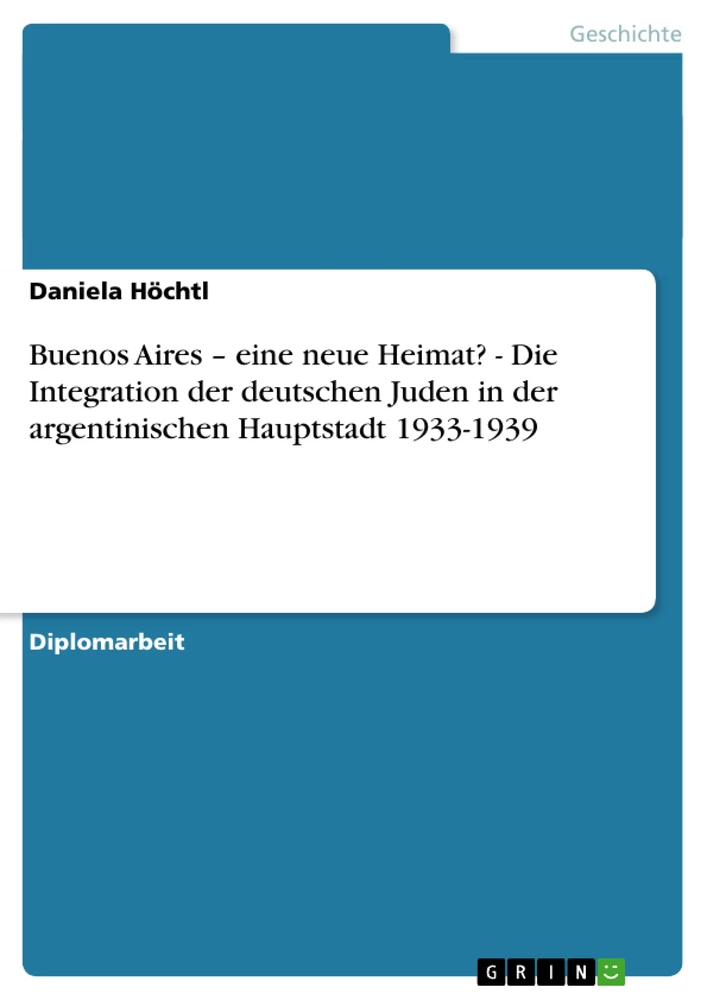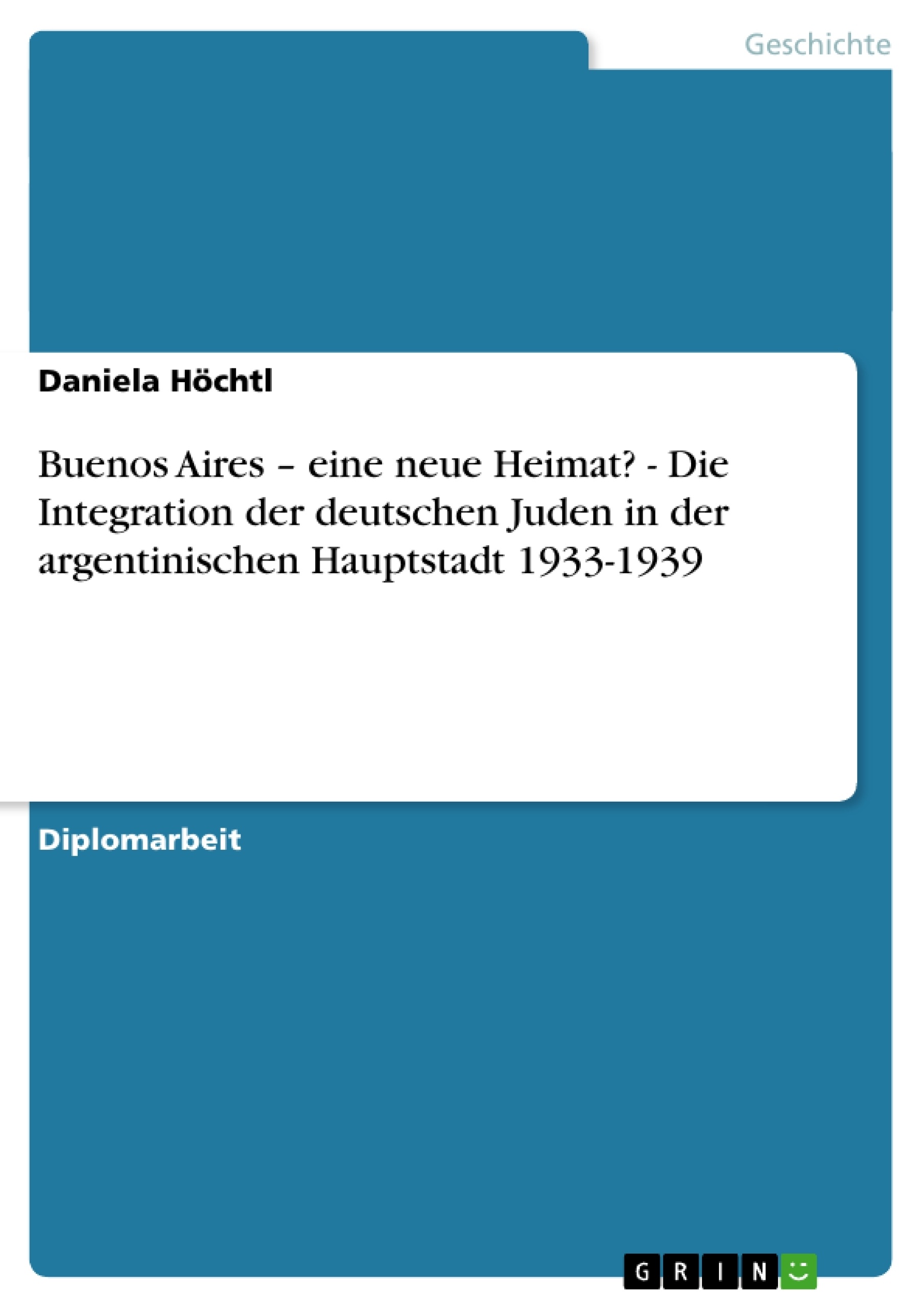Im Zuge der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland im Jahre 1933 vollzog sich ein tiefgreifender Einschnitt für die deutsche Gesellschaft, in dessen Folge mit totalitärer und rassistischer Weltsicht von Anfang an gegen Oppositionelle und ethnisch definierte Gegner wie Juden und Roma vorgegangen wurde. Viele von ihnen wurden durch Bedrängung und Verfolgung zur Emigration gezwungen. Für Juden ebenso wie für die politischen Flüchtlinge bedeutete die Flucht eine Zäsur in ihrem Leben. Sie mussten ihre Heimat, Verwandte
und Freunde zurücklassen, verloren materielle Güter und erworbene Qualifikationen und erlebten psychische Extremsituationen. Doch auch wenn Emigration zwangsweise eintritt, so ermöglicht sie immer auch neue Erfahrungen und Lernprozesse in den Zufluchtsländern. Die Idee zu dieser Arbeit entstand durch eine Radiosendung im November 2006, in der Deutsche jüdischen Glaubens, die aus Bayern stammten und während des Dritten Reichs flüchten konnten, über ihre Emigrationserfahrungen berichteten und die Herausforderungen
schilderten, die sie durch die Umstellung von der bayerischen auf die unbekannte Kultur in Buenos Aires gezwungenermaßen meistern mussten. Viele denken heute bei der argentinischen Hauptstadt vor allem an die dort nach Kriegsende „schutzsuchenden“ Nationalsozialisten. Dass Buenos Aires jedoch während des Dritten Reichs nach den USA und Palästina zum wichtigsten Zufluchtsort für deutsch-jüdische Flüchtlinge wurde, in dem sich ab 1933 eine
kleine deutsch-jüdische Exil-Gemeinde bildete, ist nur den wenigsten bekannt. Auch im Landesinneren von Argentinien kam es zu Ansiedlungen. Da jedoch auf dem Land völlig andere Lebensbedingungen herrschten, die mit den Verhältnissen in der südamerikanischen Metropole nicht vergleichbar waren, soll sich diese Arbeit lediglich auf den Integrationsprozess der deutsch-jüdischen Einwanderer in Buenos Aires konzentrieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die Flucht
- 2.1 Situation der Juden im Dritten Reich
- 2.2 Umfang, Berufs- und Sozialstruktur der deutsch-jüdischen Argentinien-Emigration 1933-1939
- 2.3 Fluchtziel Argentinien
- 3. Ankunft in Argentinien
- 3.1 Integrationsprobleme
- 3.2 Erste Anlaufstellen
- 3.2.1 Der Hilfsverein deutschsprechender Juden
- 3.2.2 Andere Anlaufstellen
- 3.3 Lebensverhältnisse in Buenos Aires
- 4. Die Integration der deutsch-jüdischen Einwanderer in Buenos Aires
- 4.1 Die berufliche Integration und wirtschaftliche Leistung der deutschen Juden
- 4.2 Die sprachliche Integration
- 4.3 Beziehungen zur deutschen Gemeinde in Buenos Aires
- 4.4 Religiöses und kulturelles Leben
- 4.5 Die deutschsprachigen Medien
- 4.6 Integrationsbemühungen durch Bildungseinrichtungen
- 5. Buenos Aires - eine neue Heimat?
- 5.1 Exil-Emigration - Assimilation
- 5.2 Assimilationsgrad und Identität der Einwanderergeneration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration deutscher Juden in Buenos Aires zwischen 1933 und 1939. Sie beleuchtet den Fluchtprozess, die Ankunft in Argentinien und die Herausforderungen der Integration in die argentinische Gesellschaft. Der Fokus liegt dabei auf den Erfahrungen der Einwanderer in Buenos Aires.
- Flucht deutscher Juden vor dem Nationalsozialismus
- Ankunft und erste Erfahrungen in Buenos Aires
- Berufliche und soziale Integration
- Sprachliche und kulturelle Anpassung
- Entwicklung einer neuen Identität im Exil
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit untersucht die Integration deutscher Juden in Buenos Aires während des Dritten Reiches, ausgehend von einer Radiosendung, die Emigranten-Erfahrungen thematisierte. Sie hebt die bisherige Forschungslücke zu diesem Thema hervor und betont die Bedeutung von Buenos Aires als wichtiges Zufluchtsziel neben den USA und Palästina. Der Fokus liegt auf der Integration in Buenos Aires, nicht im Landesinneren Argentiniens, aufgrund unterschiedlicher Lebensbedingungen. Die Arbeit befasst sich mit deutsch-jüdischen Einwanderern, unter Einbeziehung von „Halbjuden“ und „Nichtariern“, und analysiert deren Flucht, Ankunft und Integrationsprozess in drei Abschnitten.
2. Die Flucht: Dieses Kapitel beschreibt die Situation der Juden im Dritten Reich, den Umfang und die sozioökonomische Struktur der deutsch-jüdischen Emigration nach Argentinien zwischen 1933 und 1939, und schließlich die Wahl Argentiniens als Fluchtziel. Es beleuchtet die Gründe für die Flucht, die Umstände der Auswanderung und die Herausforderungen, vor denen die Flüchtlinge standen.
3. Ankunft in Argentinien: Das Kapitel behandelt die Integrationsprobleme der Neuankömmlinge, ihre ersten Anlaufstellen (insbesondere der Hilfsverein deutschsprechender Juden und andere Organisationen), und ihre Lebensverhältnisse in Buenos Aires. Es analysiert die Schwierigkeiten der Anpassung an eine neue Kultur und die Unterstützung, die die Flüchtlinge erhielten.
4. Die Integration der deutsch-jüdischen Einwanderer in Buenos Aires: Dieser Abschnitt untersucht die berufliche Integration und wirtschaftliche Leistung der deutschen Juden, ihre sprachliche Integration, die Beziehungen zur deutschen Gemeinde in Buenos Aires sowie deren religiöses und kulturelles Leben. Es wird die Rolle deutschsprachiger Medien und die Integrationsbemühungen von Bildungseinrichtungen beleuchtet.
5. Buenos Aires - eine neue Heimat?: Das vorletzte Kapitel analysiert, ob und inwieweit die deutschen Juden in Buenos Aires eine neue Heimat fanden. Es untersucht den Prozess der Assimilation, den Grad der Integration und die Entwicklung der Identität der Einwanderergeneration.
Schlüsselwörter
Deutsche Juden, Argentinien, Buenos Aires, Emigration, Flucht, Drittes Reich, Nationalsozialismus, Integration, Assimilation, Identität, Exil, Hilfsverein, Lebensverhältnisse, Wirtschaftsleistung, Sprache, Kultur, Medien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur deutsch-jüdischen Emigration nach Buenos Aires (1933-1939)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Integration deutscher Juden in Buenos Aires zwischen 1933 und 1939. Sie beleuchtet den Fluchtprozess aus dem nationalsozialistischen Deutschland, die Ankunft in Argentinien und die Herausforderungen der Integration in die argentinische Gesellschaft. Der Fokus liegt auf den Erfahrungen der Einwanderer in Buenos Aires.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Flucht deutscher Juden vor dem Nationalsozialismus, die Ankunft und ersten Erfahrungen in Buenos Aires, die berufliche und soziale Integration, die sprachliche und kulturelle Anpassung sowie die Entwicklung einer neuen Identität im Exil. Die Analyse umfasst die Situation der Juden im Dritten Reich, den Umfang der Emigration, die Wahl Argentiniens als Fluchtziel, Integrationsprobleme, die Rolle von Hilfsorganisationen (wie dem Hilfsverein deutschsprechender Juden), die berufliche und wirtschaftliche Leistung der Einwanderer, ihre sprachliche und kulturelle Integration, Beziehungen zur deutschen Gemeinde, religiöses und kulturelles Leben, die Rolle deutschsprachiger Medien und die Integrationsbemühungen von Bildungseinrichtungen. Schließlich wird der Assimilationsgrad und die Identitätsfindung der Einwanderergeneration untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung, 2. Die Flucht, 3. Ankunft in Argentinien, 4. Die Integration der deutsch-jüdischen Einwanderer in Buenos Aires, und 5. Buenos Aires - eine neue Heimat? Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt des Integrationsprozesses, beginnend mit der Flucht und endend mit der Frage nach der Entwicklung einer neuen Heimat im Exil.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist im Haupttext nicht enthalten. Es wird jedoch erwähnt, dass die Arbeit von einer Radiosendung ausgeht, die Emigranten-Erfahrungen thematisierte. Weitere Quellen sind aus dem Kontext zu erschließen.
Warum konzentriert sich die Arbeit auf Buenos Aires?
Die Arbeit konzentriert sich auf Buenos Aires, da die Lebensbedingungen dort von denen im Landesinneren Argentiniens abwichen, und es somit einen Fokus auf ein konkretes Integrationsumfeld ermöglicht.
Welche Gruppen von Einwanderern werden betrachtet?
Die Arbeit berücksichtigt deutsch-jüdische Einwanderer, inklusive „Halbjuden“ und „Nichtarier“, um ein umfassenderes Bild der Emigration und Integration zu zeichnen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Juden, Argentinien, Buenos Aires, Emigration, Flucht, Drittes Reich, Nationalsozialismus, Integration, Assimilation, Identität, Exil, Hilfsverein, Lebensverhältnisse, Wirtschaftsleistung, Sprache, Kultur, Medien.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Integration deutscher Juden in Buenos Aires zwischen 1933 und 1939 zu untersuchen und die damit verbundenen Herausforderungen und Erfolge zu beleuchten. Sie will ein detailliertes Verständnis des Fluchtprozesses, der Ankunft und des Integrationsprozesses dieser Gruppe von Einwanderern bieten.
- Quote paper
- Daniela Höchtl (Author), 2007, Buenos Aires – eine neue Heimat? - Die Integration der deutschen Juden in der argentinischen Hauptstadt 1933-1939, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118388