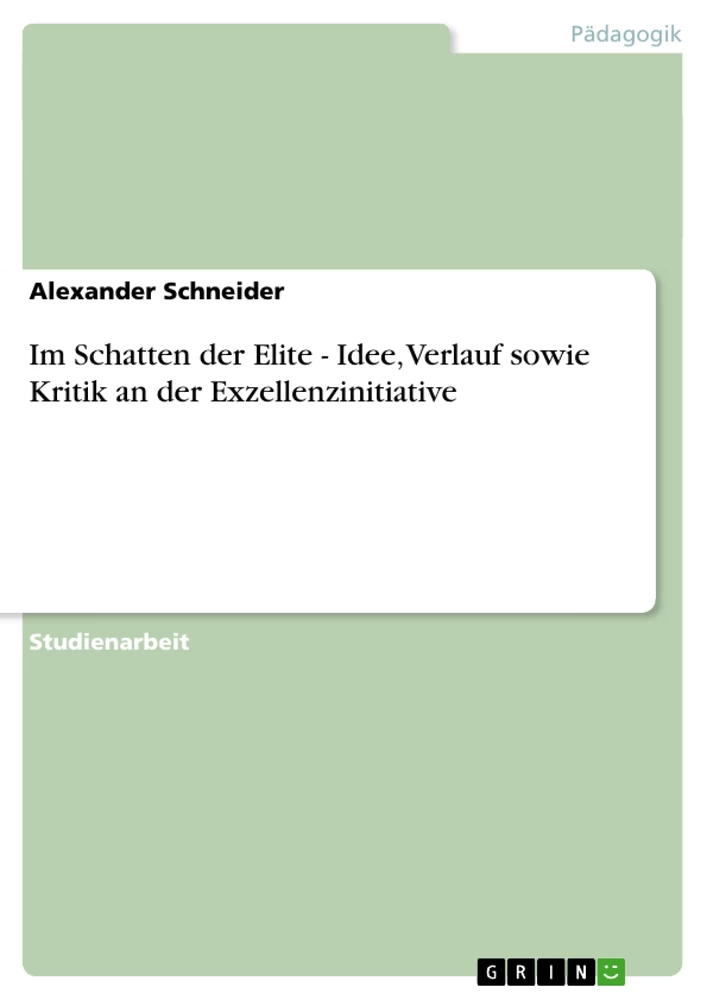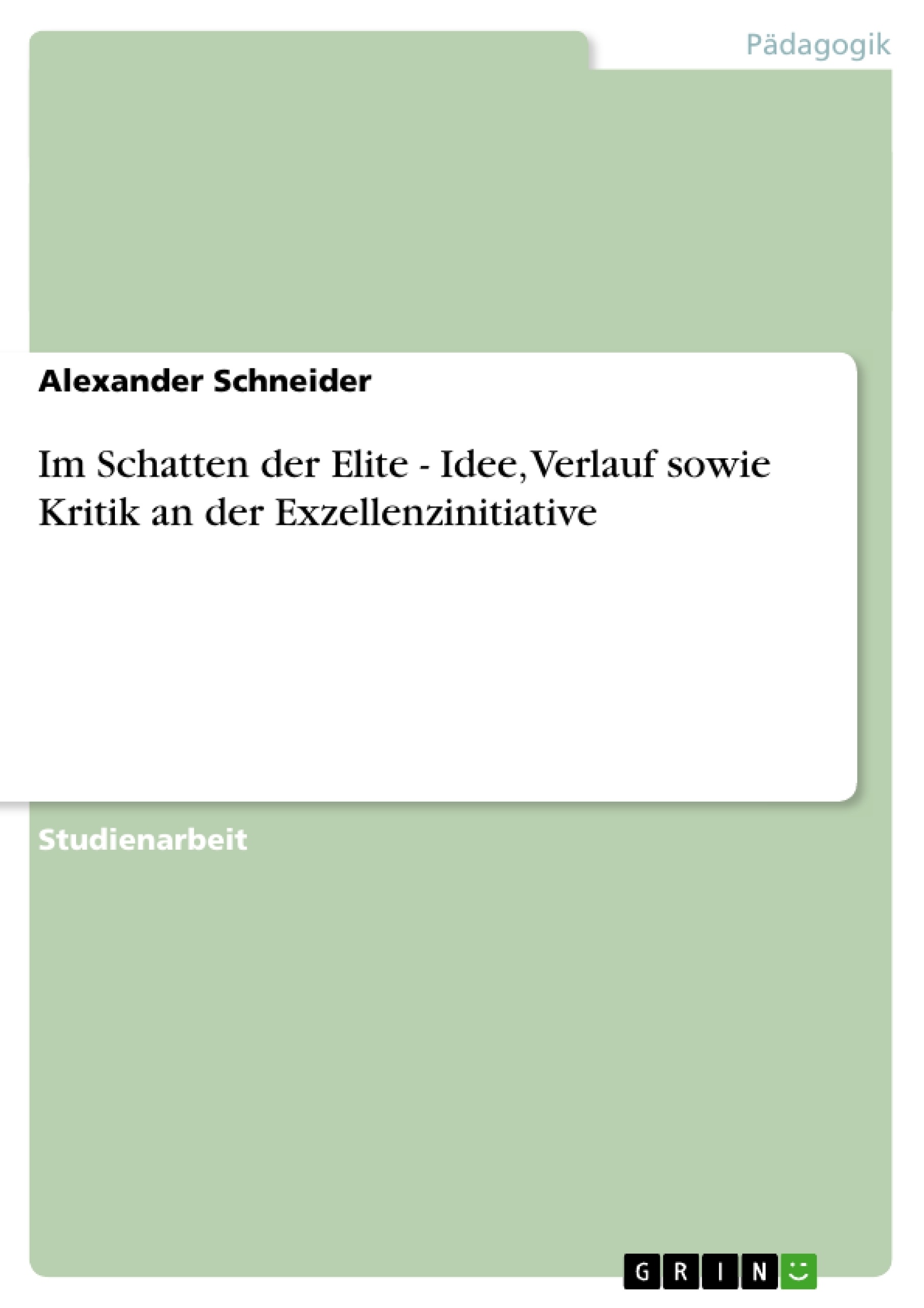Die Funktion von gesellschaftlichen Führungsgruppen wurde schon immer
kontrovers diskutiert. Mit der längst begonnenen Umsetzung der
Exzellenzinitiative ist hierbei aber erneut Öl ins Feuer gegossen worden.
Zurecht stellt man sich die Frage, ob und wofür Deutschland eigentlich
eine wissenschaftliche Elite benötigt. Haben Eliten nicht einen erhöhten
Einfluss auf die Gesellschaft und passen somit nicht in unser
demokratisches Politikverständnis (vgl. www.uebergebuehr.de/uploads/me
dia/AKBp_Elitebegriff.pdf)?
Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass dieser Begriff
lange Zeit tabuisiert und stattdessen eher eine mildernde Wortwahl wie
beispielsweise „Spitzenuniversität“ oder „Leuchttürme der Wissenschaft“
bevorzugt worden ist. Den unangenehmen Beigeschmack hat der
Ausdruck sicherlich im höchsten Maße seiner Vergangenheit zu
verdanken. Darüber hinaus kann eine schleichende Umbenennung keine
Änderung der zugrunde liegenden Idee zur Folge haben, ganz gleich wie
es formuliert wird. Bevor in dieser Hausarbeit der eigentliche Gegenstand
der Exzellenzinitiative präziser dargestellt wird, lohnt es sich den Elite-
Ausdruck von einem geschichtlichen Standpunkt zu betrachten. Obwohl
dieser bereits seit Anbeginn des politischen Denkens existiert, ist der
eigentliche Begriff erst ca. 200 Jahre alt und bedeutet etymologisch
gesehen soviel wie „Auswahl“ (lat.: eligere). Heute ist unser
Eliteverständnis hauptsächlich von der Vorstellung des eigenständigen (!)
Aufstiegs weniger Menschen in eine gesellschaftlich führende Gruppe
geprägt. Diese werden als sog. Leistungselite definiert, wohingegen
Menschen, die diese Position auf Grund von politischen, ökonomischen
und/oder gesellschaftlichen Privilegien für sich beanspruchen, zu den sog.
Herkunfts- bzw. Besitzeliten zählen. Relativ spontan bringt man letztere
mit dem klassischen Adel in Verbindung, der so in seiner alten Tradition
jedoch nicht mehr existiert. Ferner wurde der Elitebegriff aber auch von
einem ideologischen Standpunkt heraus interpretiert. So berief sich das
nationalsozialistische Regime auf die Herrschaft bzw. Überlegenheit der
arischen Rasse über den Rest der Welt (vgl. www.uebergebuehr.de/uploa
ds/media/AKBp_Elitekritik.pdf).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung / Definitionsversuch
- 2. Entstehungsgeschichte
- 2. Notwendige sowie kritische Fragestellungen
- 3. Die Gegenstände der Förderung
- 3.1 Graduiertenschule
- 3.2 Exzellenzcluster
- 3.2 Zukunftskonzepte
- 4. Zeitlicher Verlauf
- 4.1 Ergebnis der ersten Ausschreibungsrunde
- 4.2 Ergebnis der zweiten Ausschreibungsrunde
- 5. Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren
- 6. Das Märchen von der Chancengleichheit
- 7. Steigerung der sozialen Selektivität
- 8. Die Elite und sein Fußvolk
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Exzellenzinitiative, deren Entstehung, Ziele und Kritikpunkte. Sie untersucht die Frage nach der Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Elite in Deutschland und hinterfragt die Auswirkungen der Initiative auf die Chancengleichheit im deutschen Hochschulsystem.
- Entstehungsgeschichte und Ziele der Exzellenzinitiative
- Fördergegenstände und -verfahren der Initiative
- Kritik an der Chancengleichheit und sozialer Selektivität
- Auswirkungen auf das deutsche Hochschulsystem
- Der Begriff der Elite und seine gesellschaftliche Relevanz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung / Definitionsversuch: Die Einleitung diskutiert kontrovers die Funktion gesellschaftlicher Führungsgruppen und den Begriff der Elite. Sie beleuchtet unterschiedliche Definitionen von Eliten (Leistungselite vs. Herkunftselite) und deren historische und ideologische Konnotationen, insbesondere im Kontext des Nationalsozialismus. Die Arbeit kündigt eine kritische Auseinandersetzung mit der Exzellenzinitiative an, welche die Frage nach der Leistung versus Herkunft im Kontext der Elitebildung untersucht.
2. Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beschreibt den Ursprung der Exzellenzinitiative im Vorschlag Gerhard Schröders, zehn deutsche Universitäten zu internationalen Spitzenhochschulen auszubauen. Es betont den anfänglichen Fokus auf einen Leistungswettbewerb und den Anspruch auf Chancengleichheit aller Hochschulen. Das Kapitel erläutert die Finanzierung durch die UMTS-Lizenzen und die Beauftragung der DFG und des Wissenschaftsrates mit der Durchführung. Die Initiative zielt auf die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, konzentriert sich jedoch primär auf Wissenschaft und Forschung, nicht auf Lehre und Ausbildung.
2.1 Notwendige sowie kritische Fragestellungen: Dieser Abschnitt stellt kritische Fragen zur Exzellenzinitiative. Es wird angezweifelt, ob die Initiative ihre Ziele erreicht und ob der Grundsatz der Chancengleichheit tatsächlich umgesetzt wird. Die zentrale Frage nach den Konsequenzen für die soziale Zugänglichkeit des Universitätssystems und die Entstehung einer akademischen Zwei-Klassen-Gesellschaft wird aufgeworfen.
3. Die Gegenstände der Förderung: Das Kapitel beschreibt die drei Säulen der Exzellenzinitiative: die Förderung von Graduiertenschulen, Exzellenzclustern und Zukunftskonzepten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen. Es skizziert die Konkretisierung des Programms und die verschiedenen Förderlinien.
Schlüsselwörter
Exzellenzinitiative, Elite, Chancengleichheit, Hochschulsystem, Deutschland, Leistungselite, Herkunftselite, soziale Selektivität, Wissenschaftsförderung, Wettbewerb.
Häufig gestellte Fragen zur Exzellenzinitiative
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert die deutsche Exzellenzinitiative, beleuchtet deren Entstehungsgeschichte, Ziele und Kritikpunkte. Ein zentraler Fokus liegt auf der Frage nach der Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Elite in Deutschland und den Auswirkungen der Initiative auf die Chancengleichheit im deutschen Hochschulsystem.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte und Ziele der Exzellenzinitiative, die Fördergegenstände und -verfahren, Kritikpunkte bezüglich Chancengleichheit und sozialer Selektivität, die Auswirkungen auf das deutsche Hochschulsystem und den Begriff der Elite und seine gesellschaftliche Relevanz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung mit Definitionsversuch, Entstehungsgeschichte, kritische Fragestellungen, die Fördergegenstände (Graduiertenschulen, Exzellenzcluster, Zukunftskonzepte), den zeitlichen Verlauf mit den Ergebnissen der Ausschreibungsrunden, das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren, eine Auseinandersetzung mit dem Märchen der Chancengleichheit, die Steigerung der sozialen Selektivität, die Elite und ihr Fußvolk und schließlich ein Fazit.
Was wird in der Einleitung besprochen?
Die Einleitung diskutiert kontrovers die Funktion gesellschaftlicher Führungsgruppen und den Begriff der Elite. Sie beleuchtet unterschiedliche Definitionen von Eliten (Leistungselite vs. Herkunftselite) und deren historische und ideologische Konnotationen, insbesondere im Kontext des Nationalsozialismus. Sie kündigt eine kritische Auseinandersetzung mit der Exzellenzinitiative an, die die Frage nach Leistung versus Herkunft im Kontext der Elitebildung untersucht.
Wie wird die Entstehungsgeschichte der Exzellenzinitiative dargestellt?
Dieses Kapitel beschreibt den Ursprung der Initiative im Vorschlag Gerhard Schröders, zehn deutsche Universitäten zu internationalen Spitzenhochschulen auszubauen. Es betont den anfänglichen Fokus auf Leistungswettbewerb und Chancengleichheit, die Finanzierung durch UMTS-Lizenzen und die Beauftragung der DFG und des Wissenschaftsrates. Die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands steht im Vordergrund, wobei der Fokus primär auf Wissenschaft und Forschung, nicht auf Lehre und Ausbildung liegt.
Welche kritischen Fragen werden zur Exzellenzinitiative gestellt?
Es werden Zweifel geäußert, ob die Initiative ihre Ziele erreicht und ob der Grundsatz der Chancengleichheit tatsächlich umgesetzt wird. Zentral ist die Frage nach den Konsequenzen für die soziale Zugänglichkeit des Universitätssystems und die Entstehung einer akademischen Zwei-Klassen-Gesellschaft.
Welche Fördergegenstände werden in der Exzellenzinitiative behandelt?
Die drei Säulen der Exzellenzinitiative – die Förderung von Graduiertenschulen, Exzellenzclustern und Zukunftskonzepten – werden beschrieben. Die Konkretisierung des Programms und die verschiedenen Förderlinien werden skizziert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch die Schlüsselwörter Exzellenzinitiative, Elite, Chancengleichheit, Hochschulsystem, Deutschland, Leistungselite, Herkunftselite, soziale Selektivität, Wissenschaftsförderung und Wettbewerb charakterisiert.
- Quote paper
- Alexander Schneider (Author), 2007, Im Schatten der Elite - Idee, Verlauf sowie Kritik an der Exzellenzinitiative, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118340