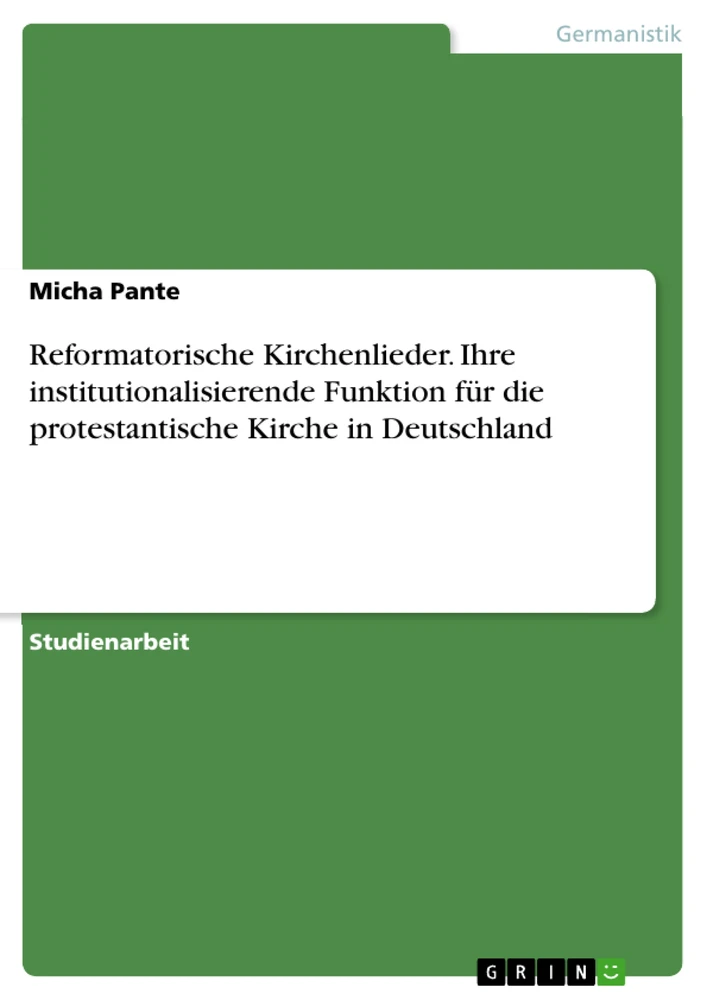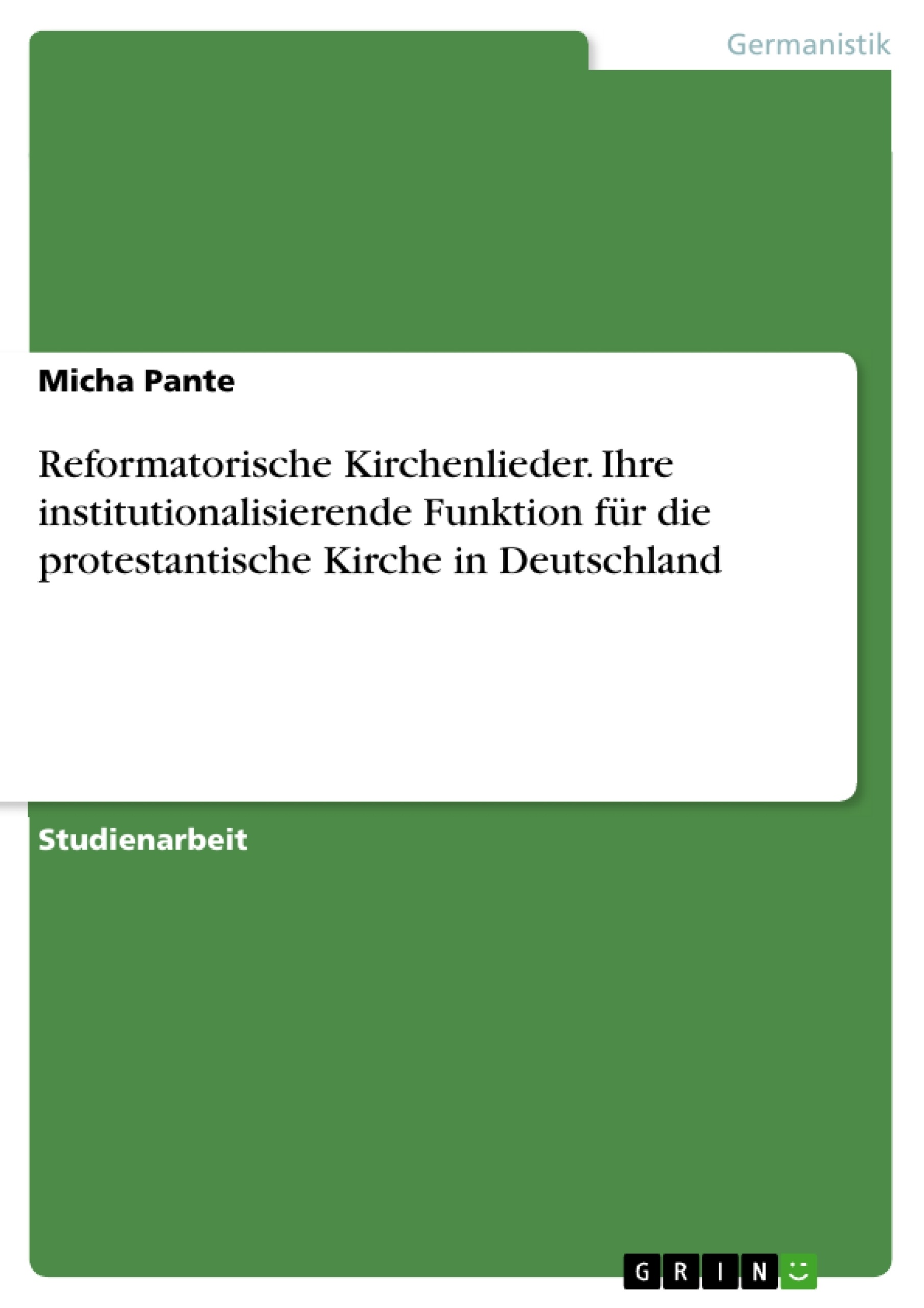Die vorliegende Arbeit nimmt diese Aussage ernst und stellt sich zur Aufgabe, im bescheidenen Sinne die Funktion reformatorischer Kirchenlieder für die Institutionalisierung der neuen, also lutherischen Kirche im 16. Jahrhundert zu untersuchen. Hierfür wird sich an der soziologischen Begriffsdefinition "Institutionalisierung" nach Berger und Luckmann aus Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit orientiert. Der Analyseschwerpunkt liegt auf den Gesangbuchvorreden Luthers, die einen Einblick darin geben, welche Funktion Luther selbst in den Liedern und im Gesang gesehen hat. Es wird hiernach keinesfalls der Anspruch erhoben, den historischen Institutionalisierungsprozess der neuen Kirche zu ergründen. Vielmehr soll untersucht werden, inwiefern sich mithilfe der soziologischen Definition von "Institutionalisierung" die Erkenntnisse der Analyse der Gesangbuchvorreden interpretieren lassen.
Die Forschungsfrage lautet demnach wie folgt: Zeigen sich in den Gesangbuchvorreden Luthers Aspekte, die darauf hinweisen, dass den reformatorischen Liedern im Sinne der Definition nach Berger und Luckmann eine "institutionalisierende" Funktion zukommt? Um sich der Beantwortung dieser Fragestellung zu nähern, soll zunächst ein historischer Überblick über die Entwicklung des reformatorischen Gesangs bzw. über die Relevanz der reformatorischen Lieder illustriert werden. Dieser Überblick soll historisch in die Thematik einführen und die bedeutende Stellung des reformatorischen Liedes hervorheben. In einem nächsten Schritt werden Luthers zentrale reformatorische Einsichten zusammengefasst, um jene Einsichten für die darauffolgende Analyse fruchtbar zu machen. Diese ordnet sich chronologisch nach den Gesangbuchvorreden Luthers – beginnend mit der Vorrede des Wittenberger Gesangbuches von 1524. Im vierten Kapitel wird der Institutionalisierungsbegriff nach Berger und Luckmann herausgearbeitet. Mithilfe dieser Begriffsbestimmung sollen die Ergebnisse der Analyse im fünften Kapitel interpretiert werden. Des Weiteren soll das lutherische Lied Nun freut euch, lieben Christen g’mein exemplarisch behandelt werden. Den Abschluss dieser Arbeit soll ein Fazit bilden, welches die gewonnenen Erkenntnisse resümiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Reformation und ihre Lieder
- 3. Eine Analyse der Gesangbuchvorreden Luthers
- 3.1 Luthers reformatorische Einsichten
- 3.2 Die Vorrede des Wittenberger Gesangbuches
- 3.3 Die Vorrede zu der Sammlung der Begräbnislieder 1542
- 3.4 Vorrhede auff alle gute Gesangbücher: D: M: L:
- 3.5 Die Vorrede zum Babstschen Gesangbuch 1545
- 4. Institutionalisierung
- 5. Die Institution „Kirche“ und die institutionalisierende Funktion der Lieder
- 5.1 Nun freut euch, lieben Christen g'mein
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion reformatorischer Kirchenlieder für die Institutionalisierung der lutherischen Kirche im 16. Jahrhundert. Sie nutzt die soziologische Begriffsdefinition von „Institutionalisierung“ nach Berger und Luckmann als analytisches Werkzeug. Der Fokus liegt auf den Gesangbuchvorreden Luthers, um seine Sicht auf die Rolle von Liedern im Gottesdienst zu verstehen.
- Die Rolle von Kirchenliedern in der Reformation
- Luthers reformatorische Einsichten und ihre Auswirkungen auf den Gesang
- Analyse der Gesangbuchvorreden Luthers als Indikatoren für Institutionalisierung
- Der Wandel des Gottesdienstes durch Gemeindegesang
- Die soziologische Perspektive auf Institutionalisierungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage: Zeigen sich in den Gesangbuchvorreden Luthers Aspekte, die darauf hinweisen, dass den reformatorischen Liedern im Sinne der Definition nach Berger und Luckmann eine „institutionalisierende“ Funktion zukommt? Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der auf der Analyse der Gesangbuchvorreden Luthers basiert und die soziologische Institutionalisierungstheorie von Berger und Luckmann verwendet. Es wird klargestellt, dass nicht der gesamte Institutionalisierungsprozess der Kirche erforscht wird, sondern lediglich die Rolle der Lieder in diesem Prozess im Fokus steht.
2. Die Reformation und ihre Lieder: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel der Kirchenmusik von der einstimmigen, lateinischen Liturgie des gregorianischen Chorals zur einfühlsamen, volkssprachlichen Gemeindemusik der Reformation. Es wird hervorgehoben, wie Luther den Gottesdienst neu gestaltete, indem er die Predigt und den Gemeindegesang zentralisierte und so die Gemeinde aktiv in den Gottesdienst einbezog. Die Verbreitung der Lieder durch den Buchdruck und ihre Nutzung auch außerhalb der Kirche, als Mittel der kommunikativen Gewalt, wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Reformation, Kirchenlieder, Gemeindegesang, Gesangbuchvorreden Luther, Institutionalisierung, Berger und Luckmann, Lutherische Kirche, gregorianischer Choral, Buchdruck.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse reformatorischer Kirchenlieder und ihrer Funktion für die Institutionalisierung der lutherischen Kirche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Funktion reformatorischer Kirchenlieder für die Institutionalisierung der lutherischen Kirche im 16. Jahrhundert. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Gesangbuchvorreden Martin Luthers und der Anwendung der soziologischen Institutionalisierungstheorie von Berger und Luckmann.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Zeigen sich in den Gesangbuchvorreden Luthers Aspekte, die darauf hinweisen, dass den reformatorischen Liedern im Sinne der Definition nach Berger und Luckmann eine „institutionalisierende“ Funktion zukommt?
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse der Gesangbuchvorreden Luthers und verwendet die soziologische Institutionalisierungstheorie von Berger und Luckmann als analytisches Werkzeug. Es wird nicht der gesamte Institutionalisierungsprozess der Kirche erforscht, sondern lediglich die Rolle der Lieder in diesem Prozess.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Reformation und ihre Lieder, Eine Analyse der Gesangbuchvorreden Luthers (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Vorreden), Institutionalisierung, Die Institution „Kirche“ und die institutionalisierende Funktion der Lieder, und Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle von Kirchenliedern in der Reformation, Luthers reformatorische Einsichten und deren Auswirkungen auf den Gesang, die Analyse der Gesangbuchvorreden als Indikatoren für Institutionalisierung, den Wandel des Gottesdienstes durch Gemeindegesang und die soziologische Perspektive auf Institutionalisierungsprozesse.
Welche Rolle spielte der Gemeindegesang in Luthers Reformation?
Luther zentralisierte die Predigt und den Gemeindegesang im Gottesdienst, wodurch die Gemeinde aktiv in den Gottesdienst eingebunden wurde. Der Wandel von der einstimmigen, lateinischen Liturgie des gregorianischen Chorals zur einfühlsamen, volkssprachlichen Gemeindemusik der Reformation wird hervorgehoben.
Wie wurden die Lieder verbreitet?
Die Verbreitung der Lieder erfolgte maßgeblich durch den Buchdruck. Ihre Nutzung erstreckte sich auch über den kirchlichen Rahmen hinaus, wobei sie als Mittel der kommunikativen Gewalt dienten.
Welche Gesangbuchvorreden Luthers werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Gesangbuchvorreden Luthers, darunter die Vorrede des Wittenberger Gesangbuches, die Vorrede zu der Sammlung der Begräbnislieder 1542, „Vorrhede auff alle gute Gesangbücher: D: M: L:“ und die Vorrede zum Babstschen Gesangbuch 1545.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Reformation, Kirchenlieder, Gemeindegesang, Gesangbuchvorreden Luther, Institutionalisierung, Berger und Luckmann, Lutherische Kirche, gregorianischer Choral, Buchdruck.
Welche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel wird gegeben?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die zentralen Argumente und Ergebnisse jedes Kapitels kurz darstellen. Die Einleitung führt in die Thematik und Forschungsfrage ein. Kapitel 2 beschreibt den Wandel der Kirchenmusik. Kapitel 3 analysiert die Gesangbuchvorreden Luthers. Die weiteren Kapitel befassen sich mit Institutionalisierung und dem Fazit.
- Citar trabajo
- M.Ed. Micha Pante (Autor), 2020, Reformatorische Kirchenlieder. Ihre institutionalisierende Funktion für die protestantische Kirche in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1183365