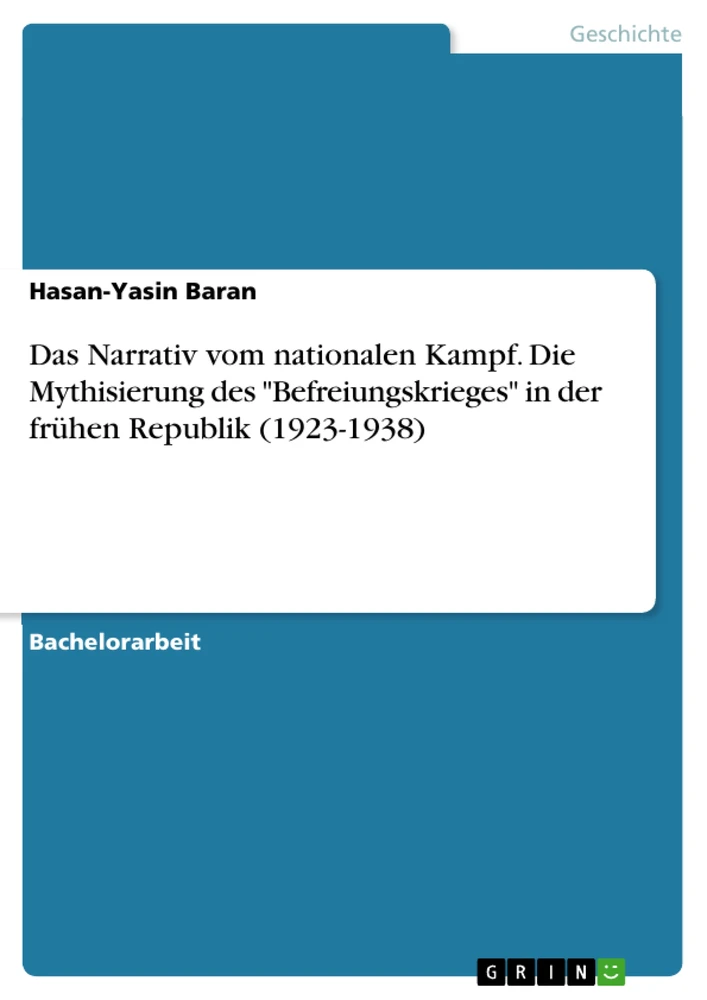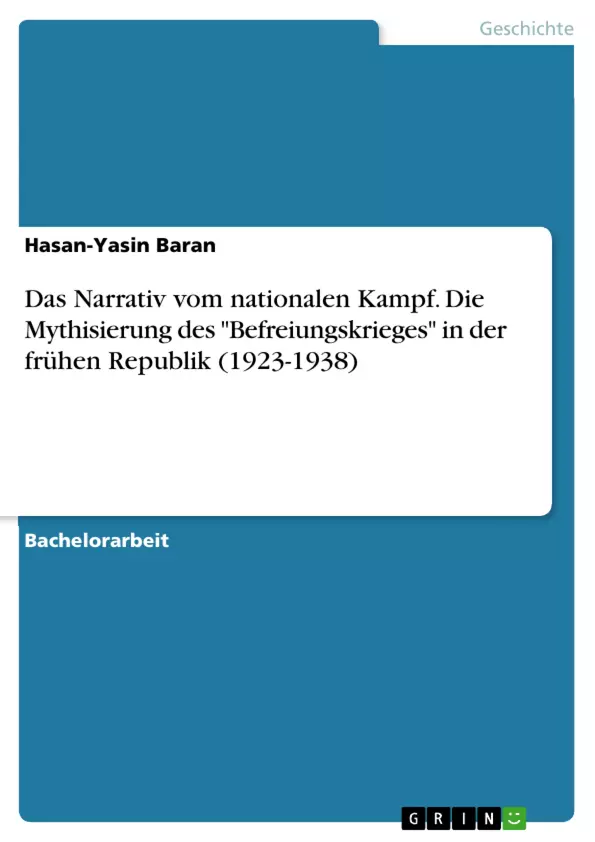Der Krieg zwischen 1919 und 1923 wird innerhalb der türkischen Historiographie als ein nationaler Kampf (Milli Mücadele) gegen die imperialen Mächte idealisiert. Er besitzt einen symbolischen Charakter und hat in der türkischen Gesellschaft einen besonderen Stellenwert. Untersucht man den "Befreiungskrieg" hauptsächlich auf dessen narrative und ikonische Darstellung, so lassen sich Formen eines politischen Mythos wiederfinden, die zumindest im deutschsprachigen Raum nur teilweise untersucht worden sind. Insbesondere im Hinblick auf die Mythenforschung gibt es begrenzte Untersuchungen über den Befreiungskrieg, denn die Mythenforschung im deutschsprachigen Raum beschränkt sich auf den deutschen, innereuropäischen und amerikanischen Mythos. Nur einige wenige Historiker*innen wie Stefan Plaggenborg oder Corry Guttstadt verdeutlichen die mythischen Elemente des Befreiungskrieges und bezeichnen ihn als einen Gründungsmythos.
Dementsprechend widmet sich die vorliegende Arbeit der Frage, welche narrativen Formen für die Mythisierung des Befreiungskrieges genutzt wurden und was für eine Intention die Führungselite der frühen Republik mit dem Narrativ eines Befreiungskrieges oder nationalen Kampfes verfolgte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsstand
- 1.2 Methodik
- 2. Nationalismus und politischer Mythos
- 2.1 Nation und Nationalismus
- 2.2 Formen und Funktion von politischen Mythen
- 3. Der Befreiungskrieg als Gründungsmythos
- 3.1 Die „türkische“ Nationalbewegung
- 3.2 Das kemalistische Narrativ
- 3.3 Die Ritualisierung des Befreiungskrieges
- 4. Künstlerische Aufwertung des Krieges in der frühen Republik
- 4.1 Ratip Tahir Burak: Ergenekon
- 4.2 Zeki Faik İzer: İnkılap Yolunda
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mythisierung des türkischen Befreiungskrieges (1919-1923) in der frühen Republik (1923-1938). Ziel ist es, die narrativen Strategien aufzuzeigen, mit denen die Führungselite ein kollektives Geschichtsbewusstsein schuf und den Krieg als nationalen Gründungsmythos etablierte. Die Arbeit analysiert die Intentionen hinter diesem Narrativ und seine Wirkung auf die Gesellschaft.
- Narrative Strategien der Mythisierung des Befreiungskrieges
- Der Befreiungskrieg als politischer Mythos und seine Funktionen
- Die Rolle des kemalistischen Narrativs in der Geschichtskonstruktion
- Künstlerische Darstellungen des Krieges und ihre Bedeutung
- Ritualisierung des Befreiungskrieges durch Feiertage und Denkmäler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den narrativen Formen der Mythisierung des türkischen Befreiungskrieges und den Intentionen der frühen Republik dar. Sie beleuchtet den Forschungsstand, der sich in der türkischen Geschichtsschreibung hauptsächlich auf den Kriegsverlauf konzentriert, und hebt die Arbeiten von Zürcher und Plaggenborg hervor, die das kemalistische Narrativ kritisch hinterfragen. Die Methodik wird erläutert, mit Fokus auf die Einbeziehung von Theorien zum Nationalismus und politischen Mythen von Hobsbawm, Gellner, Bizeul, Langewiesche, Speth und Rohgalf. Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: die theoretische Ebene, die Analyseebene und ein Fazit.
2. Nationalismus und politischer Mythos: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es erörtert die Konzepte von Nation und Nationalismus und analysiert die Formen und Funktionen politischer Mythen. Die Kapitel erläutert wie historische Ereignisse für politische Zwecke uminterpretiert werden, um ein kollektives Bewusstsein und eine nationale Identität zu schaffen. Das Kapitel dient als methodisches Fundament für die spätere Analyse der Mythisierung des türkischen Befreiungskrieges.
3. Der Befreiungskrieg als Gründungsmythos: Dieses Kapitel analysiert den türkischen Befreiungskrieg als Gründungsmythos. Es untersucht die Widerstandsbewegung der Nationalisten unter Atatürk, die Ritualisierung des Krieges durch Nationalfeiertage und Denkmäler, und das kemalistische Narrativ. Die Arbeit vergleicht die Darstellung des Krieges in Atatürks Reden mit den Memoiren von Rauf Orbay, Kazım Karabekir und Halide Edip-Adıvar, um verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Die Analyse der Nationalfeiertage und der Denkmallandschaft untersucht deren Wirkung auf das kollektive Gedächtnis.
4. Künstlerische Aufwertung des Krieges in der frühen Republik: Dieses Kapitel untersucht die künstlerische Darstellung des Befreiungskrieges, exemplarisch anhand der Gemälde „Ergenekon“ von Ratip Tahir Burak und „İnkılap Yolunda“ von Zeki Faik İzer. Die Analyse fokussiert auf die bildliche Darstellung der kemalistischen Geschichtsschreibung und deren Wirkung auf die Wahrnehmung des Krieges. Die Expertise der Kunsthistorikerin Burcu Dogramaci dient als Grundlage.
Schlüsselwörter
Nationaler Kampf (Milli Mücadele), Befreiungskrieg, Türkei, Kemalistisches Narrativ, Politischer Mythos, Gründungsmythos, Nationalismus, Geschichtskonstruktion, Kollektives Gedächtnis, Narrative Strategien, Ritualisierung, Künstlerische Darstellung, Widerstandsbewegung, Atatürk.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Mythisierung des Türkischen Befreiungskrieges
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Mythisierung des Türkischen Befreiungskrieges (1919-1923) in der frühen Türkischen Republik (1923-1938). Sie analysiert die narrativen Strategien der Führungselite, um ein kollektives Geschichtsbewusstsein zu schaffen und den Krieg als nationalen Gründungsmythos zu etablieren. Die Intentionen hinter diesem Narrativ und seine Wirkung auf die Gesellschaft stehen im Fokus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt die Forschungsfrage, den Forschungsstand und die Methodik. Kapitel 2 (Nationalismus und politischer Mythos) legt die theoretischen Grundlagen dar. Kapitel 3 (Der Befreiungskrieg als Gründungsmythos) analysiert den Krieg als Gründungsmythos, untersucht die Widerstandsbewegung und das kemalistische Narrativ. Kapitel 4 (Künstlerische Aufwertung des Krieges in der frühen Republik) analysiert künstlerische Darstellungen des Krieges. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Theorien werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien zum Nationalismus und politischen Mythen von Autoren wie Hobsbawm, Gellner, Bizeul, Langewiesche, Speth und Rohgalf. Diese Theorien dienen als methodische Grundlage für die Analyse der Mythisierung des Befreiungskrieges.
Welche Quellen werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf Atatürks Reden, die Memoiren von Rauf Orbay, Kazım Karabekir und Halide Edip-Adıvar, sowie die Gemälde „Ergenekon“ von Ratip Tahir Burak und „İnkılap Yolunda“ von Zeki Faik İzer. Die Expertise der Kunsthistorikerin Burcu Dogramaci wird ebenfalls berücksichtigt. Der Forschungsstand in der türkischen Geschichtsschreibung, insbesondere die Arbeiten von Zürcher und Plaggenborg, wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselfragen werden in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit zielt darauf ab, die narrativen Strategien der Mythisierung des Befreiungskrieges aufzuzeigen, die Rolle des kemalistischen Narrativs in der Geschichtskonstruktion zu analysieren und die Wirkung künstlerischer Darstellungen und der Ritualisierung des Krieges auf das kollektive Gedächtnis zu untersuchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nationaler Kampf (Milli Mücadele), Befreiungskrieg, Türkei, Kemalistisches Narrativ, Politischer Mythos, Gründungsmythos, Nationalismus, Geschichtskonstruktion, Kollektives Gedächtnis, Narrative Strategien, Ritualisierung, Künstlerische Darstellung, Widerstandsbewegung, Atatürk.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit der türkischen Geschichte, dem Nationalismus, der Geschichtskonstruktion und der politischen Mythenbildung auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Hasan-Yasin Baran (Autor:in), 2021, Das Narrativ vom nationalen Kampf. Die Mythisierung des "Befreiungskrieges" in der frühen Republik (1923-1938), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1183145