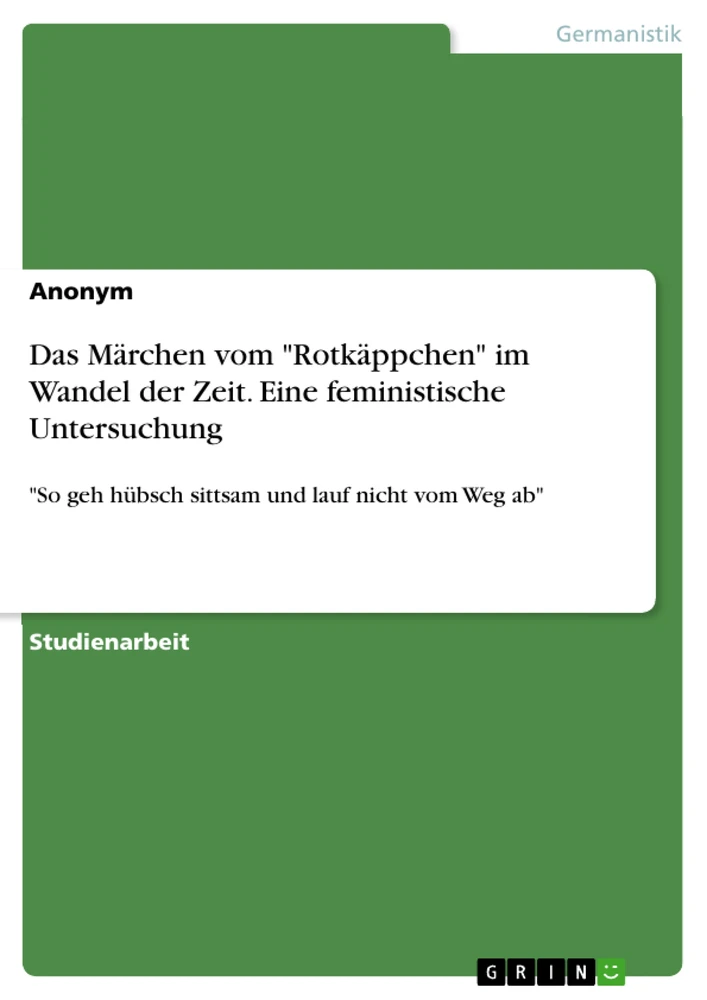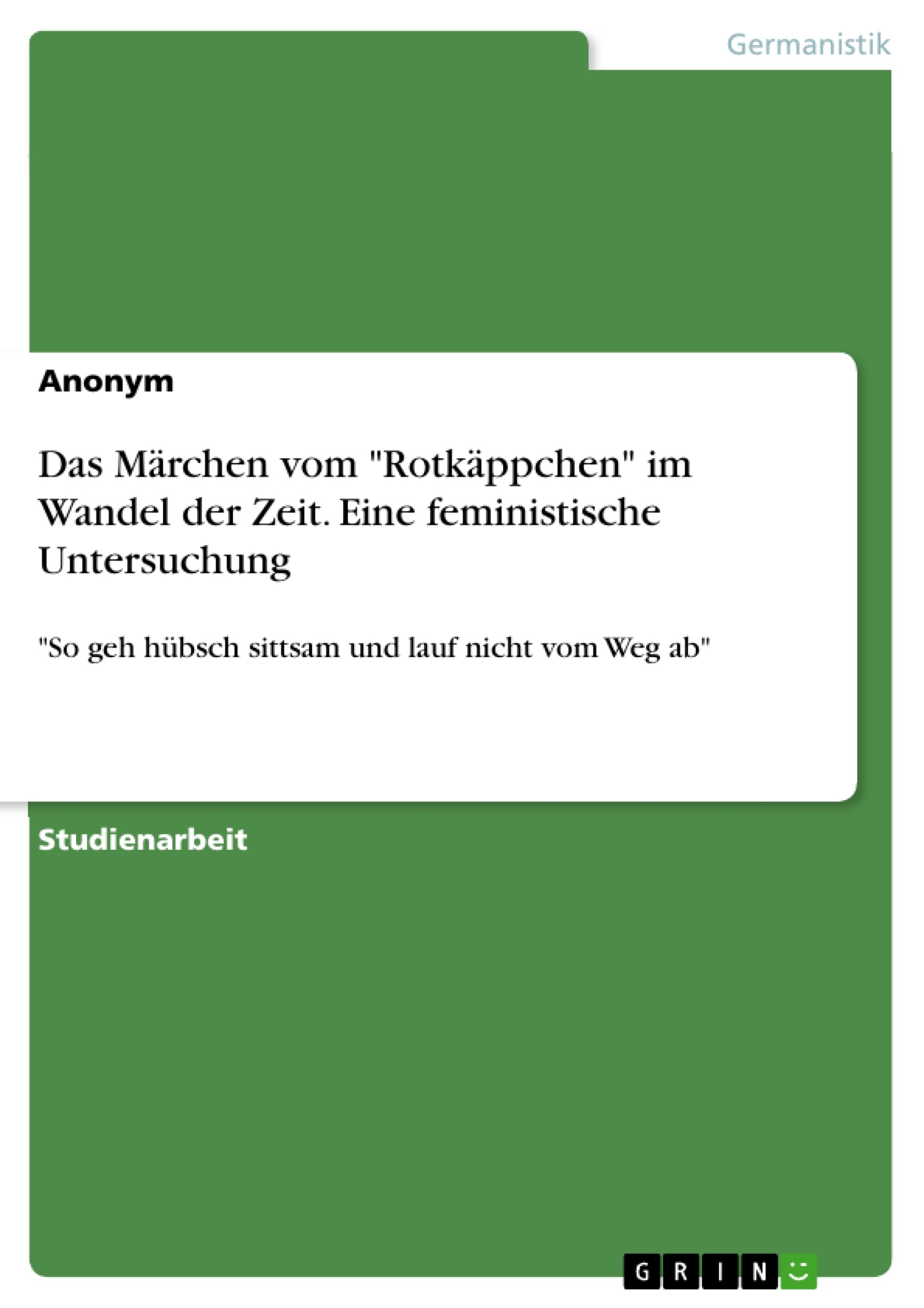Die Geschichte von Rotkäppchen wurde im Laufe der Jahrhunderte von unzähligen Autoren bearbeitet und variiert. Entgegen seiner Popularität stellt die Version der Gebrüder Grimm dabei weder die erste noch die letzte Adaption des Stoffes dar, sondern greift auf frühere Bearbeitungen zurück und hat gleichfalls das Feld für neue Bearbeitungen eröffnet. Da Märchen immer einen Spiegel der Gesellschaft darstellen in der sie entstanden sind und die herrschenden Gesetze, Werte und Normen abbilden, kann die vergleichende Analyse von Märchenversionen Aufschlüsse über Veränderungen und Entwicklungen im sozialen System.
In der vorliegenden Arbeit sollen die frühe Rotkäppchenversion "Die Geschichte von der Großmutter", deren Erzählerkern vermutlich bis in das 16. Jahrhundert zurückreicht, "Le petit chaperon rouge" von Charles Perrault (1697) und "Rotkäppchen" der Gebrüder Grimm (1812/15) näher beleuchtet und herausgestellt werden, welche Intentionen die Märchen mit demselben Stoff aber unterschiedlichen Ausarbeitungen verfolgen.
Besonderes Augenmerk soll auf Rotkäppchens Weg vom cleveren kleinen Mädchen, das sich selbstständig vor dem Wolf retten konnte, zum naiven Geschöpf, das von einer männlichen Autoritätsperson gerettet werden muss liegen, um die Stellung der Frau in der Gesellschaft und die Beziehung von männlicher und weiblicher Macht nachzuverfolgen. In diesem Zusammenhang soll auch der zunehmende Verlust des offenen Umgangs mit weiblicher Sexualität näher betrachtet werden, der bei den Grimms in der beinahe vollständigen Eliminierung aller erotischen Konnotationen gipfelt. Es soll herausgestellt werden, inwiefern diese Ausmerzung einerseits die Schamgrenzen der jeweiligen historischen Gesellschaft absteckt und andererseits dazu beiträgt, das männlich-weibliche Machtgefälle in der patriarchalen Gesellschaft zu festigen.
Abschließend soll anhand von Otto F. Gmelins "Rotkäppchen" gezeigt werden, wie moderne Versionen dem Mädchen seine Selbstständigkeit zurückgeben, indem es den Wolf alleine besiegt, und damit gewissermaßen den Bogen zurück zu den Anfängen der Überlieferungsgeschichte von "Rotkäppchen" schlagen, die noch die Eigenständigkeit und Cleverness des Mädchens zelebriert haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rotkäppchens Anfang - „Die Geschichte von der Großmutter“
- 2.1. Von Nähnadeln und Stecknadeln - Der Weg zur jungen Frau
- 2.2. „Zieh dich aus, mein Kind“ – offener Umgang mit Sexualität
- 2.3. Selbst ist die Frau - Wie das Mädchen sich selbst rettet
- 3. Ein Kavalier im Wolfspelz – „Le petit chaperon rouge“ von Charles Perrault
- 3.1. „viens te coucher avec moi“ – Erotische (Ver)lockung
- 3.2. Die Moral von der Geschicht'
- 3.3. Le petit chaperon rouge - so nannte man es Rotkäppchen
- 4. Naives Geschöpf – Das „Rotkäppchen“ der Gebrüder Grimm
- 4.1. „Ich will schon alles gut machen“ – Verhaltensmaßregeln
- 4.2. „sieh einmal die schönen Blumen“ - Verführt vom Wolf
- 4.3. Prüderie des Biedermeier – Streichung erotischer Elemente
- 4.4. Rettung durch den männlichen Jäger
- 4.5. Selbsterkenntnis statt Moral
- 4.6. „Es wird auch erzählt“ –Das zweite Ende
- 5. Moderne Versionen – Rotkäppchens Weg zurück zur Selbstständigkeit
- 5.1. Otto F. Gmelin - „Es war einmal ein furchtloses Mädchen“
- 6. Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Märchens „Rotkäppchen“ über verschiedene Versionen hinweg, von der frühen Fassung „Die Geschichte von der Großmutter“ bis zu modernen Adaptionen. Das Hauptziel ist es, die Veränderungen in der Darstellung von Rotkäppchen als selbstständiges Mädchen zu einem naiven Geschöpf zu analysieren und die damit verbundenen gesellschaftlichen und geschlechtsspezifischen Implikationen aufzuzeigen.
- Die Entwicklung der weiblichen Selbstständigkeit und Cleverness in verschiedenen Versionen.
- Der Wandel im Umgang mit weiblicher Sexualität und Nacktheit.
- Die Darstellung von Machtverhältnissen zwischen Mann und Frau.
- Der Einfluss gesellschaftlicher Normen und Moralvorstellungen auf die Märcheninterpretation.
- Die Rückgewinnung der weiblichen Selbstbestimmung in modernen Adaptionen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die Bedeutung von Märchen als Spiegel der Gesellschaft und die Notwendigkeit, verschiedene Versionen von Rotkäppchen zu vergleichen, um gesellschaftliche Veränderungen zu untersuchen. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Darstellung Rotkäppchens und der implizierten Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern. Die Arbeit analysiert die frühen Versionen, Perraults Adaption und die Version der Gebrüder Grimm, um schließlich moderne Interpretationen zu betrachten, die Rotkäppchen ihre Selbstständigkeit zurückgeben.
2. Rotkäppchens Anfang – „Die Geschichte von der Großmutter“: Diese frühe Version zeigt Rotkäppchen als ein cleveres und selbstständiges Mädchen, das sich ohne männliche Hilfe vor dem Wolf retten kann. Die Wahl des Weges symbolisiert den Übergang zur weiblichen Reife und Sexualität. Das Essen des Großmutterfleisches wird als symbolischer Akt der Übernahme der Rolle der erwachsenen Frau interpretiert. Der offene Umgang mit Sexualität und Nacktheit steht im Gegensatz zu späteren Versionen.
3. Ein Kavalier im Wolfspelz – „Le petit chaperon rouge“ von Charles Perrault: Perraults Version verleiht der Geschichte eine moralische Dimension, indem Rotkäppchen für ihre Ungehorsamkeit bestraft wird. Die erotischen Elemente sind stärker ausgeprägt als in den späteren Versionen der Gebrüder Grimm, was auf einen offeneren Umgang mit weiblicher Sexualität in der damaligen Zeit hindeutet. Die Geschichte dient als Warnung vor den Gefahren der weiblichen Sexualität. Die Interpretation von Rotkäppchens Verhalten unterscheidet sich deutlich von der im 16. Jahrhundert.
4. Naives Geschöpf – Das „Rotkäppchen“ der Gebrüder Grimm: Die Version der Gebrüder Grimm präsentiert Rotkäppchen als ein naives und gehorsames Mädchen, das vom Wolf verführt und gerettet werden muss. Die erotischen Elemente wurden entfernt, was die veränderten gesellschaftlichen Normen und die zunehmende Prüderie der Biedermeierzeit widerspiegelt. Die Rettung durch den Jäger unterstreicht die Abhängigkeit der Frau vom Mann. Der Verlust der weiblichen Selbstständigkeit wird deutlich.
5. Moderne Versionen – Rotkäppchens Weg zurück zur Selbstständigkeit: Moderne Versionen geben Rotkäppchen ihre Selbstständigkeit und Cleverness zurück. Sie zeigen das Mädchen als starkes und unabhängiges Individuum, das den Wolf alleine besiegt. Dies symbolisiert eine Rückbesinnung auf die frühen Versionen des Märchens und eine Abkehr von der passiven Darstellung der Frau in den Versionen der Gebrüder Grimm.
Schlüsselwörter
Rotkäppchen, Märchenanalyse, feministische Literaturwissenschaft, Geschlechterrollen, Machtverhältnisse, Sexualität, Selbstständigkeit, Moral, Gesellschaftliche Normen, Charles Perrault, Gebrüder Grimm, Moderne Adaptionen.
Häufig gestellte Fragen zu „Rotkäppchen: Eine Märchenanalyse“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Entwicklung des Märchens „Rotkäppchen“ über verschiedene Versionen hinweg. Sie untersucht die Veränderungen in der Darstellung Rotkäppchens, von einem selbstständigen Mädchen zu einem naiven Geschöpf, und die damit verbundenen gesellschaftlichen und geschlechtsspezifischen Implikationen.
Welche Versionen von „Rotkäppchen“ werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Versionen, beginnend mit der frühen Fassung „Die Geschichte von der Großmutter“, über Charles Perraults „Le petit chaperon rouge“ und die Version der Gebrüder Grimm bis hin zu modernen Adaptionen. Der Vergleich dieser Versionen ermöglicht es, den Wandel der Darstellung Rotkäppchens und der implizierten Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern aufzuzeigen.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Entwicklung der weiblichen Selbstständigkeit und Cleverness, der Wandel im Umgang mit weiblicher Sexualität und Nacktheit, die Darstellung von Machtverhältnissen zwischen Mann und Frau, der Einfluss gesellschaftlicher Normen und Moralvorstellungen auf die Märcheninterpretation und die Rückgewinnung der weiblichen Selbstbestimmung in modernen Adaptionen.
Wie wird Rotkäppchen in den verschiedenen Versionen dargestellt?
In der frühesten Version ist Rotkäppchen ein cleveres und selbstständiges Mädchen. In Perraults Version erhält die Geschichte eine moralische Dimension, und Rotkäppchen wird für Ungehorsam bestraft. Die Gebrüder Grimm zeigen Rotkäppchen als naiv und gehorsam, abhängig von männlicher Rettung. Moderne Versionen stellen Rotkäppchen wieder als starkes und unabhängiges Individuum dar.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt, wie die Darstellung von Rotkäppchen die gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen ihrer Entstehungszeit widerspiegelt. Der Wandel in der Darstellung des Mädchens illustriert die Veränderungen im Verständnis von weiblicher Sexualität, Selbstständigkeit und den Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rotkäppchen, Märchenanalyse, feministische Literaturwissenschaft, Geschlechterrollen, Machtverhältnisse, Sexualität, Selbstständigkeit, Moral, Gesellschaftliche Normen, Charles Perrault, Gebrüder Grimm, Moderne Adaptionen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die die Einleitung, die Analyse der einzelnen Versionen (die frühe Version, Perraults Version, die Version der Gebrüder Grimm und moderne Adaptionen) und eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie ein Fazit umfassen. Jedes Kapitel befasst sich eingehend mit den spezifischen Aspekten der jeweiligen Version von Rotkäppchen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für Märchenanalyse, feministische Literaturwissenschaft und die geschlechtsspezifische Darstellung in der Literatur interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Germanistik, Literaturwissenschaft und Gender Studies.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Das Märchen vom "Rotkäppchen" im Wandel der Zeit. Eine feministische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1183049