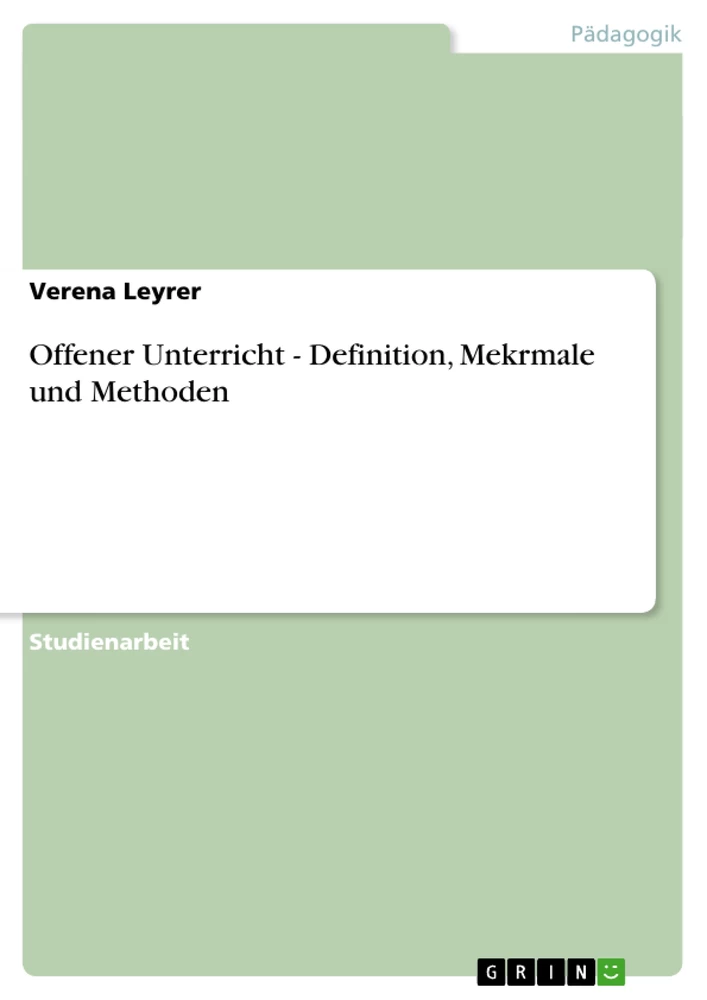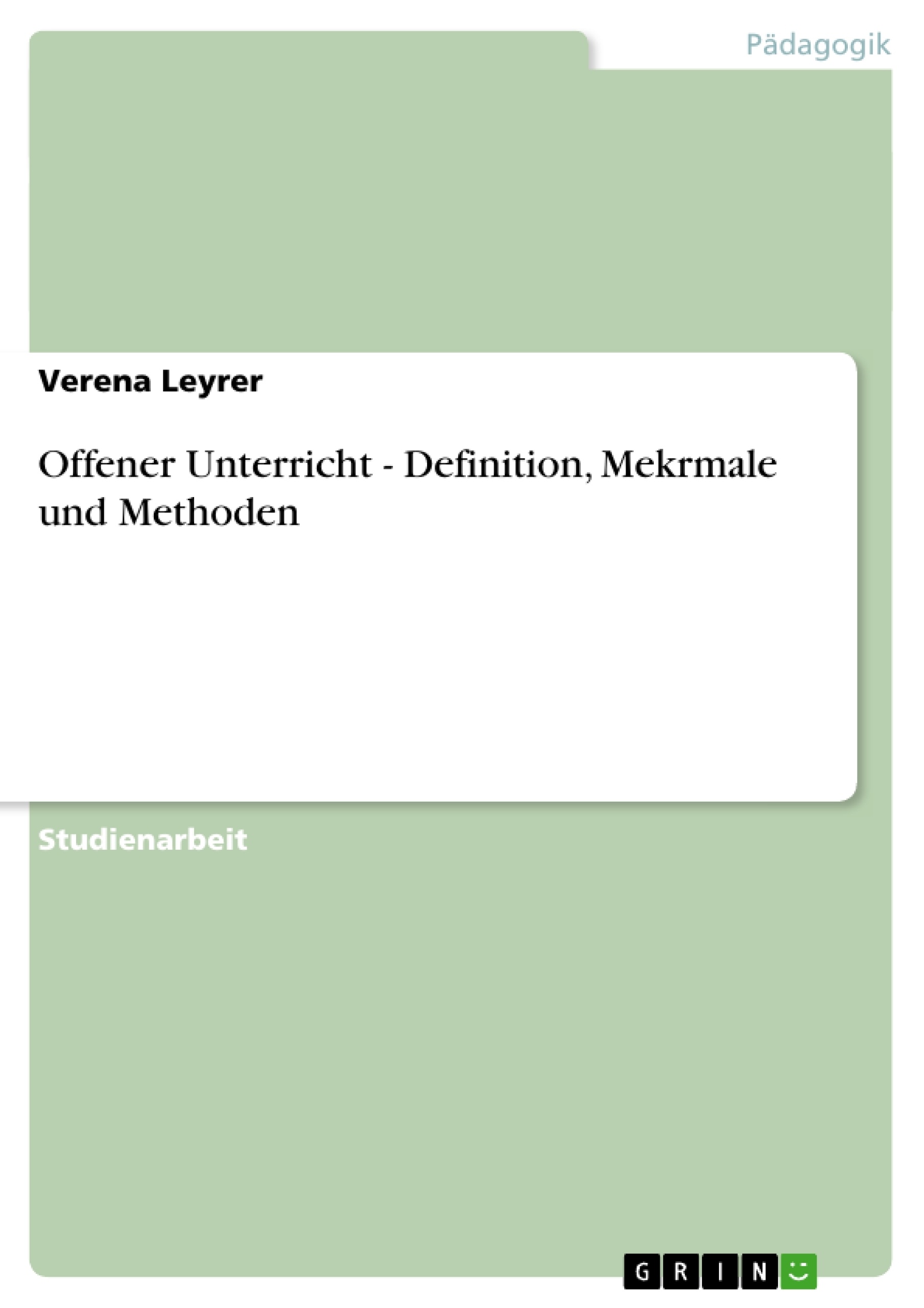Eine Diskussion über die Öffnung von Schule und Unterricht existiert schon seit nunmehr 20
Jahren. Kaum ein anderes pädagogisches Thema hat so viel Aufregungen und
bildungspolitische Diskussionen geliefert wie der offene Unterricht. Was „in den 70er Jahren
als Gegenbewegung gegen starre Lehrpläne, strenge Außenkontrolle, einseitige
Wissenschaftsorientierung und lehrerzentrierten Unterricht begann“ (vgl. Ramseger 1977),
liegt heute als Hauptthema der Reformdiskussion zu Grunde. Die Frage ist, warum jetzt und
nicht schon vor 20 Jahren? Ist doch die Öffnung des Unterrichts im deutschen Bildungswesen
nur eine längst überfällige, nachgeholte pädagogische Reform des Schulsystems. Was sich
zunächst nur auf Reformen in der Grundschule beschränkte, hat sich inzwischen auf die
Sekundarstufe ausgeweitet (vgl. Sehrbrock 1993, Jürgens 1994). Die Diskussionen über die
Veränderung der Methoden, der Inhalte und Institutionen werden seit den 70er Jahren unter
verschiedenen Überschriften geführt. Durchgesetzt haben sich vor allem die Begriffe: Freie
Arbeit, Projektunterricht, Offener Unterricht. Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser
Reformkonzepte sind jedoch systematisch nur schwer zu erfassen.
Typisch für diese Reformen ist eine Verständigung anhand konkreter Beobachtungen und
Erfahrungen in der Schule selbst. Lehrerinnen und Lehrer stehen der herkömmlichen Schule
kritisch gegenüber und suchen nach konkreten Veränderungsmöglichkeiten der
Schulsituation. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wird allerdings ein nur sehr
langsamer Abschied von der Tradition der Gleichzeitigkeit und Gleichartigkeit des Lernens
deutlich. So ist die Geschichte des offenen Unterrichts untrennbar mit der inneren
Grundschulreform seit den 70er Jahren verbunden. Die Ansichten über diese Unterrichtsform
sind vielfältig. Sie reichen von der totalen Überhöhung über die Definition einer praktisch
geworden Erziehungsphilosophie, einer vorübergehenden unterrichtstechnischen Modewelle
oder einer pädagogisch-anthropologischen Grundhaltung der Lehrenden, bis hin zur
gänzlichen Ablehnung.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Offener Unterricht
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2 Historische Entwicklung
- 2.3 Rahmenbedingungen für den offenen Unterricht
- 2.3.1 Administrative Vorgaben
- 2.3.2 Raumstrukturen
- 2.3.3 Zeitstrukturen
- 2.3.4 Elterninformation und Mitarbeit
- 2.3.5 Lehrer-Schüler Verhältnis
- 2.3.6 Kooperation innerhalb des Kollegiums
- 2.4 Merkmale und Methoden des offenen Unterrichts
- 2.5 Gründe für den offenen Unterricht
- 2.6 Kritik
- 3. Freiarbeit
- 3.1 Begriffsdefinition/Grundgedanke
- 3.2 Gründe und Ziele der Freiarbeit
- 3.3 Formen der Freiarbeit
- 3.3.1 Der Wochenplan
- 3.3.2 Die Lernstraße
- 3.3.3 Der Lernladen
- 3.4 Besonderheiten der Freiarbeit
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den offenen Unterricht, seine historische Entwicklung, seine verschiedenen Ausprägungen und seine Bedeutung im Kontext der Reformpädagogik. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen des offenen Unterrichts im Vergleich zum traditionellen Frontalunterricht.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung des offenen Unterrichts
- Historische Entwicklung und Einflüsse auf den offenen Unterricht
- Rahmenbedingungen und Herausforderungen für die Umsetzung des offenen Unterrichts
- Methoden und Merkmale des offenen Unterrichts im Vergleich zum Frontalunterricht
- Freiarbeit als zentrale Methode des offenen Unterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des offenen Unterrichts ein und verdeutlicht die Bedeutung dieser pädagogischen Diskussion im Kontext der deutschen Bildungslandschaft. Sie hebt die Kontroversen hervor und stellt die Frage nach der Aktualität dieser Reformpädagogik im Vergleich zu früheren Ansätzen.
2. Offener Unterricht: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des offenen Unterrichts. Es beginnt mit einer Begriffsbestimmung, die die Vielschichtigkeit und die fehlende eindeutige Definition herausstellt. Die historische Entwicklung wird im Kontext der Reformpädagogik und den gesellschaftlichen Veränderungen beleuchtet, insbesondere der Reaktion auf den Sputnik-Schock und die Kritik am traditionellen Frontalunterricht. Abschließend werden die Rahmenbedingungen, wie administrative Vorgaben, Raumstrukturen, und das Lehrer-Schüler-Verhältnis, eingehend untersucht. Das Kapitel zeigt die Herausforderungen und den Gegensatz zum lehrerzentrierten Unterricht auf.
3. Freiarbeit: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Freiarbeit als Kernmethode des offenen Unterrichts. Es werden die grundlegenden Gedanken und Ziele, verschiedene Formen wie Wochenplan, Lernstraße und Lernladen, sowie die Besonderheiten dieser Methode detailliert erläutert. Die Freiarbeit wird als Prozess der zunehmenden Selbständigkeit und Selbstbestimmung des Schülers vorgestellt, der im Gegensatz zum traditionellen Unterricht steht.
Schlüsselwörter
Offener Unterricht, Freiarbeit, Reformpädagogik, Frontalunterricht, Schülerorientierung, Lehrerzentrierung, Rahmenbedingungen, methodisch-didaktische Modelle, individuelle Förderung, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen zum offenen Unterricht
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den offenen Unterricht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Erläuterung des offenen Unterrichts, seiner Geschichte, Methoden (insbesondere Freiarbeit) und Herausforderungen im Vergleich zum traditionellen Frontalunterricht.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen sind der offene Unterricht, seine historische Entwicklung im Kontext der Reformpädagogik, seine verschiedenen Ausprägungen und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Freiarbeit als zentrale Methode des offenen Unterrichts, einschließlich verschiedener Formen wie Wochenplan, Lernstraße und Lernladen.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum offenen Unterricht (inkl. Begriffsbestimmung, historischer Entwicklung, Rahmenbedingungen und Kritik), ein Kapitel zur Freiarbeit (inkl. Definition, Ziele und Formen) und ein Resümee. Zusätzlich enthält es eine detaillierte Zielsetzung, Zusammenfassungen der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was wird unter „offenem Unterricht“ verstanden?
Der offene Unterricht wird im Dokument als ein pädagogisches Konzept beschrieben, das im Gegensatz zum traditionellen Frontalunterricht steht. Es zeichnet sich durch Schülerorientierung, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Lernenden aus. Eine eindeutige Definition wird als schwierig dargestellt, da der offene Unterricht vielfältige Ausprägungen hat.
Welche Rolle spielt die Freiarbeit im offenen Unterricht?
Freiarbeit wird als zentrale Methode des offenen Unterrichts dargestellt. Das Dokument beschreibt verschiedene Formen der Freiarbeit, wie Wochenpläne, Lernstraßen und Lernläden, und erläutert ihre Bedeutung für die Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Schüler.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit dem offenen Unterricht angesprochen?
Das Dokument beleuchtet verschiedene Herausforderungen, die mit der Umsetzung des offenen Unterrichts verbunden sind. Dies beinhaltet administrative Vorgaben, die Gestaltung der Raumstrukturen und Zeitstrukturen, die Elterninformation und -mitarbeit, das Lehrer-Schüler-Verhältnis sowie die Kooperation innerhalb des Kollegiums.
Wie wird der offene Unterricht im Vergleich zum Frontalunterricht dargestellt?
Der offene Unterricht wird als Gegenmodell zum lehrerzentrierten Frontalunterricht präsentiert. Der Fokus liegt auf der Schülerorientierung, der individuellen Förderung und der Selbstständigkeit der Lernenden im Gegensatz zum lehrergesteuerten Unterricht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Offener Unterricht, Freiarbeit, Reformpädagogik, Frontalunterricht, Schülerorientierung, Lehrerzentrierung, Rahmenbedingungen, methodisch-didaktische Modelle, individuelle Förderung, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung.
Welche historischen Einflüsse werden auf den offenen Unterricht genannt?
Die historische Entwicklung des offenen Unterrichts wird im Kontext der Reformpädagogik und gesellschaftlicher Veränderungen beleuchtet. Es wird beispielsweise auf den Sputnik-Schock und die Kritik am traditionellen Frontalunterricht eingegangen.
- Quote paper
- Verena Leyrer (Author), 2007, Offener Unterricht - Definition, Mekrmale und Methoden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118265