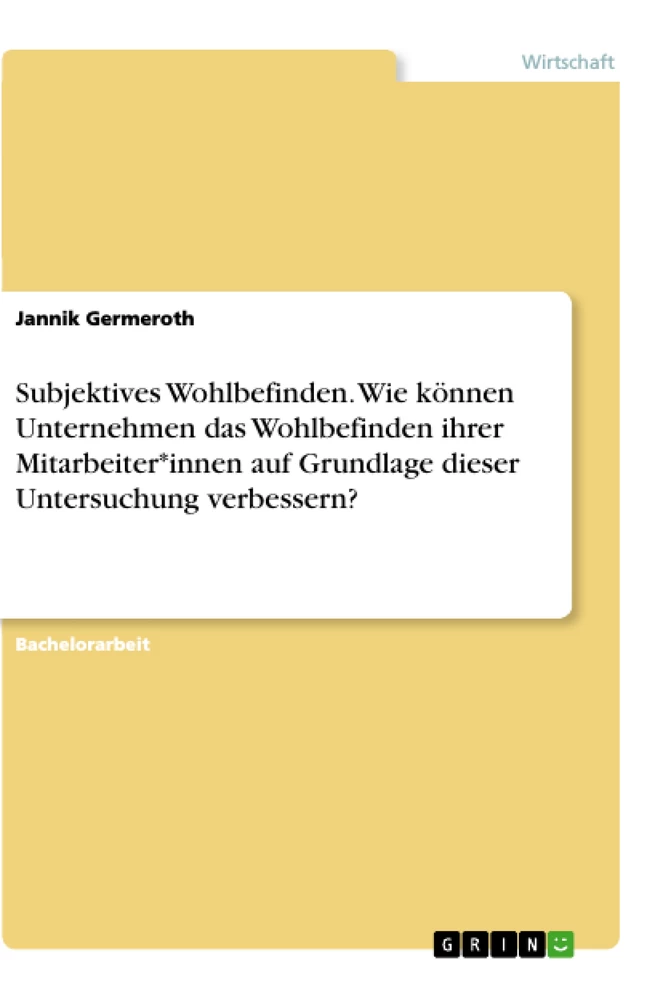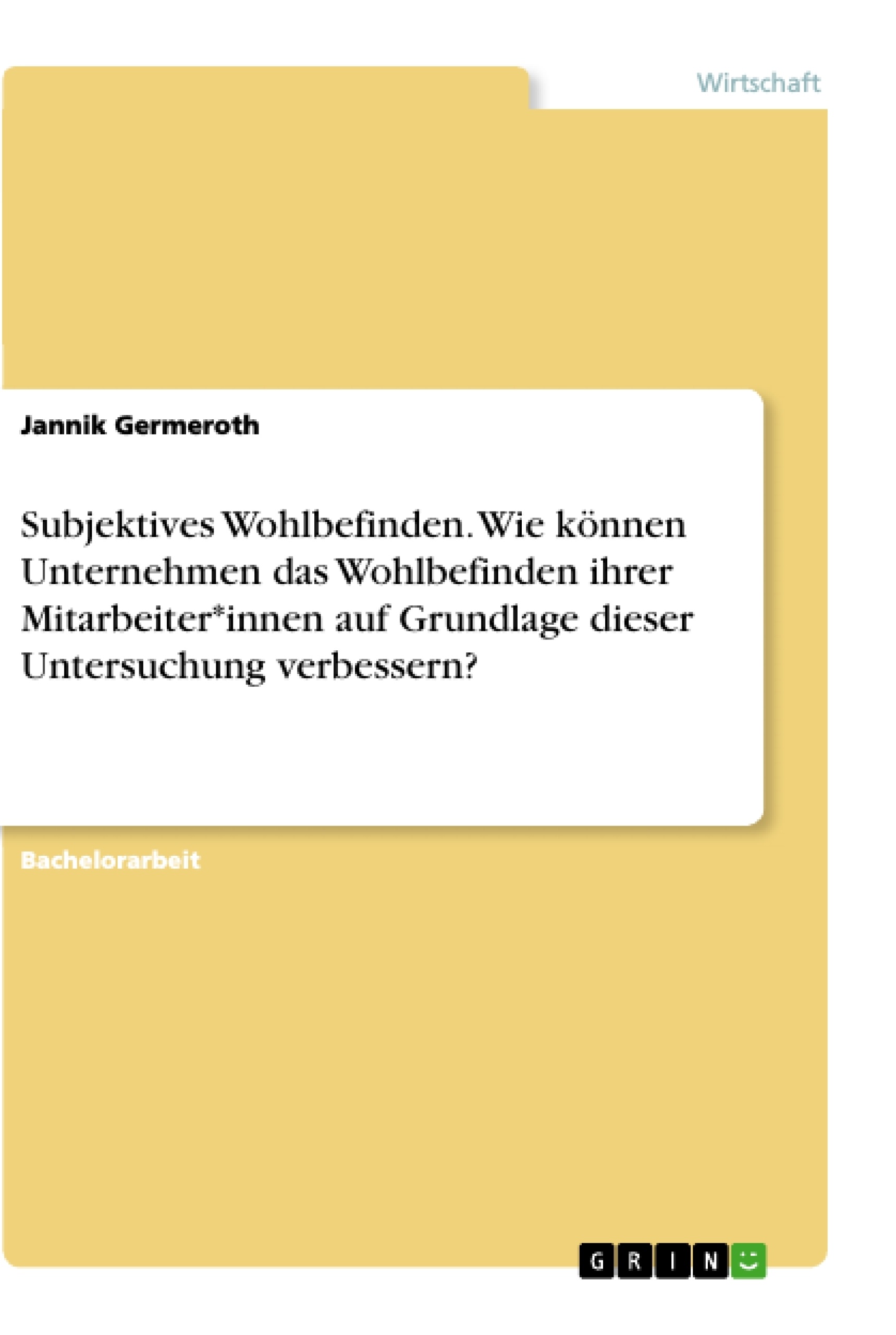Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem persönlichen "Glück" der Menschen, welches in dieser Arbeit als "subjektives Wohlbefinden" (SWB) bezeichnet wird. Die Termini "Glück" und "subjektives Wohlbefinden" beziehen sich hierbei stets auf das persönliche Glück einer Person. Das SWB einer Person hat viele Facetten und kann vielfältig definiert werden. Eine mögliche Definition des SWB umfasst die Zufriedenheit einer Person mit dem eigenen Leben sowie positiv und negativ wahrgenommene Stimmungen. Sämtliche Aktivitäten einer Person sind im Grunde genommen auf das Streben nach dem persönlichen Glück ausgerichtet. Der Mensch unternimmt Dinge kurz- oder langfristig, weil er sich daraus einen bestimmten Vorteil erhofft. Die Konzepte und Ansichten der Glücksforscher darüber, wie das SWB definiert wird und was das SWB ausmacht, werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch tiefgehender analysiert. Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet "welche Faktoren beeinflussen das subjektive Wohlbefinden einer Person und wie können Unternehmen das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter*innen auf Grundlage dieser Untersuchung verbessern?".
Das Ziel dieser Arbeit ist es, aus dem Material der qualitativen Interviews heraus Erkenntnisse über das SWB der Interviewteilnehmer*innen zu gewinnen. Des Weiteren soll mit dieser empirischen Untersuchung die Frage beantwortet werden, wie Unternehmen das SWB ihrer Mitarbeiter*innen auf Basis dieser empirischen Untersuchung verbessern können. Des Weiteren dient diese Arbeit als Grundlage für weiterführende Untersuchungen der Glücksforschung, um hieraus weitere Erkenntnisse über das SWB einer Person zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen der Glücksforschung
- 2.1 Theoretische Grundlagen von subjektivem Wohlbefinden
- 2.1.1 Erläuterung von subjektivem Wohlbefinden aus neurobiologischer Perspektive
- 2.1.2 Erläuterung von subjektivem Wohlbefinden aus psychologischer Perspektive
- 2.1.3 Erläuterung von subjektivem Wohlbefinden aus ökonomischer Perspektive
- 2.2 Theoretische Grundlagen der Messung von subjektivem Wohlbefinden
- 2.2.1 Vorstellung ausgewählter Single-Item-Messverfahren zur Messung des subjektiven Wohlbefindens
- 2.2.2 Vorstellung ausgewählter Multi-Item-Messverfahren zur Messung des subjektiven Wohlbefindens
- 2.2.3 Vorstellung von erweiterten Verfahren der Messung des subjektiven Wohlbefindens
- 2.3 Vorstellung ausgewählter Determinanten von subjektivem Wohlbefinden
- 2.3.1 Vorstellung ausgewählter ökonomischer Determinanten von subjektivem Wohlbefinden
- 2.3.2 Vorstellung ausgewählter biologischer-/ psychologischer Determinanten von subjektivem Wohlbefinden
- 2.3.3 Vorstellung ausgewählter soziodemografischer Determinanten von subjektivem Wohlbefinden
- 3. Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Messung des subjektiven Wohlbefindens
- 3.1 Gang der Untersuchung
- 3.1.1 Aufbau und Konzeption der Untersuchung
- 3.1.2 Vorstellung der Vorgehensweise der durchgeführten Untersuchung
- 3.2 Entwicklung eines empirischen Konzepts zur Messung von subjektivem Wohlbefinden
- 3.2.1 Vorstellung des Interviewleitfadens
- 3.2.2 Vorstellung der befragten Zielgruppe der Untersuchung
- 3.3 Ergebnisauswertung der durchgeführten empirischen Untersuchung
- 3.3.1 Vorstellung der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse
- 3.3.2 Auswertung und Ergebnisvorstellung der durchgeführten inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse
- 4. Kritische Würdigung und Ableitung von Handlungsempfehlungen
- 4.1 Kritische Würdigung der theoretischen Grundlagen der Messung von subjektivem Wohlbefinden
- 4.1.1 Übergreifende kritische Würdigung der Glücksforschungsmethoden
- 4.1.2 Kritische Würdigung von ausgewählten Single- und Multi-Item-Messverfahren
- 4.2 Kritische Würdigung der durchgeführten empirischen Untersuchung
- 4.2.1 Kritische Würdigung der durchgeführten empirischen Untersuchung mithilfe von qualitativen Interviews
- 4.2.2 Limitationen der durchgeführten empirischen Untersuchung
- 4.3 Ableitung von Handlungsempfehlungen auf Grundlage der durchgeführten empirischen Untersuchung
- 4.3.1 Ergebnisinterpretation der durchgeführten empirischen Untersuchung
- 4.3.2 Steigerung des subjektiven Wohlbefindens auf Grundlage der Implikationen der durchgeführten empirischen Untersuchung
- 4.3.3 Handlungsempfehlungen für Unternehmen vor dem Hintergrund der durchgeführten empirischen Untersuchung
- 5. Fazit
- Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen von subjektivem Wohlbefinden aus neurobiologischer, psychologischer und ökonomischer Perspektive.
- Sie untersucht verschiedene Messverfahren für subjektives Wohlbefinden, sowohl Single-Item- als auch Multi-Item-Verfahren.
- Die Arbeit identifiziert und analysiert wichtige Determinanten von subjektivem Wohlbefinden, darunter ökonomische, biologische/psychologische und soziodemografische Faktoren.
- Eine empirische Untersuchung mithilfe von qualitativen Interviews wird durchgeführt, um Erkenntnisse über die subjektiven Wohlbefindensfaktoren von Personen in realen Kontexten zu gewinnen.
- Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden kritisch gewürdigt und Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Verbesserung des Mitarbeiterwohlbefindens abgeleitet.
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und erläutert die Relevanz des subjektiven Wohlbefindens in der heutigen Zeit. Die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit werden definiert.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Glücksforschung beleuchtet. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze zum Verständnis von subjektivem Wohlbefinden aus unterschiedlichen Disziplinen vorgestellt. Darüber hinaus werden verschiedene Messmethoden und Determinanten des subjektiven Wohlbefindens diskutiert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Messung des subjektiven Wohlbefindens. Es werden der Aufbau und die Konzeption der Untersuchung, die Vorgehensweise und die Entwicklung des empirischen Konzepts erläutert. Die befragte Zielgruppe und die Ergebnisse der Auswertung werden vorgestellt.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung kritisch gewürdigt. Es werden Limitationen und Schwächen der theoretischen Grundlagen und der empirischen Untersuchung analysiert. Auf Basis dieser Analyse werden Handlungsempfehlungen für Unternehmen abgeleitet, die das subjektive Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter*innen verbessern können.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, welche Faktoren das subjektive Wohlbefinden einer Person beeinflussen und wie Unternehmen das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter*innen auf Grundlage dieser Untersuchung verbessern können.Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen und Konzepte der Glücksforschung und des Mitarbeiterwohlbefindens. Hierzu zählen: subjektives Wohlbefinden, Glücksforschung, neurobiologische, psychologische und ökonomische Perspektiven, Messverfahren, Determinanten, empirische Untersuchung, qualitative Interviews, Handlungsempfehlungen, Mitarbeiterwohlbefinden.- Quote paper
- Jannik Germeroth (Author), 2021, Subjektives Wohlbefinden. Wie können Unternehmen das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter*innen auf Grundlage dieser Untersuchung verbessern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1182610