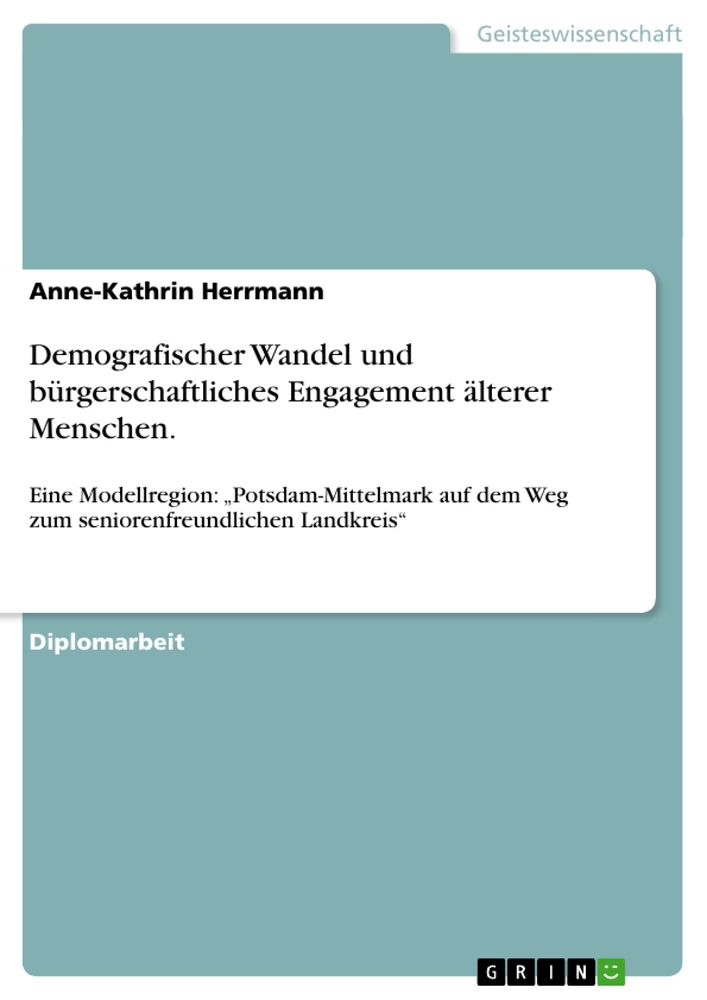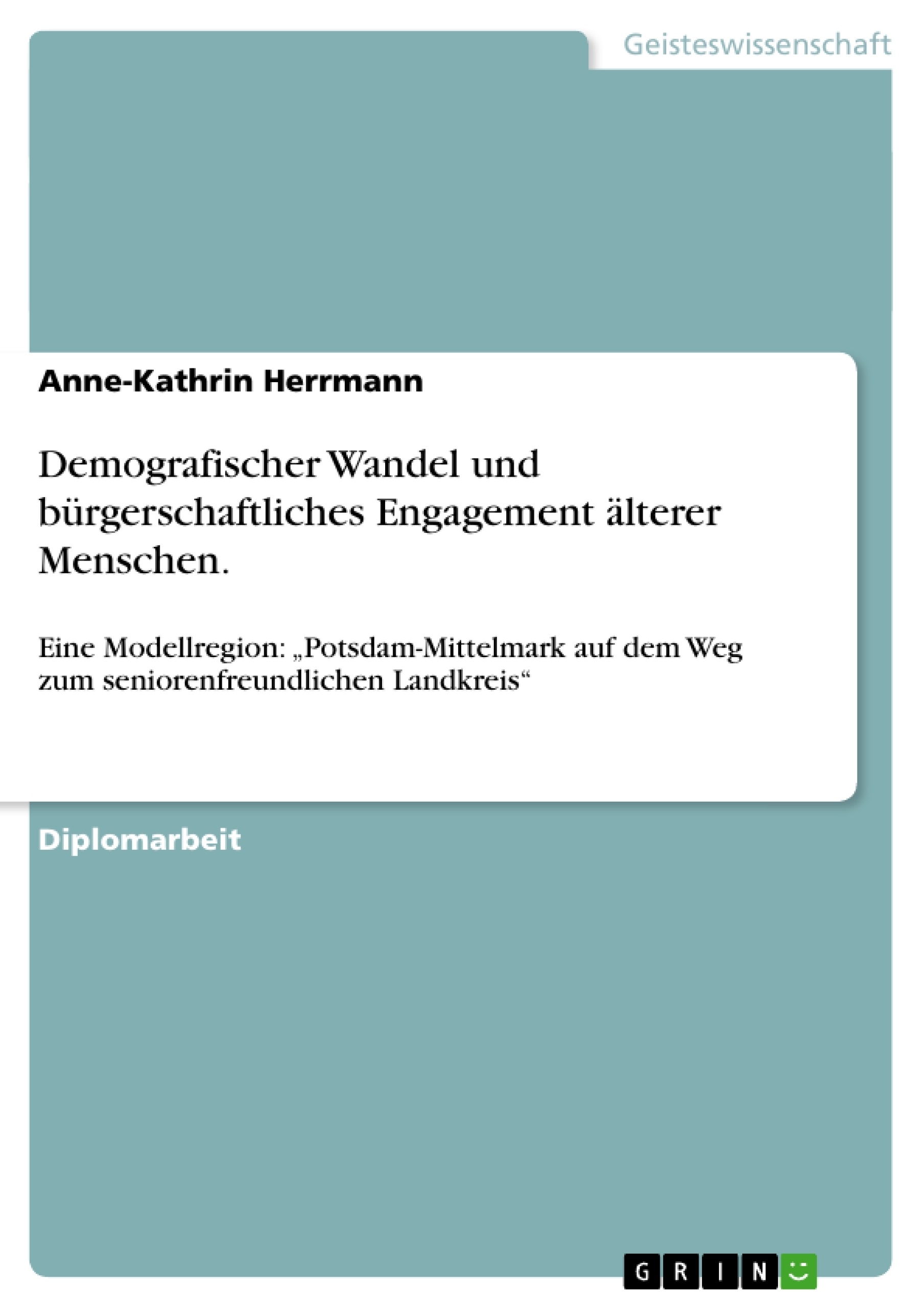In der öffentlichen Diskussion über den demografischen Wandel in Deutschland wird die Alterung der Gesellschaft oft als Belastung vor allem für die sozialen Sicherungssysteme gesehen, aber immer mehr werden auch die positiven Seiten des Alter(n)s diskutiert und Potenziale des Alters erkannt, wie der fünfte Altenbericht der Bundesregierung mit dem Titel „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen“ beweist. Hier in dieser Arbeit geht es um die Potenziale des Alters für bürgerschaftliches Engagement. Es besteht in der Gesellschaft ein überwiegend negativ besetztes Altersbild. Kann dieses Altersbild durch bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen positiv beeinflusst werden? Ausgangspunkt der Diskussion über Alter(n) und bürgerschaftliches Engagement ist die demografische Alterung, die durch eine Zunahme älterer Menschen im Vergleich zu den Jüngeren und besonders durch einen Anstieg der Hochaltrigen ab 80 Jahren gekennzeichnet ist. Folgt daraus auch, dass sich mehr ältere Menschen bürgerschaftlich engagieren? Welche Bedeutung hat bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel bzw. ist es für die Bewältigung der mit dem demografischen Wandel verbundenen Herausforderungen notwendig? Werden die Potenziale älterer Menschen für die Gesellschaft ausreichend genutzt und gefördert? Wie kann das Potenzial Älterer für bürgerschaftliches Engagement aktiviert und genutzt werden? Diese zentralen Fragen werden in der Arbeit behandelt. Dazu werden im Einzelnen im zweiten Kapitel bestimmte empirische Studien und Literatur genannt, die sich mit den Themen Alter(n) und bürgerschaftlichen Engagement älterer Menschen beschäftigen. Die Ergebnisse ausgewählter empirischer Studien dienen später zur Darstellung der Daten und Fakten des bürgerschaftlichen Engagements. Im dritten Kapitel wird der demografische Wandel in Deutschland und dessen Herausforderungen vorgestellt. Die Lebensphase Alter verändert sich, das wird verdeutlicht, zum einen durch den demografischen Wandel und zum anderen durch den von Tews beschriebenen „Strukturwandel des Alters“, dessen fünf Konzepte nach einer Erläuterung zur Bedeutung von „Alter“ und „Alter(n)“ im vierten Kapitel beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Empirische Studien zum Alter(n) und bürgerschaftlichen Engagement
- 3. Demografischer Wandel in Deutschland
- 3.1 Bevölkerungsentwicklung
- 3.2 Mehr ältere Menschen
- 3.3 Geburten-, Sterblichkeits- und Wanderungsentwicklung
- 3.4 Lebenserwartung
- 3.5 Herausforderungen der demografischen Alterung
- 3.6 Fazit: Demografischer Wandel in Deutschland
- 4. Das Alter(n)
- 4.1 Altersbegriffe
- 4.1.1 Kalendarisches Alter
- 4.1.2 Biologisches Alter
- 4.1.3 Psychologisches Alter
- 4.1.4 Soziologisches Alter
- 4.1.5 Fazit: Altersbegriffe
- 4.2 Strukturwandel des Alters
- 4.2.1 Verjüngung
- 4.2.2 Entberuflichung
- 4.2.2.1 Renteneintrittsalter mit 65 Jahren
- 4.2.2.2 Renteneintrittsalter mit 67 Jahren
- 4.2.3 Feminisierung
- 4.2.4 Singularisierung
- 4.2.5 Hochaltrigkeit
- 4.2.6 Fazit: Strukturwandel des Alters
- 4.3 Alternstheorien und -modelle
- 4.3.1 Defizitmodell
- 4.3.2 Kompetenzmodell
- 4.3.3 Disengagement-Theorie
- 4.3.4 Aktivitätstheorie
- 4.3.5 Differenzielle Theorie
- 4.3.6 Fazit: Alternstheorien und -modelle
- 4.4 Gesellschaftliche Bedeutung des Alter(n)s: „Alterslast versus Alterskapitel“
- 4.4.1 Belastungs- und Kostenperspektive
- 4.4.2 Ressourcen- und Chancenperspektive
- 4.4.3 Potenziale des Alters für die Gesellschaft
- 4.1 Altersbegriffe
- 5. Bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen
- 5.1 Begriffserklärung
- 5.1.1 Freiwillig
- 5.1.2 Nicht auf materiellen Gewinn gerichtet
- 5.1.3 Gemeinwohlorientiert
- 5.1.4 Im öffentlich Raum stattfindend
- 5.1.5 Kooperative Tätigkeit
- 5.1.6 Traditioneller und ideengeschichtlicher Bezug
- 5.1.7 Begriffserklärung in verschiedenen empirischen Studien
- 5.1.7.1 Zeitbudgeterhebung 2001/2002
- 5.1.7.2 Freiwilligensurvey 1999/2004
- 5.1.7.3 Alterssurvey 1996/2002
- 5.1.8 Fazit: Begriffserklärung
- 5.2 Faktisches bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen
- 5.2.1 Beteiligungsquoten am Engagement
- 5.2.1.1 Beteiligungsquoten nach Altersgruppen und Geschlecht
- 5.2.1.2 Beteiligungsquoten nach Erwerbs-, Bildung- und Einkommensstatus
- 5.2.1.3 Beteiligungsquoten im Ost-West-Vergleich
- 5.2.2 Engagementbereiche
- 5.2.3 Zugang zum Engagement
- 5.2.4 Beweggründe für ein Engagement
- 5.2.5 Zeitliche Engagementstrukturen
- 5.2.6 Engagementbereitschaft
- 5.2.7 Verbesserungswünsche bei den Rahmenbedingungen des Engagements
- 5.2.7.1 Verbesserungswünsche an die Organisationen
- 5.2.7.2 Verbesserungswünsche an den Staat und die Öffentlichkeit
- 5.2.8 Fazit: Faktisches bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen
- 5.2.1 Beteiligungsquoten am Engagement
- 5.3 Politische Partizipation älterer Menschen
- 5.3.1 Politisches Interesse älterer Menschen
- 5.3.2 Aktive politische Partizipation älterer Menschen
- 5.3.3 Passive politische Partizipation älterer Menschen
- 5.4 Bürgerschaftliches Engagement als „Lückenbüßer“?
- 5.5 Bürgerschaftliches Engagement zur Steigerung der Lebensqualität im Alter?
- 5.6 Handlungsmöglichkeiten zur Förderung des Engagements älterer Menschen
- 5.6.1 Engagement fördernde Infrastruktur
- 5.6.2 Bürgerorientierung
- 5.6.3 Bewusster Umgang mit bürgerschaftlich Engagierten
- 5.6.4 Anerkennungskultur
- 5.6.5 Beteiligungsmöglichkeiten schaffen
- 5.6.6 Abbau der sozialen Ungleichheiten des Engagements
- 5.6.7 Schule als Akteur bürgerschaftlichen Engagements
- 5.6.8 Unternehmen als Akteur bürgerschaftlichen Engagements
- 5.1 Begriffserklärung
- 6. Soziale Arbeit und bürgerschaftliches Engagement
- 6.1 Schaffung neuer Angebote für ältere Menschen
- 6.2 Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen
- 6.3 Fazit: Soziale Arbeit und bürgerschaftliches Engagement
- 7. Beispiele innovativer Angebote für und von älteren Menschen
- 8. Das Land Brandenburg
- 8.1 Demografischer Wandel
- 8.2 Seniorenpolitik
- 8.3 Bürgerschaftliches Engagement
- 8.4 Der Landkreis Potsdam-Mittelmark
- 8.4.1 Demografischer Wandel
- 8.4.2 Bürgerschaftliches Engagement
- 9. These
- 10. Datenerhebung und Datenauswertung
- 10.1 Die Erhebungsmethode: Befragung
- 10.1.1 Das Experteninterview
- 10.1.1.1 Konstruktion des Interviewleitfadens
- 10.1.1.2 Durchführung der Interviews
- 10.1.2 Die schriftliche Befragung mittels Fragebogen
- 10.1.2.1 Konstruktion des Fragebogens
- 10.1.2.2 Durchführung der Befragung
- 10.1.1 Das Experteninterview
- 10.2 Datenanalyse
- 10.2.1 Datenanalyse der Experteninterviews
- 10.2.1.1 Resultate der qualitativen Inhaltsanalyse
- 10.2.2 Datenanalyse der schriftlichen Befragung mittels Fragebogen
- 10.2.2.1 Resultate der deskriptiven Statistik
- 10.2.1 Datenanalyse der Experteninterviews
- 10.3 Fazit: Datenerhebung und Datenauswertung
- 10.1 Die Erhebungsmethode: Befragung
- 11. Vergleich der Resultate mit der These
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen demografischem Wandel und bürgerschaftlichem Engagement älterer Menschen in einer Modellregion. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der demografischen Alterung im Kontext des bürgerschaftlichen Engagements zu beleuchten und Handlungsmöglichkeiten zur Förderung des Engagements aufzuzeigen.
- Demografischer Wandel in Deutschland
- Altersbegriffe und -theorien
- Bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen
- Soziale Arbeit und bürgerschaftliches Engagement
- Handlungsmöglichkeiten zur Förderung des Engagements
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage sowie die Methodik. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext des demografischen Wandels und der Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements. Die Einleitung stellt den Rahmen für die gesamte Untersuchung dar und liefert einen Überblick über die folgenden Kapitel.
2. Empirische Studien zum Alter(n) und bürgerschaftlichen Engagement: Dieses Kapitel analysiert verschiedene empirische Studien, die sich mit dem Thema Alter und bürgerschaftlichem Engagement auseinandersetzen. Es bewertet die Methoden und Ergebnisse der Studien und legt so die Grundlage für die eigene empirische Untersuchung. Der Fokus liegt auf der Darstellung unterschiedlicher Forschungsansätze und deren Stärken und Schwächen, um die eigene Methodik zu kontextualisieren und zu begründen.
3. Demografischer Wandel in Deutschland: Das Kapitel beschreibt detailliert den demografischen Wandel in Deutschland, beleuchtet die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur (Geburtenrate, Sterberate, Lebenserwartung, Migration) und analysiert die damit verbundenen Herausforderungen. Es analysiert die Folgen der Alterung der Bevölkerung für die Gesellschaft und die Wirtschaft und bildet den sozioökonomischen Hintergrund für die Betrachtung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen.
4. Das Alter(n): Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema "Altern". Es differenziert zwischen verschiedenen Altersbegriffen (kalendarisch, biologisch, psychologisch, soziologisch) und untersucht den Strukturwandel des Alters (Verjüngung, Entberuflichung, Feminisierung, Singularisierung, Hochaltrigkeit). Die Kapitel analysiert verschiedene Alternstheorien und -modelle (Defizit-, Kompetenz-, Disengagement-, Aktivitäts-, und differentielle Theorie), um ein vielschichtiges Verständnis von Altern zu entwickeln und den Einfluss dieser Perspektiven auf das bürgerschaftliche Engagement zu beleuchten.
5. Bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen: Das Kapitel definiert den Begriff "bürgerschaftliches Engagement" und untersucht die faktischen Beteiligungsquoten älterer Menschen an verschiedenen Engagementbereichen. Es analysiert die Beweggründe, die zeitlichen Strukturen und die Engagementbereitschaft älterer Menschen. Weiterhin werden Verbesserungswünsche der Engagierten hinsichtlich der Rahmenbedingungen des Engagements untersucht und diskutiert. Der Fokus liegt auf einer differenzierten Darstellung der Vielfalt und Komplexität des Engagements.
6. Soziale Arbeit und bürgerschaftliches Engagement: Dieses Kapitel untersucht die Schnittstelle zwischen Sozialer Arbeit und bürgerschaftlichem Engagement. Es beleuchtet, wie Soziale Arbeit neue Angebote für ältere Menschen schaffen und die Zusammenarbeit zwischen haupt- und ehrenamtlich Tätigen fördern kann. Der Fokus liegt auf der Rolle der Sozialen Arbeit als wichtiger Akteur in der Gestaltung und Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement im Alter.
7. Beispiele innovativer Angebote für und von älteren Menschen: Dieses Kapitel präsentiert Beispiele aus der Praxis, die innovative Angebote für und von älteren Menschen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements vorstellen. Es zeigt erfolgreiche Modelle und best-practice Beispiele auf, um die vielfältigen Möglichkeiten des Engagements im Alter aufzuzeigen.
8. Das Land Brandenburg: Das Kapitel konzentriert sich auf die Situation im Land Brandenburg, indem es den demografischen Wandel, die Seniorenpolitik und das bürgerschaftliche Engagement in der Region analysiert, und konzentriert sich im Speziellen auf den Landkreis Potsdam-Mittelmark.
Schlüsselwörter
Demografischer Wandel, Bürgerschaftliches Engagement, Ältere Menschen, Altersbegriffe, Alternstheorien, Soziale Arbeit, Modellregion, Handlungsmöglichkeiten, Engagementförderung, Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen demografischem Wandel und bürgerschaftlichem Engagement älterer Menschen in einer Modellregion (Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg). Ziel ist es, Herausforderungen und Chancen der demografischen Alterung im Kontext des bürgerschaftlichen Engagements zu beleuchten und Handlungsmöglichkeiten zur Förderung des Engagements aufzuzeigen.
Welche Aspekte des demografischen Wandels werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert den demografischen Wandel in Deutschland, einschließlich Bevölkerungsentwicklung, Alterung der Bevölkerung, Geburten-, Sterblichkeits- und Wanderungsentwicklung, Lebenserwartung und den damit verbundenen Herausforderungen für Gesellschaft und Wirtschaft.
Wie werden Altersbegriffe und -theorien in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Altersbegriffen (kalendarisch, biologisch, psychologisch, soziologisch) und analysiert den Strukturwandel des Alters (Verjüngung, Entberuflichung, Feminisierung, Singularisierung, Hochaltrigkeit). Verschiedene Alternstheorien und -modelle (Defizit-, Kompetenz-, Disengagement-, Aktivitäts- und differentielle Theorie) werden untersucht, um ein vielschichtiges Verständnis von Altern zu entwickeln.
Wie wird bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen definiert und untersucht?
Der Begriff "bürgerschaftliches Engagement" wird definiert und die faktischen Beteiligungsquoten älterer Menschen an verschiedenen Engagementbereichen untersucht. Die Arbeit analysiert Beweggründe, zeitliche Strukturen, Engagementbereitschaft und Verbesserungswünsche der Engagierten hinsichtlich der Rahmenbedingungen. Politische Partizipation älterer Menschen wird ebenfalls betrachtet.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit im Kontext des bürgerschaftlichen Engagements?
Die Arbeit untersucht die Schnittstelle zwischen Sozialer Arbeit und bürgerschaftlichem Engagement, beleuchtet die Schaffung neuer Angebote für ältere Menschen und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen.
Welche innovativen Angebote für und von älteren Menschen werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Beispiele aus der Praxis, die innovative Angebote für und von älteren Menschen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements vorstellen. Erfolgreiche Modelle und Best-Practice-Beispiele werden aufgezeigt.
Wie wird die Situation im Land Brandenburg und im Landkreis Potsdam-Mittelmark dargestellt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Situation im Land Brandenburg, indem sie den demografischen Wandel, die Seniorenpolitik und das bürgerschaftliche Engagement in der Region analysiert, mit einem besonderen Fokus auf den Landkreis Potsdam-Mittelmark.
Welche Methoden der Datenerhebung und -auswertung wurden verwendet?
Die Datenerhebung erfolgte mittels Experteninterviews und schriftlicher Befragungen. Die Datenanalyse umfasst qualitative Inhaltsanalysen der Interviews und deskriptive Statistik der Fragebögen.
Welche Handlungsmöglichkeiten zur Förderung des Engagements älterer Menschen werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt verschiedene Handlungsmöglichkeiten vor, darunter die Verbesserung der Infrastruktur, Bürgerorientierung, Anerkennungskultur, Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten, Abbau sozialer Ungleichheiten, und die Einbeziehung von Schulen und Unternehmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Demografischer Wandel, Bürgerschaftliches Engagement, Ältere Menschen, Altersbegriffe, Alternstheorien, Soziale Arbeit, Modellregion, Handlungsmöglichkeiten, Engagementförderung, Lebensqualität.
- Citation du texte
- Anne-Kathrin Herrmann (Auteur), 2008, Demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118207