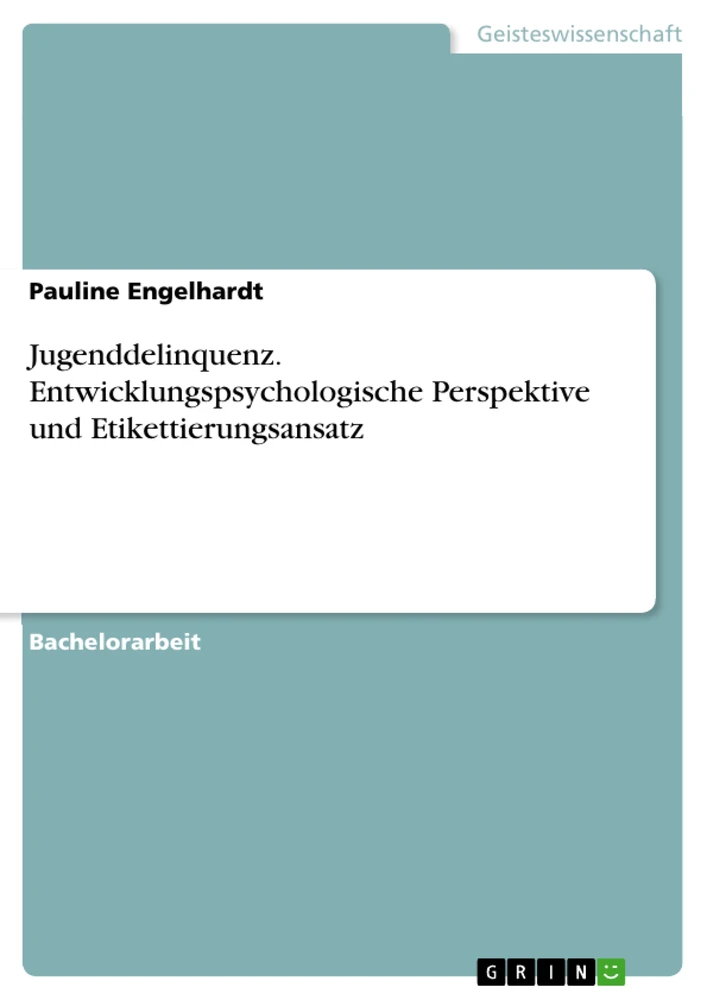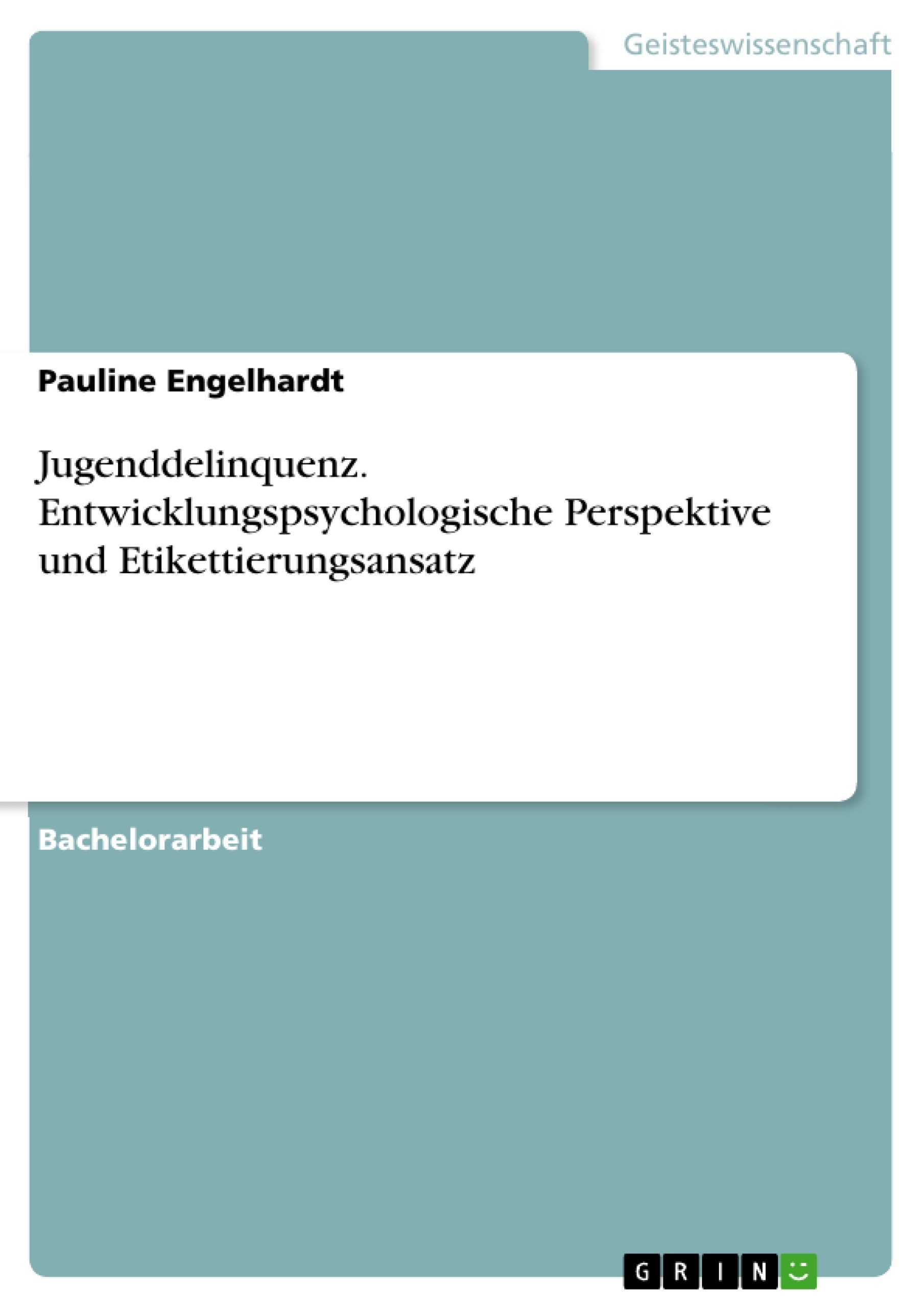Dieser Arbeit liegt die folgende Fragestellung zugrunde: Inwiefern stellt Jugenddelinquenz ein ubiquitäres Phänomen dar? Als erstes wird sich im zweiten Kapitel mit der Jugendphase im Allgemeinen auseinandergesetzt, um ein grundlegendes Verständnis für die weiterführende Thematik der Jugenddelinquenz zu schaffen. Dabei geht es zunächst um Begriffsbestimmungen und danach um die Betrachtungsweise von Jugend als soziale und gesellschaftlich konstruierte Kategorie, welche ebenfalls einen anerkannten Forschungspunkt darstellt. Des Weiteren befasst sich die Arbeit mit der Jugend aus entwicklungspsychologischer Sicht. Die Betrachtungsweise der Entwicklungspsychologie wurde ausgewählt, da sie einen in der Wissenschaft vielvertretenen Ansatz darstellt und auch Grundlage eines späteren Kapitels zu Erklärungsansätzen der Jugenddelinquenz ist.
Anschließend geht es im dritten Kapitel übergreifend um die Jugenddelinquenz. Dafür werden zunächst erneut wichtige Begriffe definiert und anschließend die Jugendkriminalität im Hell- und Dunkelfeld differenziert behandelt. Im letzten Unterkapitel des dritten Abschnittes wird auf die Unterschiede von sogenannten episodischen und intensiven Täter*innen eingegangen. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass die eine Gruppe mit ihren Verhaltensweisen einer jugendtypischen Entwicklung zugeteilt wird und die andere eher der langfristigen und jugenduntypischen Delinquenz. Im vierten Kapitel folgt die Auseinandersetzung mit bestimmten Entstehungszusammenhängen und Erklärungsansätzen von Jugenddelinquenz.
Dabei werden sowohl entwicklungspsychologische als auch lebenslaufforschungsbezogene Ansätze und Theorien herangezogen. Das letzte Teilkapitel beschäftigt sich mit der soziologischen Etikettierungstheorie, die eine andere Sichtweise auf die Jugenddelinquenz darstellt, indem sie die Zuschreibungsprozesse „nichtkonformen“ Verhaltens in den Vordergrund stellt. Inhaltlich endet die Arbeit mit einem Perspektivwechsel, durch welchen die Konzepte Jugend und Jugenddelinquenz grundsätzlich infrage gestellt und kritisch beleuchtet werden. Hierdurch soll nicht nur die bestehende Betrachtungsweise von Jugendlichen hinterfragt und gegebenenfalls erweitert werden, es wird ebenfalls auf die Vielfältigkeit pädagogischer und wissenschaftlicher Aussagen bezüglich Jugenddelinquenz aufmerksam gemacht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Jugendphase
- 2.1 Begrifflichkeiten
- 2.2 Jugend als soziales Konstrukt
- 2.3 Jugend aus entwicklungspsychologischer Sicht
- 2.3.1 Gegenstand und Aufgaben der Entwicklungspsychologie
- 2.3.2 Entwicklungsaufgaben
- 2.3.3 Entwicklungskontexte
- 3. Jugenddelinquenz
- 3.1 Begrifflichkeiten
- 3.2 Jugendkriminalität im Hell- und Dunkelfeld
- 3.3 Episodische und intensive Jugenddelinquenz
- 4. Jugenddelinquenz als ubiquitäres Phänomen
- 4.1 Einblick in die Forschungslage zur Erklärung von Jugenddelinquenz
- 4.2 Erklärungsansätze und Entstehungszusammenhänge aus psychologischer Perspektive
- 4.3 Jugenddelinquenz im Lebenslauf
- 4.4 Etikettierungsansatz/ „Labeling Approach“
- 5. Perspektivwechsel
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Jugenddelinquenz und zielt darauf ab, die Allgegenwärtigkeit (Ubiquität) dieser Erscheinung zu untersuchen. Sie erforscht die Ursachen und Entstehungszusammenhänge von Jugenddelinquenz aus verschiedenen Perspektiven, insbesondere aus entwicklungspsychologischer Sicht.
- Definition und Abgrenzung von Jugend und Jugenddelinquenz
- Entwicklungspsychologische Aspekte der Jugendphase und ihre Relevanz für das Verständnis von Jugenddelinquenz
- Erklärungsansätze für Jugenddelinquenz aus psychologischer Perspektive
- Das Konzept der Etikettierung und dessen Einfluss auf die Entstehung und Wahrnehmung von Jugenddelinquenz
- Kritische Betrachtung der Konzepte Jugend und Jugenddelinquenz
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel der Arbeit widmet sich der Jugendphase im Allgemeinen, beleuchtet unterschiedliche Begrifflichkeiten und die gesellschaftliche Konstruktion von Jugend. Des Weiteren wird die Jugend aus entwicklungspsychologischer Sicht betrachtet, wobei die relevanten Bereiche dieser Disziplin und Entwicklungsaufgaben sowie Entwicklungskontexte beleuchtet werden.
Im dritten Kapitel wird der Begriff der Jugenddelinquenz definiert und die Jugendkriminalität im Hell- und Dunkelfeld differenziert dargestellt. Darüber hinaus werden episodische und intensive Jugenddelinquenz im Hinblick auf ihre Unterschiede und Bedeutungen für die Entwicklung von Jugendlichen analysiert.
Das vierte Kapitel widmet sich der Erforschung der Entstehungszusammenhänge und Erklärungsansätze von Jugenddelinquenz. Hier werden sowohl entwicklungspsychologische als auch lebenslaufforschungsbezogene Ansätze und Theorien aufgezeigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der soziologischen Etikettierungstheorie, die einen kritischen Blick auf die Zuschreibungsprozesse von „nicht-konformen“ Verhalten wirft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Jugend, Jugenddelinquenz, Entwicklungspsychologie, Erklärungsansätze, Etikettierungstheorie, gesellschaftliche Konstruktion von Jugend und kritische Betrachtung von Konzepten.
- Citar trabajo
- Pauline Engelhardt (Autor), 2021, Jugenddelinquenz. Entwicklungspsychologische Perspektive und Etikettierungsansatz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181249