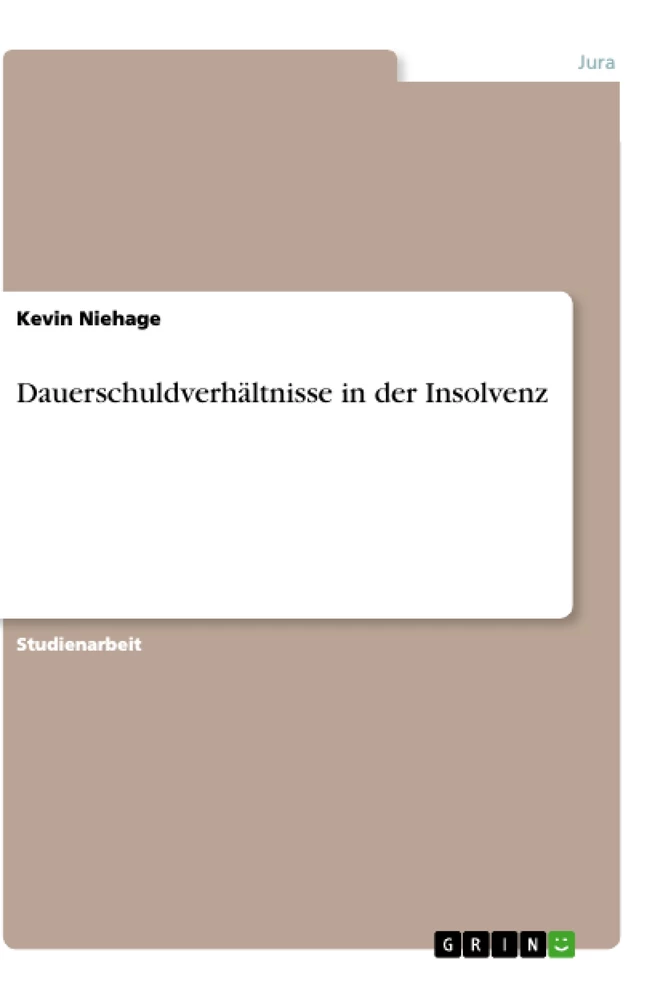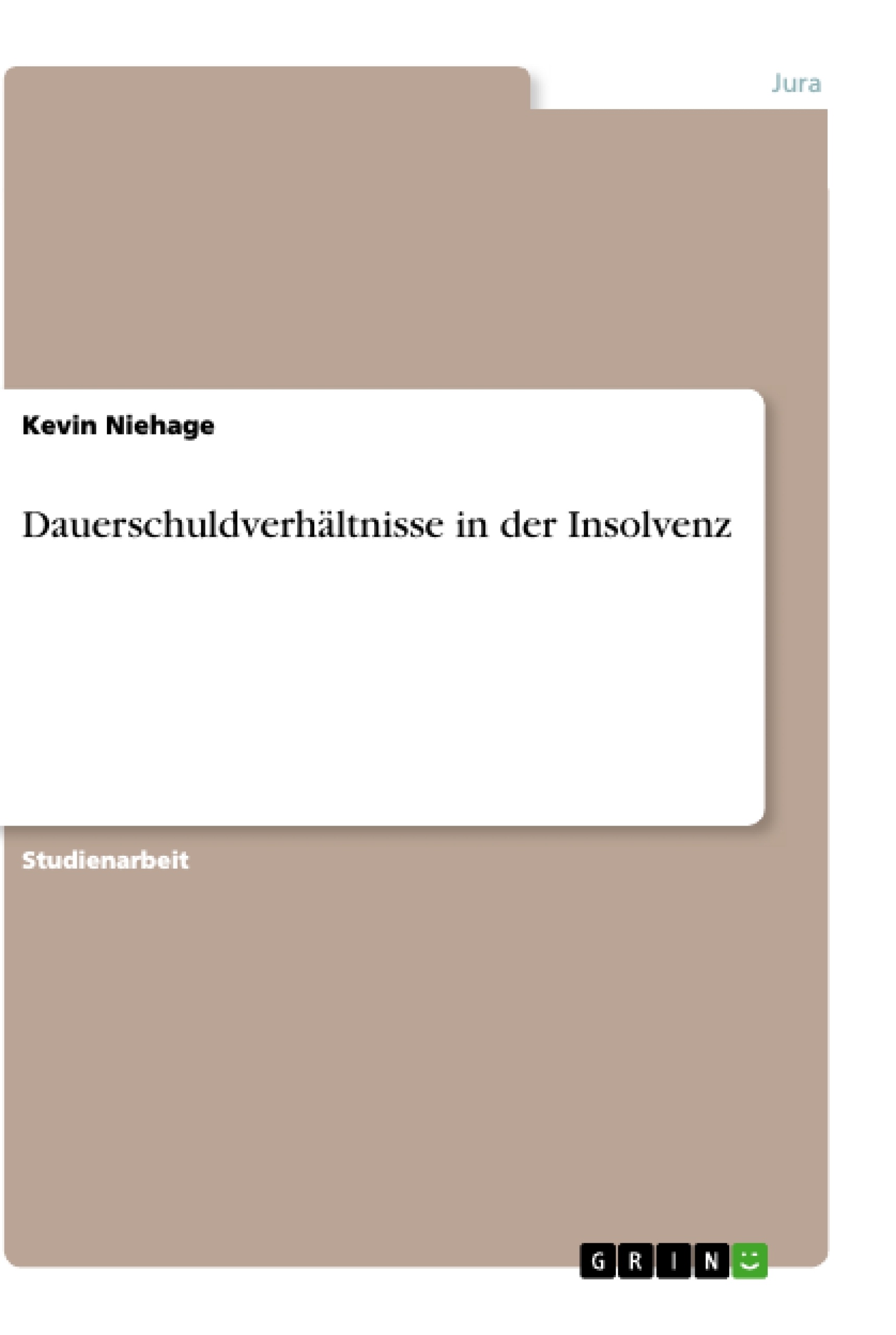In dieser Arbeit sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen für Dauerschuldverhältnisse sowohl allgemein als auch speziell innerhalb der Insolvenz betrachtet werden. Der Abschluss von zivilrechtlichen Verträgen fußt auf dem Vertrauen der Vertragsparteien, dass die Gegenseite ihre eigenen Verpflichtungen erfüllen wird. Dies gilt umso mehr für Dauerschuldverhältnisse, bei denen anstelle eines einmaligen Leistungsaustauschs eine wiederkehrende Leistungsverpflichtung begründet wird. Dementsprechend bedarf es dem Vertrauen, dass die Gegenseite nicht nur aktuell, sondern auch zukünftig ihrer Leistungspflicht nachkommen wird.
Ein besonderes Risiko für diese Vertrauensstellung liegt in der zukünftigen Zahlungsunfähigkeit einer der beiden Vertragsparteien. Auch wenn die Anzahl der Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzverfahren in Deutschland seit der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010 kontinuierlich abnimmt, so verursachen doch bereits allein die Unternehmensinsolvenzen bundesweit immer noch finanzielle Verluste von etwa zehn bis fünfzehn Milliarden Euro pro Jahr. Auch im Zuge der Insolvenz nehmen Dauerschuldverhältnisse eine besondere Stellung ein, da ihr Vertragsgegenstand mithin für eine mögliche Unternehmensfortführung aber auch für die soziale Stellung des Insolvenzschuldners existentiell sein kann.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A Einleitung
B Hauptteil
B.I Begriffsbestimmung
B.II Schuldrechtliche Behandlung
B.II.l Rücktrittsvorbehalt
B.II.2 Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen
B.II.3 Störung der Geschäftsgrundlage
B.II.4 Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund
B.III Insolvenzrechtliche Behandlung
B.III.l Wahlrecht des Insolvenzverwalters
B.III.2 Fortbestehen bestimmter Schuldverhältnisse
B.III.2.a Miet- und Pachtverhältnis über unbewegliche Gegenstände oder Räume .. .
B.III.2.b Dienstverhältnis
B.III.2.C Leasingvertrag
B.III.2.d Darlehensvertrag
B.III.3 Erlöschen bestimmter Schuldverhältnisse
B.III.4 Auflösung von Gesellschaften
B.III.5 Insolvenzgläubigerschaft und Massegläubigerschaft
B.III.6 Kündigungssperre
B.III.7 Schadensersatzanspruch
B.IV Einordnung
C Fazit
Literaturverzeichnis
Rechtsprechungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A Einleitung
Der Abschluss von zivilrechtlichen Verträgen fußt auf dem Vertrauen der Vertragsparteien, dass die Gegenseite ihre eigenen Verpflichtungen erfüllen wird. Dies gilt umso mehr für Dauerschuldverhältnisse, bei denen anstelle eines einmaligen Leistungsaustauschs eine wiederkehrende Leistungsverpflichtung begründet wird. Dementsprechend bedarf es dem Vertrauen, dass die Gegenseite nicht nur aktuell, sondern auch zukünftig ihrer Leistungspflicht nachkommen wird.
Ein besonderes Risiko für diese Vertrauensstellung liegt in der zukünftigen Zahlungsunfähigkeit einer der beiden Vertragsparteien. Auch wenn die Anzahl der Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzverfahren in Deutschland seit der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010 kontinuierlich abnimmt,1 so verursachen doch bereits allein die Unternehmensinsolvenzen bundesweit immer noch finanzielle Verluste von etwa zehn bis fünfzehn Milliarden Euro pro Jahr.2
Auch im Zuge der Insolvenz nehmen Dauerschuldverhältnisse eine besondere Stellung ein, da ihr Vertragsgegenstand mithin für eine mögliche Unternehmensfortführung aber auch für die soziale Stellung des Insolvenzschuldners existentiell sein kann.
Daher sollen im Folgenden die rechtlichen Rahmenbedingungen für Dauerschuldverhältnisse sowohl allgemein als auch speziell innerhalb der Insolvenz betrachtet werden.
Die formale Gestaltung der vorliegenden Hausarbeit orientiert sich am Leitfaden zur formalen Gestaltung von Seminar- und Abschlussarbeiten der FOM Hochschule für Oekonomie und Management mit Stand vom Mai 2021.
B Hauptteil
Zur umfassenden Betrachtung der Dauerschuldverhältnisse in der Insolvenz soll zunächst eine Begriffsbestimmung erfolgen. Anschließend soll eine Darstellung der außerinsolvenzlichen schuldrechtlichen Behandlung von Dauerschuldverhältnissen erfolgen, um darauf aufbauend die abweichende Behandlung im Zuge der Insolvenz betrachten zu können. Abschließend soll eine kurze Einordnung der insolvenzrechtlichen Sonderstellung erfolgen.
B.I Begriffsbestimmung
Bei einem Dauerschuldverhältnis handelt es sich um ein auf Dauer ausgelegtes Schuldverhältnis, durch das ein Gläubiger im Zuge des § 241 Abs. 1 BGB berechtigt wird, wiederkehrend eine Leistung oder ein Unterlassen von einem Schuldner zu fordern. Für ein Dauerschuldverhältnis kann eine vorab festgelegte Laufzeit als auflösende Bedingung iSd. §§ 163, 158 Abs. 1 BGB bestimmt werden, es kann jedoch auch auf die Vereinbarung einer Laufzeit verzichtet werden.3
Auch wenn der Begriff des Dauerschuldverhältnisses bereits im Jahre 1951 in höchstgerichtlichen Entscheidungen zur Anwendung kommt,4 so findet er doch erst in den Jahren 1975/1976 normierte Erwähnung im Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen,5 wobei der Gesetzgeber auf eine Legaldefinition des Begriffs verzichtete.6
Im Zuge der Schuldrechtsmodernisierung im Jahre 2001 wurde der Begriff in das Bürgerliche Gesetzbuch übernommen, doch auch hier verzichtete der Gesetzgeber auf die Einführung einer Legaldefinition, „[•••] weil dies zwangsläufig zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen und möglicherweise künftige Entwicklungen beeinträchtigen würde.“7 Gleichzeitig umriss der Gesetzgeber den Begriff des Dauerschuldverhältnisses, das sich vom auf einen einmaligen Leistungsaustausch geprägten Schuldverhältnis dadurch abgrenzt, dass „während der Laufzeit ständig neue Leistungs- und Schutzpflichten entstehen und dem Zeitelement eine wesentliche Bedeutung zukommt.“8
Mit § 11 Nr. 12 AGBG und später mit Übernahme dieser Regelung im Zuge der Schuldrechtsmodernisierung als § 309Nr. 9BGB führte der Gesetzgeber jedoch immerhin eine teilweise Begriffsdefinition ein, wonach sich das Klauselverbot ohne Wertungsmöglichkeit in allgemeinen Geschäftsbedingungen zumindest auf die Laufzeit solcher Dauerschuldverhältnisse bezieht, bei denen es sich um ein „[...] Vertragsverhältnis [handelt], das die regelmäßige Lieferung von Waren oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- und Werkleistungen durch den Verwender zum Gegenstand hat,“ wobei dieselbe Regelung „[...] nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig verkaufter Sachen sowie für Versicherungsverträge [gilt]“.9
In Ermangelung einer umfassenden Legaldefinition besteht in der Literatur eine fortwährende rechtsdogmatische Auseinandersetzung mit der anzuwendenden Begriffsauslegung, zumal die Einordnung aufgrund der §§ 308 f. BGB relevant für die Wirksamkeit von Vertragsinhalten sein kann. Zudem kann die Einordnung als Dauerschuldverhältnis relevant für die sachliche Anwendbarkeit spezialgesetzlicher Regelungen sein.10 Für die weitere thematische Betrachtung können die aufgeworfenen Detailproblematiken jedoch dahinstehen, sodass sich im Folgenden auf die anfangs eingeführte, sehr weitreichende Definition des Dauerschuldverhältnisbegriffs gestützt wird.
B.II Schuldrechtliche Behandlung
Bevor im Folgenden die abweichende Behandlung von Dauerschuldverhältnissen in der Insolvenz herausgearbeitet werden kann, sollen zunächst die schuldrechtlichen Sondernormen betrachtet werden, die außerhalb einer Insolvenz gelten.
B.II.l Rücktrittsvorbehalt
Im Zuge der Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) definiert § 308 Nr. 3 Hs. 1 BGB eine Vereinbarung eines Rücktrittsvorbehalts als regelmäßig unwirksam. Beim Rücktrittsvorbehalt handelt es sich um die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sich ohne sachlich gerechtfertigten und im Vertrag angegebenen Grund von seiner Leistungspflicht zu lösen.
Diese Regelung gilt nach § 308Nr. 3Hs. 2BGB jedoch explizit nicht für Dauerschuldverhältnisse, sodass der Verwender von AGB, der ein Dauerschuldverhältnis eingeht, mithin berechtigt ist, einen Rücktrittsvorbehalt zu vereinbaren. In der Literatur wird diese Ausnahme damit begründet, dass in Dauerschuldverhältnissen ohnehin die Möglichkeit einer Kündigung ohne Angabe von Gründen gegeben ist.11
B.II.2 Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen
Im Zuge der Inhaltskontrolle von AGB definiert § 309 Nr. 9 BGB Anforderungen an die Festlegung der Laufzeit und Verlängerung von Dauerschuldverhältnissen, deren Verletzung in jedem Fall zur Unwirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen führt, soweit es sich um Vertragsverhältnisse handelt, die die regelmäßige Lieferung von Waren oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen durch den Verwender der AGB zum Gegenstand haben.
Hierunter fallen insbesondere Vertragslaufzeiten von mehr als zwei Jahren, stillschweigende Vertragsverlängerungen von mehr als einem Jahr, sowie längere Kündigungsfristen als drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer.
B.II.3 Störung der Geschäftsgrundlage
Bei einer Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 Abs. 1 BGB haben die Vertragsparteien die Möglichkeit, die vormals getroffenen Vertragsinhalte zu ändern, um das bestehende Vertragsverhältnis aufrecht zu erhalten. Eine Störung der Vertragsgrundlage liegt dann vor, wenn sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben und die Parteien den Vertrag deshalb nicht oder nur mit anderem Inhalt geschlossen hätten.
Ist eine Vertragsänderung jedoch nicht möglich oder für eine Partei nicht zumutbar, so eröffnet sich regelmäßig ein Rücktrittsanspruch nach § 313 Abs. 3 BGB. Die Ausübung eines Rücktrittsanspruchs hat nach § 346 Abs. 1 BGB die Rückgewähr der empfangenen Leistungen sowie die Herausgabe der gezogenen Nutzungen zur Folge, was bei auf Dauer ausgelegten Rechtsverhältnissen zu praktischen Problemen in der Umsetzung führen kann.
An die Stelle des Rücktrittsrechts rückt für Dauerschuldverhältnisse nach § 313 Abs. 3S.2 BGB daher ein Kündigungsrecht. In der Literatur wird diskutiert, ob es sich bei § 313 Abs. 3S.2 BGB um eine eigenständige Anspruchsgrundlage handelt12 oder ob sie durch die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund nach § 314 BGB verdrängt wird.13 14
Gegen eine eigenständige Anspruchsgrundlage spricht jedoch, dass der § 313 Abs. 3S.2 BGB lediglich ein generelles Kündigungsrecht in Aussicht stellt, ohne dieses auszugestalten, während § 314 Abs. 1S.1 BGB spezifisch von einer Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ausgeht. Zudem enthält die Gesetzesbegründung zum § 313 Abs. 3 BGB den expliziten Hinweis, dass ,,[b]ei Dauerschuldverhältnissen [..] an die Stelle des Rücktrittsrechts das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund nach § 314 RE [tritt]. [1114] Der Gesetzgeber räumt lediglich der Vertragserhaltung durch Anpassung nach § 313 Abs. 1 BGB einen Anwendungsvorrang vor der Vertragsauflösung durch Kündigung nach § 314 Abs. 1 BGB ein.15
B.II.4 Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund
Nach § 314 Abs. 1S.2 BGB kann ein Dauerschuldverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt dann vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.
Bereits vor Einführung der gesetzlichen Regelung im Zuge der Schuldrechtsmodernisierung leitete der BGH ein Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund aus der Leistung nach Treu und Glaube des § 242 BGB ab.16 Dieses Recht kann auch nicht im Zuge von AGB abbedungen werden.17
Wie bereits in B.II.3 ausgeführt, ist die Kündigung aus wichtigem Grund jedoch lediglich subsidiär bei erfolgloser Anpassung des Vertrags im Zuge der Störung der Geschäftsgrundlage anzuwenden. Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit der fristgemäßen Kündigung des Dauerschuldverhältnisses.
B.III Insolvenzrechtliche Behandlung
Nachdem in B.II die Behandlung von Dauerschuldverhältnissen außerhalb der Insolvenz betrachtet wurde, stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang deren Behandlung im Zuge des vorläufigen und eröffneten Insolvenzverfahrens verändert ist.
B.III.l Wahlrecht des Insolvenzverwalters
Grundsätzlich steht dem Insolvenzverwalter nach § 103 InsO das Wahlrecht zu, nicht oder nicht vollständig erfüllte gegenseitige Verträge iSd. § 320 BGB zu erfüllen und deren Erfüllung von der Gegenpartei zu fordern (§ 103 Abs. 1 InsO) oder aber die Erfüllung abzulehnen (§ 103 Abs. 2S.1 InsO).18
Entscheidend für die Ausübung des Wahlrechts ist ausschließlich die Prüfung der Massegünstigkeit. Da das primäre Ziel des Insolvenzverfahrens die Gläubigerbefriedigung nach § 1S.1 InsO ist, kommt es nur darauf an, ob durch Erfüllung des Vertrags die Insolvenzmasse gemehrt oder durch Ablehnung der Vertragserfüllung die Insolvenzmasse geschützt werden kann.19 Seit Einführung der Insolvenzordnung erstreckt sich dieses Wahlrecht auch auf einen Großteil der Dauerschuldverhältnisse.20
Lehnt der Insolvenzverwalter eine Forderungserfüllung ab, so kann der entsprechende Gläubiger die Forderung nach § 103 Abs. 2S.1 InsO nur noch als Insolvenzgläubiger geltend machen. Fordert der Insolvenzverwalter die Erfüllung, wird für Dauerschuldverhältnisse angenommen, dass Forderungen, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, nur als Insolvenzgläubiger geltend gemacht werden können, während danach entstehende Forderungen als Masseverbindlichkeiten behandelt werden sollen. Sowohl die Auslegung des § 105 S. 1 InsO als auch die analoge Anwendung des § 108 Abs. 3 InsO führen zu diesem Ergebnis.21
Das Wahlrecht ist gesetzlich derart stark verankert, dass es die schuldrechtlichen Regelungen des BGB durchbricht. So sind nach § 119 InsO sämtliche Vereinbarungen - einschließlich etwaiger privatvertraglich vereinbarter insolvenzabhängiger Lösungsklauseln - unwirksam, die im Voraus die Anwendung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters ausschließen oder beschränken.22
Es ist allgemein anerkannt, dass das Wahlrecht nur dem Insolvenzverwalter, nicht jedoch dem vorläufigen Insolvenzverwalter zusteht.23 Hiervon zu unterscheiden ist hingegen die Möglichkeit des vorläufigen Insolvenzverwalters, neue Dauerschuldverhältnisse als Masseverbindlichkeiten einzugehen, die als solche nicht mehr dem Wahlrecht des Insolvenzverwalters unterliegen.24
B.III.2 Fortbestehen bestimmter Schuldverhältnisse
Die §§ 108 ff. InsO stellen eine wesentliche Einschränkung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters hinsichtlich der Erfüllung oder Ablehnung bestehender Dauerschuldverhältnisse dar.25 Die Beschränkung des sachlichen Anwendungsbereichs auf bestimmteDauerschuldverhältnissewurde in der ursprünglichen Fassung des § 108 InsO a.F. noch deutlich, der eingangs die Überschrift „Fortbestehen von Dauerschuldverhältnissen“ trug.26 Erst mit dem Gesetz zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens wurde die Überschrift in das heutige „Fortbestehen bestimmter Schuldverhältnisse“ abgeändert.27
Die Regelung bezieht sich nur auf eine eingeschränkte Zahl von Schuldverhältnissen, deren Fortbestehen als Masseverbindlichkeit iSd. § 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO erzwungen wird.28 Ob ein entsprechender Vertragstyp vorliegt, muss bei typengemischten Verträgen im Zweifel anhand einer inhaltlichen Schwerpunktbetrachtung festgestellt werden.29
B.III.2.a Miet- und Pachtverhältnis über unbewegliche Gegenstände oder Räume
Der § 108 Abs. 1S.1 Alt. 1 InsO sieht das Fortbestehen von Miet- und Pachtverträgen über unbewegliche Gegenstände oder Räume vor. Der Begriff der unbeweglichen Gegenstände bezeichnet hierbei Gegenstände nach § 49 InsO, die der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen entsprechend der §§ 864ff. ZPO unterliegen.30
In den ebenfalls einschlägigen §§ 109bisll2 InsO wird unterschieden zwischen Szenarien, in denen der Insolvenzschuldner als Mieter oder Pächter auftritt (§§ 109, 112 InsO) und solchen, in denen er als Vermieter oder Verpächter fungiert (§§ 110, 111 InsO). Auch wenn der Insolvenzverwalter zur anfänglichen Aufrechterhaltung verpflichtet ist, so wird ihm doch die Möglichkeit eingeräumt, sich abseits der vertraglichen Regelungen von den Verbindlichkeiten zu lösen.
§ 109 Abs. 1S.1 InsO sieht vor, dass als Mieter oder Pächter eingegangene Verträge ohne Rücksicht auf vertragliche Vereinbarungen vom Insolvenzverwalter mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden können, soweit keine kürzere Frist maßgeblich ist.
Bei Miet- oder Pachtverträgen über die Wohnung des Schuldners kann der Insolvenzverwalter nach § 109 Abs. 1S.2 InsO anstelle der Kündigung geltend machen, dass Forderungen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten nicht im Insolvenzverfahren geltend gemacht werden können. Mit dieser Regelung, die mit dem Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung eingeführt wurde, sollte der private Wohnraumverlust im Zuge der Insolvenz vermieden werden.31
Da eine Vermietung oder Verpachtung von unbeweglichen Gegenständen oder Räumen aufgrund des Zuflusses von Miet- und Pachtzahlungen regelmäßig massegünstig sein wird, sieht § 110 InsO keine spezifischen Kündigungserleichterungen vor. Jedoch kann es im Interesse der Insolvenzgläubiger sein, eine Veräußerung des Miet- oder Pachtobjekts anzustreben.32 Die Veräußerung eines vermieteten oder verpachteten Objekts ist dabei regelmäßig schwieriger, als wenn der potentielle Erwerber nicht zur Aufrechterhaltung des Miet- oder Pachtverhältnisses verpflichtet wäre. Daher sieht § 111 InsO eine Kündigungserleichterung für Fälle vor, in denen der Erwerber nach §§ 566 Abs. 1, 593b BGB in das bestehende Vertragsverhältnis eintritt.33 In der Literatur wird mithin die Auffassung vertreten, dass diese Kündigungserleichterung aufgrund des besonderen Schutzbedürfnisses der Mieter jedoch nicht auf Wohnraummietverträge anwendbar sein soll, sodass der Schutzgehalt des § 573 Abs. 1 BGB durch die Regelung des § 111 InsO nicht verdrängt wird.34
B.III.2.b Dienstverhältnis
Der § 108 Abs. 1S.1 Alt. 2 InsO sieht das Fortbestehen von Dienstverhältnissen vor. Als relevantes Dienstverhältnis wird in der Literatur wiederkehrend der Dienstvertrag iSd. §§ 611 BGB und hierbei speziell der Arbeitsvertrag nach § 611a BGB genannt.35 Zwar werden regelmäßig auch Beamtenverhältnisse iSd. § 3 Abs. 1 BeamtStG zu den Dienstverhältnissen gezählt,36 jedoch dürfte diese Form des Dienstverhältnisses aufgrund der grundsätzlichen Unzulässigkeit des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bundes und der Länder (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 InsO) sowie juristischer Personen des öffentlichen Rechts (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 InsO) in Hinblick auf ihre praktische Relevanz zurückstehen.
Trotz der wirtschaftlichen Bedeutung des Arbeitseinkommens für die soziale Teilhabe und Existenzsicherung findet abseits der vorläufigen Fortführungspflicht keine umfassende Besserstellung von Dienstverhältnissen gegenüber anderen privilegierten Dauerschuldverhältnissen statt.37 Im Gegenteil kann es sogar im Interesse der übrigen Insolvenzgläubiger liegen, nicht mehr benötigte Arbeitnehmer möglichst zeitnah zu entlassen, um die zur Verfügung stehende Insolvenzmasse zu schonen.38 Daher hat der Gesetzgeber mit § 113 S. 1 InsO die Möglichkeit geschaffen, Dienstverhältnisse abseits der vertraglichen Regelungen zu beenden.
§ 113 S. 2 InsO schränkt dabei die Kündigungsfrist auf drei Monate zum Monatsende ein, wenn nicht eine kürzere Frist maßgeblich ist. Dies ist beachtlich, da hierdurch sowohl darüber hinausgehende individualvertragliche, tarifvertragliche als auch gesetzliche Kündigungsfristen nach § 622 Abs. 2 Nr. 4 ff. BGB verkürzt werden.39
Einigkeit besteht in der Literatur darüber, dass neben der zeitlichen Kündigungserleichterung keine weiteren formellen Kündigungserleichterungen gelten sollen. So ist der allgemeine und der spezielle Kündigungsschutz weiterhin anzuwenden.40 Zudem dient die eröffnete Insolvenz nicht als Grundlage für eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB.41
Die Verkürzung der Kündigungsfrist des § 113 S. 2 InsO kann nicht nur durch den Insolvenzverwalter sondern auch durch den Dienstverpflichteten in Anspruch genommen werden. Hierdurch soll dem berechtigten Interesse des Arbeitnehmers Rechnung getragen werden, seine eigene soziale und wirtschaftliche Stellung durch Aufnahme einer neuen Tätigkeit zu sichern, die nicht von einer Insolvenz bedroht ist. Dies gilt unbeachtlich einer dadurch mitunter erschwerten Unternehmensfortführung.42
B.III.2.C Leasingvertrag
Der § 108 Abs. 1S.2 InsO sieht das Fortbestehen von Miet- und Pachtverhältnissen als Masseverbindlichkeit vor, die der Schuldner als Vermieter oder Verpächter eingegangen war und die sonstige Gegenstände betreffen, die einem Dritten, der ihre Anschaffung oder Herstellung finanziert hat, zur Sicherheit übertragen wurden.
Diese anfänglich nicht vorhandene Privilegierung43 wurde erst im Zuge des Gesetzes zur Änderung des AGB-Gesetzes ergänzt.44 Im ursprünglich eingeführten § 108 InsO a.F. wurden sämtliche Miet- und Pachtverträge über sonstige Gegenstände - insbesondere bewegliche Sachen, Rechte und Forderungen45 - abweichend von der vorher geltenden Konkursordnung dem Wahlrecht des Insolvenzverwalters unterstellt.46 Dies führte jedoch zu Problemen bei der insolvenzfesten Ausgestaltung der Refinanzierungsmöglichkeiten für Leasinggeber, sodass für diesen Sonderfall der Miet- und Pachtverträge nachträglich die heute geltende Sondernorm eingeführt wurde.47
Entsprechend eng ist der Umfang der Privilegierung formuliert. So bedarf es zur Sonderstellung neben einer Vermietung oder Verpachtung eines sonstigen Gegenstandes einer Finanzierung durch einen Dritten - insbesondere einer Bank - und einer kausal zusammenhängenden Sicherungsübereignung oder Sicherungsabtretung.48
B.III.2.d Darlehensvertrag
Ebenso sieht § 108 Abs. 2 InsO das Fortbestehen von Darlehensverhältnissen als Masseverbindlichkeit vor, die der Schuldner als Darlehensgeber eingegangen ist, soweit dem Darlehensnehmer der geschuldete Gegenstand zur Verfügung gestellt wurde. Aufgrund des Fehlens weitergehender Einschränkungen des Gegenstandsbegriffs ist hier von einer sehr weitreichenden Begriffsauslegung auszugehen, der sich nicht nur auf Sachen iSd. § 90 BGB beschränkt, sondern auch Rechte und Forderungen umfasst.49
Auch diese Privilegierung war in der ursprünglichen Fassung des § 108 InsO a.F. nicht enthalten und wurde erst mit dem Gesetz zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens eingeführt, um mehr Rechtssicherheit für die Darlehensnehmer zu schaffen, die bisher dem Risiko ausgesetzt waren, bei einer Insolvenz ihres Darlehensgebers und einer Ablehnung des Vertrags durch den Insolvenzverwalter den Darlehensgegenstand zeitnah rückgewähren zu müssen. Der Gesetzgeber sah hierin insbesondere ein Kaskadenrisiko für weitere Zahlungsunfähigkeiten, sollten die Darlehensnehmer nicht in der Lage sein, eine kurzfristige Umschuldung vornehmen zu können. Durch die Sonderregelung soll der Insolvenzverwalter daher daran gehindert werden, eine Vielzahl an Darlehensverträgen beenden zu können.50
B.III.3 Erlöschen bestimmter Schuldverhältnisse
Neben dem erzwungenen Fortbestehen von Schuldverhältnissen sieht die Insolvenzordnung jedoch auch das erzwungene Erlöschen bestimmter Schuldverhältnisse vor - insbesondere auch solcher, die als Dauerschuldverhältnisse strukturiert sein können.
Vom Insolvenzschuldner erteilte Aufträge, die sich auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen beziehen, sollen nach § 115 Abs. 1 InsO mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen. Entsprechendes gilt nach § 116 S. 1 InsO für Geschäftsbesorgungsverträge im Zuge von Dienst- oder Werkverträgen mit Ausnahme von Zahlungsaufträgen, Aufträgen zwischen Zahlungsdienstleistern oder zwischengeschalteten Stellen sowie Aufträgen zur Übertragung von Wertpapieren.
Gemeinsames Ziel dieser Normen ist es, dem Insolvenzverwalter die Sicherung und Verwaltung der Masse zu ermöglichen und Fremdzugriffe zu unterbinden.51 Das Erlöschen der Schuldverhältnisse wird jedoch gemäß der § 115Abs. 2S.lf. InsO und § 116 S. 2 InsO aufgeschoben bis der Insolvenzverwalter Fürsorge für Gefahren treffen konnte, die mit Erlöschen der Schuldverhältnisse entstehen würden. Hier tritt also das alleinige Verwaltungsrecht des Insolvenzverwalters hinter den Schutz der Insolvenzmasse zurück.
B.III.4 Auflösung von Gesellschaften
Auch wenn § 118 InsO mit der Überschrift „Auflösung von Gesellschaften“ überschrieben ist, so regelt er doch nicht den Umgang mit Gesellschaftsverträgen, sondern lediglich die insolvenzrechtliche Behandlung von Forderungen des geschäftsführenden Gesellschafters.
Regelungen zur Auflösung finden sich für die Gesellschaften bürgerlichen Rechts stattdessen im § 728 BGB wieder, wonach die GbR sowohl mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft (§ 728 Abs. 1S.1 BGB) als auch über das Vermögen eines Gesellschafters (§ 728 Abs. 2S.1 BGB) aufgelöst wird.
Ähnliche Regelungen zur Auflösung durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft finden sich auch für die offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft (§ 131 Abs. 1 Nr. 3 HGB iVm. § 161 Abs. 2 HGB), für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Unternehmergesellschaft (§ 60 Abs. 1 Nr. 4 Hs. 1 GmbH) sowie für die Aktiengesellschaft und die Kommanditgesellschaft auf Aktien (§ 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG iVm. § 278 Abs. 3 AktG).
B.III.5 Insolvenzgläubigerschaft und Massegläubigerschaft
Durch das Fortbestehen der in B.III.2 aufgeführten Schuldverhältnisse entsteht eine Auftrennung der Forderungen. Vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstandene Forderungen können die jeweiligen Gläubiger gemäß § 108Abs. 3 InsO nur als Insolvenzgläubiger iSd. § 38 InsO geltend machen. Für Forderungen, die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Zuge des Fortbestehens des Vertragsverhältnisses entstehen, werden sie hingegen als Massegläubiger nach § 53 InsO behandelt. Die privilegierte Behandlung als Massegläubiger gilt ebenso für die Gefahrenminderung beim Erlöschen von Aufträgen und Geschäftsbesorgungsverträgen (§ 115 Abs. 2S.3 InsO iVm. § 116 S. 3 InsO) sowie bei der Fortführung eilbedürftiger Geschäfte im Zuge der Auflösung von Gesellschaften (§ 118 S. 1 InsO).
Während die Behandlung als Insolvenzgläubiger der Gläubigergleichbehandlung dient, stellt die erhöhte wirtschaftliche Sicherheit im Zuge der Behandlung als Massegläubiger einen möglichen Anreiz dafür dar, bestehende und für die Unternehmensfortführung mitunter wesentliche Vertragsverhältnisse aufrecht zu erhalten und dadurch die Insolvenzmasse und die etwaige Unternehmensfortführung vor größeren Gefahren zu bewahren.
B.III.6 Kündigungssperre
Neben der Inzentivierung der Vertragserhaltung sieht der § 112 InsO im Zuge einer Kündigungssperre auch die verpflichtende Vertragserhaltung von Miet- und Pachtverhältnissen vor, die der Insolvenzschuldner als Mieter oder Pächter eingegangen ist. Bei Verzug der Miet- bzw. Pachtentrichtung gilt diese Kündigungssperre für den Zeitraum zwischen dem Eröffnungsantrag und der Insolvenzeröffnung (§ 112 Nr. 1 InsO); für die generelle Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Schuldners gilt siejedoch auch über die Insolvenzeröffnung hinaus (§ 112 Nr. 2 InsO).
Das Ziel des Gesetzgebers ist einerseits zu verhindern, dass bestehende Besitzverhältnisse der Ordnungsfunktion des Insolvenzverfahrens entzogen werden und andererseits die Bemühungen einer Unternehmensfortführung davor zu bewahren, dass relevante Gegenstände zur Unzeit rückgewährt werden müssen.52 Im Gegensatz zu vorhergehenden auf Miet- und Pachtverträge bezogene Sondernormen wird dabei nicht zwischen unbeweglichen und sonstigen Vertragsgegenständen unterschieden.53
B.III.7 Schadensersatzanspruch
Nimmt der Insolvenzverwalter die Möglichkeit zur vorzeitigen Beendigung von Mietoder Pachtverhältnissen oder die Herauslösung privater Wohnräume aus dem Insolvenzverfahren in Anspruch, so fällt dem dadurch betroffenen Vermieter oder Verpächter ein Schadensersatzanspruch zu, den dieser als Insolvenzgläubiger geltend machen kann (§ 109 Abs. 1S.3 InsO). Gleiches gilt für die vorzeitige Beendigung von Dienstverhältnissen (§ 113 S. 3 InsO).
Eine abschließende Regelung zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen in diesen Fällen ist hilfreich, um eine zügige Abwicklung des Insolvenzverfahrens zu gewährleisten.
B.IV Einordnung
Die vom Gesetzgeber getroffene Auswahl der Privilegierung einzelner Dauerschuldverhältnisse im Zuge der Insolvenz ist nicht ohne Probleme. Sie orientiert sich erkennbar an den §§17 ff. KO der abgelösten Konkursordnung, führt durch Anpassungenjedoch zur Verwässerung der zugrundeliegenden Prinzipien.
So unterliegen Dauerschuldverhältnisse grundsätzlich einem Kontinuitätsinteresse beider Parteien,54 das sichjedoch nicht auf eine ausgewählte Untermenge an Vertragsverhältnissen reduzieren lässt. Gerade das Eingehen eines auf Dauer ausgelegten Rechtsverhältnisses setzt ein besonderes Maß an Vertrauen voraus, sowohl generell in die Zuverlässigkeit der Vertragspartei als auch speziell in deren wirtschaftliche Stabilität. Dieses erforderliche Vertrauen dürfte durch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens regelmäßig erschüttert sein.
Während der Gesetzgeber dieses Kontinuitätsinteresse in den §§ 19,22 KO für bestimmte Dauerschuldverhältnisse in solchen Fällen geschützt hatte, in denen den Insolvenzschuldner die finanzielle Verpflichtung traf, führt die weitere Spezialisierung insbesondere des § 108 Abs. 1S.1 InsO zu Problemen bei der Auslegung und praktischen Anwendung.55 Diese dogmatische Schwäche spiegelt sich auch in der nachträglichen Einführung der §§ 108Abs. lS.2,Abs. 2InsO wider, die sich bei Schaffung einer stringenteren Regelung zur Privilegierung bestimmter Rechtsverhältnisse im Zuge der Auslegung hätten ergeben müssen.
Darüber hinaus wäre bei einer Störung der Rechtsbeziehung zu erwarten, dass der Gesetzgeber für die benachteiligte Vertragspartei die Möglichkeit vorsieht, sich vom schädlichen Rechtsverhältnis zu lösen. Während die Konkursordnung noch ein Sonderkündigungsrecht vorsah (§§ 19 S. 1, 22 Abs. 1S.1 KO), hierfür die Kündigungsfrist auf das gesetzliche Maß reduzierte (§§ 19 S. 2, 22 Abs. 1S.2 KO) und nur für den Insolvenzverwalter eine kündigungsbezogene Schadensersatzpflicht vorsah (§§ 19 S. 3, 22 Abs. 2 KO), ist dieses Sonderkündigungsrecht in der Insolvenzordnung entfallen.56 Stattdessen wird die geschädigte Vertragspartei sogar noch dazu gezwungen, am gestörten Rechtsverhältnis festzuhalten - sowohl durch eine Kündigungssperre (§ 112 InsO) als auch durch den Ausschluss vertraglicher Auflösungsbedingungen (§ 119 InsO) - und sich der Gefahr weiterer finanzieller Verluste im Zuge einer Masseunzulänglichkeit auszusetzen. Der gegenseitige Interessenausgleich ist einem einseitigen Werterhalt gewichen.
C Fazit
Wie im Hauptteil dargestellt, nehmen Dauerschuldverhältnisse in der Insolvenz eine Sonderstellung ein. So sind spezifische Vertragsgegenstände vom ansonsten umfassend geltenden Wahlrecht des Insolvenzverwalters ausgenommen, mit dem Ziel der Massesicherung durch Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit.
Darüber hinaus werden die schuldrechtlichen Möglichkeiten der Vertragsgestaltung in der Insolvenz modifiziert, um eine Beendigung existentieller Schuldverhältnisse einerseits zu vermeiden (z.B. im Zuge einer Kündigungssperre) und andererseits deren Beendigung zu beschleunigen, soweit dies der Insolvenzbewältigung zuträglich ist (z.B. durch die Verkürzung von Kündigungsfristen).
Als problematisch erweist sich hierbei jedoch sowohl die sinnvolle Eingrenzung der privilegierten Dauerschuldverhältnisse als auch die Ausbalancierung der Interessen der Vertragsparteien. So stehen die Gläubiger anschließend einer Vertragspartei gegenüber, deren Fortbestehen und Fähigkeit zur weiteren Vertragserfüllung ungewiss ist.
Insbesondere Arbeitnehmer sind bei einer Insolvenz in einer schwierigen Situation. Sie mussten mitunter bereits mehrfach Einschnitte wie verspätet gezahlte Lohn- und Gehaltszahlungen hinnehmen. Zwar werden neu entstehende Entgeltforderungen aus der Masse bedient und bis zu drei Monatsgehälter können über das Insolvenzgeld (§ 165 SGB III) gedeckt werden, doch darüber hinausgehende Entgeltforderungen sind nur noch als Insolvenzgläubiger einforderbar. Zudem werden gerade langjährige Mitarbeiter durch die Verkürzung ihrer Kündigungsfrist auf maximal drei Monate getroffen, während der Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes trotzdem ungewiss bleibt. Hier gilt es abzuwägen, ob dem Arbeitgeber weiteres Vertrauen entgegengebracht oder der Absprung gewagt und eine neue Arbeitsstelle gesucht werden soll. Gerade die mögliche Abwanderung von Leistungsträgern kann hierbei den Unternehmensfortbestand weiter gefährden.
Auch im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Insolvenzverfahren im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie bleibt abzuwarten, ob weitere Anpassungen an der insolvenzrechtlichen Behandlung von Dauerschuldverhältnissen erforderlich sein werden oder ob die bestehenden Regeln ausreichend sind.
Literaturverzeichnis
Braun, Eberhard (Hrsg.)
Insolvenzordnung, 8. Auflage München 2020 (zitiert: Braun/Bearbeiter, InsO, § Rn.).
Creifelds, Carl
Rechtswörterbuch, 23. Auflage München 2019 (zitiert: Creifelds, Rechtswörterbuch, S.).
Hirte, Heribert/Vallender, Heinz (Hrsg.)
Uhlenbruck - Insolvenzordnung, 15. Auflage München 2019 (zitiert: Uhlenbruck/Bearhezter, InsO, § Rn.).
Keller, Ulrich
Insolvenzrecht, 2. Auflage München 2020
(zitiert: Keller, InsR, Rn.).
Köbler, Gerhard
Juristisches Wörterbuch, 17. Auflage München 2018
(zitiert: Köbler, Juristisches Wörterbuch, S.).
Meier, Patrick
Zur Abgrenzung zwischen Dauerschuldverhältnis und Ratenvertrag, ZfPW 2016, 233
(zitiert: Meier, ZfPW 2016, 233).
Nerlich, Jörg / Römermann, Volker (Hrsg.)
Insolvenzordnung, 42. Ergänzungslieferung München 2021
(zitiert: Nerlich/Römermann/Bearhezter, InsO, § Rn.).
Pape, Gerhard
Ablehnung und Erfüllung schwebender Rechtsgeschäfte durch den Insolvenzverwalter, 2. Auflage Münster 2000
(zitiert: Pape, AK InsO Köln, Rn.).
Säcker, Franz Jürgen / Rixecker, Roland / Oetker, Hartmut / Limperg, Bettina (Hrsg.) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, 8. Auflage München 2019
(zitiert: MüKoBGB/Bearhezter, MüKoBGB 2, § Rn.).
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3,
8. Auflage München 2019
(zitiert: MüKoBGB/Bearhezter, MüKoBGB 3, § Rn.).
Statistisches Bundesamt (Hrsg.)
Statistisches Jahrbuch 2017, Wiesbaden 2017
(zitiert: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2017, S.).
Statistisches Jahrbuch 2018, Wiesbaden 2018
(zitiert: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2018, S.).
Statistisches Jahrbuch 2019, Wiesbaden 2019
(zitiert: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2019, S.).
Stürner, Rolf (Hrsg.)
Jauernig - Bürgerliches Gesetzbuch, 18. Auflage München 2021 (zitiert: Jauernig/Bearhezter, Jauernig, § Rn.).
Stürner, Rolf / Eidenmüller, Horst / Schoppmeyer, Heinrich (Hrsg.)
Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, Band 2,
4. Auflage München 2019
(zitiert: MüKoInsO/Bearhezter, MüKoInsO 2, § Rn.).
Rechtsprechungsverzeichnis
Datum
Aktenzeichen
Fundstelle
Bundesgerichtshof
V ZR 86/50
NJW 1951, 836
15.06.1951
Bundesgerichtshof
VIII ZR 218/85
NJW 1986, 3134
26.05.1986
Bundesgerichtshof
IX ZR 53/04
NZI 2008, 36
08.11.2007
Bundesgerichtshof
IX ZR 169/11
NJW 2013, 1159
15.11.2012
[...]
1 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2019, S. 194, 534.
2 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2017, S. 529; Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2018, S. 535; Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2019, S. 537.
3 Creifelds, Rechtswörterbuch, S. 321.
4 BGH, NJW 1951, 836 (836).
5 Meier, ZfPW 2016, 233 (235).
6 BT-Drucks. 7/3919, S. 5 ff.;
BGBl. 1976 I, S. 3318;
MüKoBGB/Gazer, MüKoBGB 3, § 314 Rn. 6.
7 BT-Drucks. 14/6040, S. 177;
MüKoBGB/Gazer, MüKoBGB 3, § 314 Rn. 6;
Meier, ZfPW 2016, 233 (235).
8 BT-Drucks. 14/6040, S. 176 f.
9 Meier, ZfPW 2016, 233 (243).
10 Meier, ZfPW 2016, 233 (235 ff.).
11 Jauernig/Stad/er, Jauemig, § 308 Rn. 5;
MüKoBGB/Wurmnest, MüKoBGB 2, § 308 Rn. 8.
12 MüKoBGB/Finkenauer, MüKoBGB 3, § 313 Rn. 169 ff.
13 Jauernig/Sfad/er, Jauemig, § 313 Rn. 12.
14 BT-Drucks. 14/6040, S. 176.
15 BT-Drucks. 14/6040, S. 177.
16 BGH, NJW 1951, 836 (836).
17 BGH, NJW 1986, 3134 (3134).
18 Keller, InsR, Rn. 1217.
19 Pape, AK InsO Köln, Rn. 8.
20 Pape, AK InsO Köln, Rn. 3.
21 Pape, AK InsO Köln, Rn. 38.
22 BGH, NJW 2013, 1159 (1160).
23 BGH, NZI 2008, 36 (37); Braun/Krotb, InsR, § 103 Rn. 39; MüKoInsO/Huber, MüKoInsO 2, § 103 Rn. 150.
24 MüKoInsO/Huber, MüKoInsO 2, § 103 Rn. 151.
25 Nerlich/Römermaim/Ba/t/iasar, InsO, § 108 Rn. 6; Uhlenbruck/Wegener, InsO, § 108 Rn. 2.
26 BT-Drucks. 12/7302, S. 44 (aufgrund noch durchzuführender Streichungen und Einfügungen von Paragraphen ist der § 108 InsO hier noch als § 122 InsO aufgeführt).
27 BT-Drucks. 16/4194, S. 7.
28 Uhlenbruck/Wegener, InsO, § 108 Rn. 16.
29 N.üKoInsO/Eckert/Hoffmann, MüKoInsO 2, § 108 Rn. 50.
30 Nerlich/Römermann/Ba/tkasar, InsO, § 108 Rn. 8.
31 BT-Drucks. 14/6468, S. 7; BT-Drucks. 14/5680, S. 27;
N.üKoInsO/Eckert/Hoffmann, MüKoInsO 2, § 109 Rn. 7.
32 N.üKoInsO/Eckert/Hoffmann, MüKoInsO 2, § 111 Rn. 27.
33 MtiKoLnsO/Eckert/Hoffmann, MüKoInsO 2, § 111 Rn. 2;
Nerlich/Römermann/Baltbasar, InsO, § 111 Rn. 2, 7.
34 N.üKoInsO/Eckert/Hoffmann, MüKoInsO 2, § 111 Rn. 19 ff.
35 N.üKoInsO/Eckert/Hoffmann, MüKoInsO 2, § 108 Rn. 115; Nerlich/Römermann/Ba/t/iasar, InsO, § 108 Rn. 10; Uhlenbruck/Ries, InsO, § 108 Rn. 46.
36 Creifelds, Rechtswörterbuch, S. 345; Köbler, Juristisches Wörterbuch, S. 103.
37 Nerlich/Römermann/Hamacber, InsO, § 113 Rn. 5.
38 BT-Drucks. 12/2443, S. 148 (aufgrund noch durchzuführender Streichungen und Einfügungen von Paragraphen ist der § 113 InsO hier noch als § 127 InsO aufgeführt); Nerlich/Römermann/Hamacber, InsO, § 113 Rn. 3.
39 MüKoInsO/Caspers, MüKoInsO 2, § 113 Rn. 25 ff.
40 MüKoInsO/Caspers, MüKoInsO 2, § 113 Rn. 2, 19 ff.; Nerlich/Römermann/Hamacher, InsO, Vorbemerkung vor § 113 Rn. 5; Nerlich/Römermann/Hamacher, InsO, § 113 Rn. 243 ff.
41 Nerlich/Römermann/Hamacher, InsO, § 113 Rn. 13.
42 BT-Drucks. 12/2443, S. 148 f. (aufgrund noch durchzuführender Streichungen und Einfügungen von Paragraphen ist der § 113 InsO hier noch als § 127 InsO aufgeführt).
43 BT-Drucks. 12/7302, S. 44 (aufgrund noch durchzuführender Streichungen und Einfügungen von Paragraphen ist der § 108 InsO hier noch als § 122 InsO aufgeführt).
44 BT-Drucks. 13/4699 ,S. 4.
45 Nerlich/Römermann/Balthasar, InsO, § 108 Rn. 12.
46 BT-Drucks. 12/2443, S. 146 (aufgrund noch durchzuführender Streichungen und Einfügungen von Paragraphen ist der § 113 InsO hier noch als § 127 InsO aufgeführt).
47 BT-Drucks. 13/4699, S. 2, 6;
Pape, AK InsO Köln, Rn. 3, 39, 57.
48 Nerlich/Römermann/Balthasar, InsO, § 108 Rn. 13 f.
49 Uhlenbruck/Wegener, InsO, § 108 Rn. 61 f.
50 BT-Drucks. 16/4194, S. 7; BT-Drucks. 16/3227, S. 19.
51 BT-Drucks. 12/2443, S. 151 (aufgrund noch durchzuführender Streichungen und Einfügungen von Paragraphen sind die § 115, 116 InsO hier noch als §§ 133, 134 InsO aufgeführt); MüKoInsO/Vuia, MüKoInsO 2, § 115 Rn. 1; MüKoInsO/Vuia, MüKoInsO 2, § 116 Rn. 1; Nerlich/Römermann/K/eß/ier, InsO, § 115 Rn. 2 f.; Nerlich/Römermann/K/eß/ier, InsO, § 116 Rn. 2.
52 BT-Drucks. 12/2443, S. 148 (aufgrund noch durchzuführender Streichungen und Einfügungen von Paragraphen ist der § 112 InsO hier noch als § 127 InsO aufgeführt); Nerlich/Römermann/Balthasar, InsO, § 112 Rn. 4; Uhlenbruck/Wegener, InsO, § 112 Rn. 2.
53 Nerlich/Römermann/Baltbasar, InsO, § 112 Rn. 9;
Uhlenbruck/Wegener, InsO, § 112 Rn. 3.
54 MüKoInsO/Ho/jfmann, MüKoInsO 2, § 108 Rn. 3.
55 MüKoInsO/Hoffmann, MüKoInsO 2, § 108 Rn. 51 f.; Pape, AK InsO Köln, Rn. 39.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Dauerschuldverhältnis?
Ein Dauerschuldverhältnis ist ein auf Dauer angelegtes Schuldverhältnis, bei dem ein Gläubiger wiederkehrend eine Leistung oder ein Unterlassen von einem Schuldner fordern kann. Es kann eine festgelegte Laufzeit haben oder auch ohne Laufzeit vereinbart werden. Es zeichnet sich dadurch aus, dass während der Laufzeit ständig neue Leistungs- und Schutzpflichten entstehen und dem Zeitelement eine wesentliche Bedeutung zukommt.
Wie werden Dauerschuldverhältnisse schuldrechtlich behandelt (außerhalb der Insolvenz)?
Außerhalb der Insolvenz gibt es spezielle Regelungen für Dauerschuldverhältnisse, beispielsweise im Hinblick auf Rücktrittsvorbehalte, Laufzeiten, Störung der Geschäftsgrundlage und Kündigung aus wichtigem Grund. § 308 Nr. 3 BGB erlaubt einen Rücktrittsvorbehalt in AGB für Dauerschuldverhältnisse. § 309 Nr. 9 BGB legt Anforderungen an die Laufzeit und Verlängerung von Dauerschuldverhältnissen fest. Bei Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) kann ein Kündigungsrecht an die Stelle des Rücktrittsrechts treten. Dauerschuldverhältnisse können aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden (§ 314 BGB).
Welche Rolle spielt das Insolvenzrecht bei Dauerschuldverhältnissen?
Das Insolvenzrecht modifiziert die Behandlung von Dauerschuldverhältnissen erheblich. Der Insolvenzverwalter hat grundsätzlich ein Wahlrecht (§ 103 InsO), ob er gegenseitige Verträge erfüllen oder ablehnen will. Allerdings gibt es Einschränkungen dieses Wahlrechts, insbesondere hinsichtlich bestimmter Dauerschuldverhältnisse (Miet- und Pachtverhältnisse, Dienstverhältnisse, Leasingverträge, Darlehensverträge), die unter bestimmten Umständen als Masseverbindlichkeiten fortbestehen (§§ 108 ff. InsO).
Welche Dauerschuldverhältnisse bestehen im Insolvenzfall fort?
Gemäß § 108 InsO bestehen folgende Dauerschuldverhältnisse als Masseverbindlichkeiten fort: Miet- und Pachtverhältnisse über unbewegliche Gegenstände oder Räume (§ 108 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 InsO), Dienstverhältnisse (§ 108 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 InsO), Miet- und Pachtverhältnisse, die der Schuldner als Vermieter eingegangen war und die Gegenstände betreffen, die einem Dritten zur Sicherheit übertragen wurden (§ 108 Abs. 1 S. 2 InsO), sowie Darlehensverhältnisse, die der Schuldner als Darlehensgeber eingegangen ist (§ 108 Abs. 2 InsO).
Welche Dauerschuldverhältnisse erlöschen im Insolvenzfall?
Aufträge des Insolvenzschuldners, die sich auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen beziehen, erlöschen mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 115 InsO). Entsprechendes gilt für Geschäftsbesorgungsverträge (§ 116 InsO), jedoch mit Aufschub, bis der Insolvenzverwalter die nötigen Fürsorgemaßnahmen treffen konnte. Außerdem werden Gesellschaften durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst (vgl. § 728 BGB für die GbR und ähnliche Regelungen für andere Gesellschaftsformen).
Was ist der Unterschied zwischen Insolvenzgläubigern und Massegläubigern bei Dauerschuldverhältnissen?
Forderungen aus Dauerschuldverhältnissen, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, können nur als Insolvenzgläubiger geltend gemacht werden (§ 38 InsO). Forderungen, die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Zuge des Fortbestehens des Vertragsverhältnisses entstehen, werden als Massegläubiger behandelt (§ 53 InsO). Massegläubiger haben eine privilegierte Stellung, da ihre Forderungen vor den Forderungen der Insolvenzgläubiger bedient werden.
Was bedeutet die Kündigungssperre im Insolvenzrecht?
§ 112 InsO sieht eine Kündigungssperre für Miet- und Pachtverhältnisse vor, die der Insolvenzschuldner als Mieter oder Pächter eingegangen ist. Dies soll verhindern, dass bestehende Besitzverhältnisse der Ordnungsfunktion des Insolvenzverfahrens entzogen werden und die Bemühungen einer Unternehmensfortführung gefährdet werden. Die Kündigungssperre gilt sowohl für den Zeitraum zwischen dem Eröffnungsantrag und der Insolvenzeröffnung als auch bei genereller Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Schuldners.
Welche Schadensersatzansprüche entstehen im Zusammenhang mit Dauerschuldverhältnissen in der Insolvenz?
Wenn der Insolvenzverwalter von der Möglichkeit zur vorzeitigen Beendigung von Miet- oder Pachtverhältnissen Gebrauch macht (§ 109 InsO) oder Dienstverhältnisse vorzeitig beendet (§ 113 InsO), entsteht dem betroffenen Vermieter, Verpächter oder Arbeitnehmer ein Schadensersatzanspruch, den dieser als Insolvenzgläubiger geltend machen kann. Dies dient der zügigen Abwicklung des Insolvenzverfahrens.
- Quote paper
- Kevin Niehage (Author), 2021, Dauerschuldverhältnisse in der Insolvenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181159