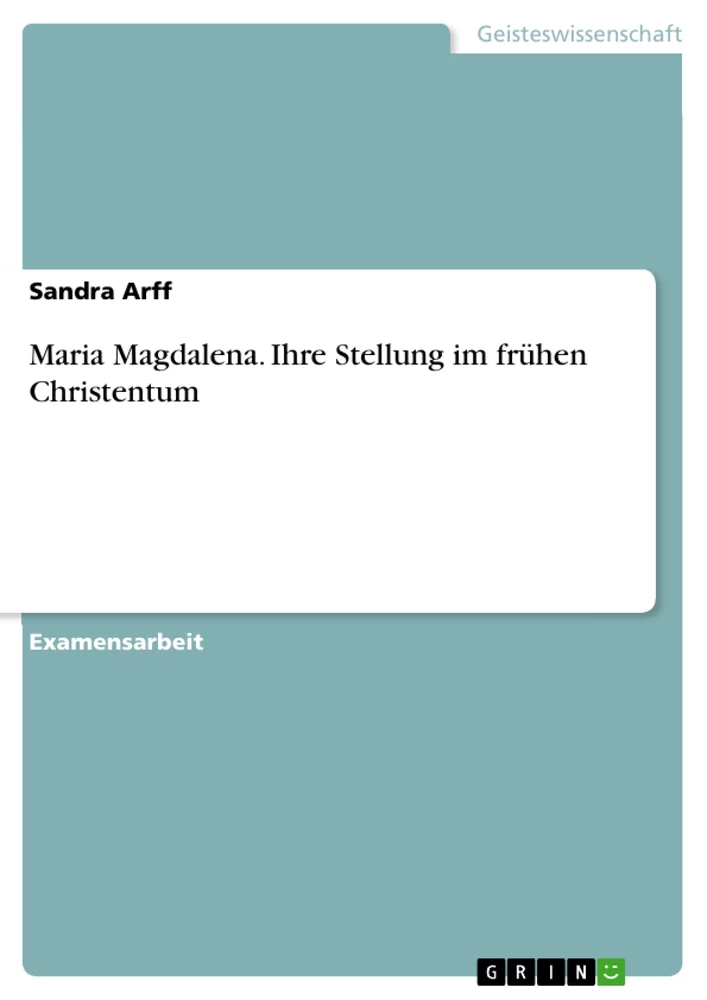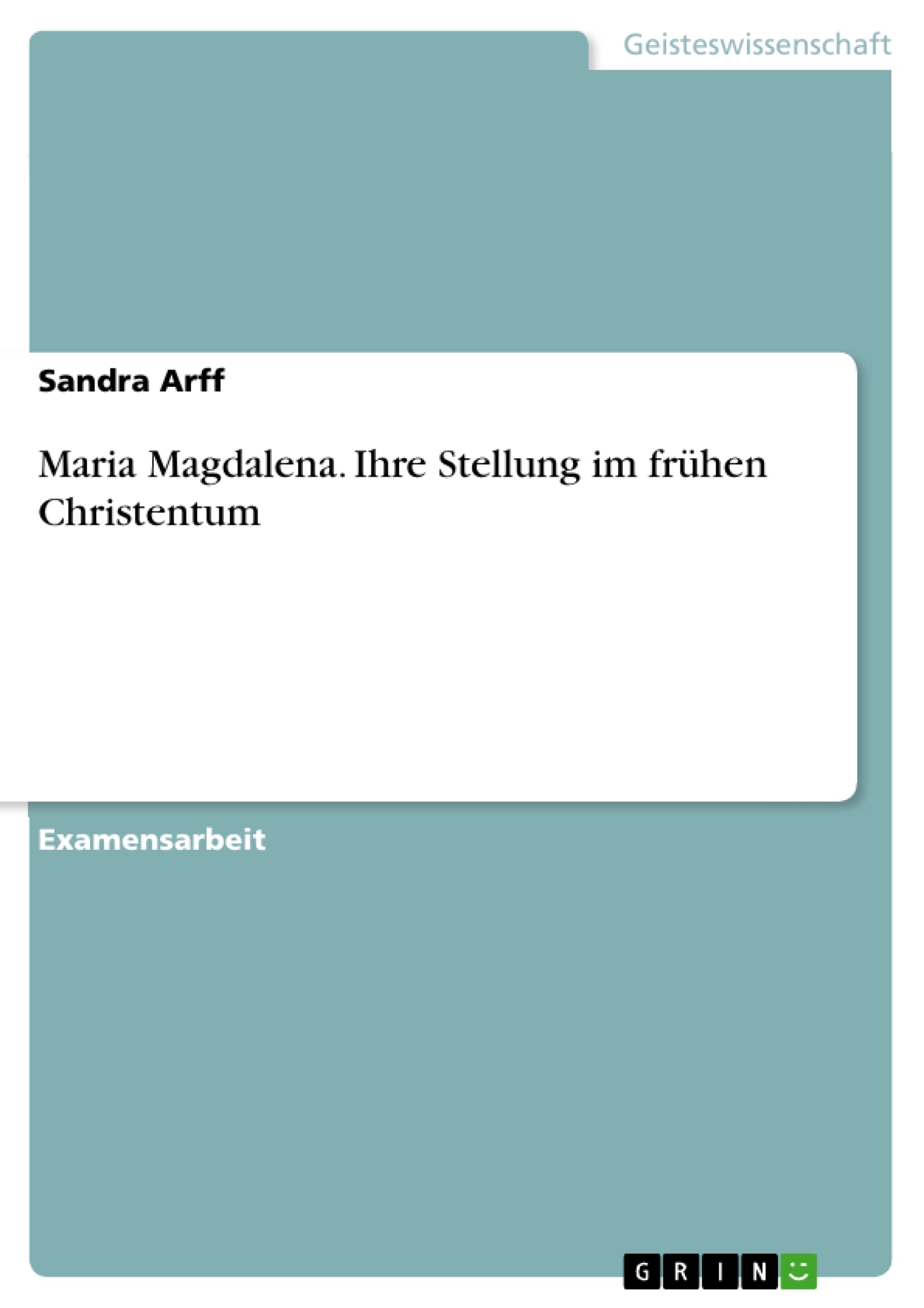Die Figur der Maria Magdalena übt bis heute eine große Faszination aus. Neben der Mutter Jesu, ist sie die wichtigste Frau in der frühchristlichen Literatur. Alle vier neutestamentlichen Evangelisten erwähnen sie und auch in den apokryphen und gnostischen Schriften wird ihr Name genannt oder sie tritt selber auf. Die urchristlichen Überlieferungen über Maria Magdalena sind bis heute jedoch spärlich und zufällig. Biografische Daten zu ihrer Person lassen sich kaum noch rekonstruieren. Trotzdem lässt sich noch einiges über ihre Stellung in der Jesusbewegung und in den frühchristlichen Gemeinden aus den Quellen herauslesen. In den neutestamentlichen Evangelien nimmt sie eine Sonderstellung in der Urgemeinde ein. Sie muss verstanden werden als Jüngerin Jesu, die ihn auf seinem Weg begleitete (vgl. Mk 15,41; Mt 27,55f.; Lk 8,1-3; Joh 20,16), als Auferstehungszeugin (vgl. Mt 28,9; Joh 20,14-18) und als apostolische Autorität (Joh 20,14-18). In den gnostischen und apokryphen Quellen nimmt Maria ebenfalls eine Sonderstellung ein. Sie wird erwähnt im Thomasevangelium (EvTh Log 22, Log 114), im vermutlich nach ihr benannten Evangelium der Maria (EvMar (BG) 9,5-17,7; 17,7- 19,5), im Philippusevangelium (EvPhil §32, §55), in der Pistis Sophia (PS I-III; IV), in der Sophia Jesu Christi (SJC 98,9-100,16; 114,8-119,8), im Dialog des Erlösers (Dial 126,17-127,19; 131,19-132,5;141,12-14;142,19-21;143,6-10) und in den Großen und Kleinen Fragen der Maria bei Epiphanius (Pan. 26,8,1-3).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Prämissen
- 1. Zur Überlieferung und Entstehung der neutestamentlichen Evangelien
- 2. Der Sitz im Leben
- 3. Der geographische und soziale Rahmen
- II. Maria Magdalena im Neuen Testament
- 1. Maria Magdalena im Markusevangelium
- 2. Maria Magdalena im Matthäusevangelium
- 3. Maria Magdalena im Lukasevangelium
- 4. Maria Magdalena im Johannesevangelium
- 5. Ergebnis: Die Stellung der Maria Magdalena im Neuen Testament
- III. Maria Magdalena in den apokryphen Evangelien
- 1. Zu dem Begriff der apokryphen Evangelien
- 2. Das Evangelium nach Maria
- 3. Maria Magdalena im Thomasevangelium
- 4. Die Stellung der Maria Magdalena in den apokryphen Evangelien
- IV. Ergebnis: Die Stellung der Maria Magdalena im frühen Christentum
- V. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stellung Maria Magdalenas im frühen Christentum. Ziel ist es, ihre Rolle in den neutestamentlichen und apokryphen Evangelien zu analysieren und ihre Bedeutung für die frühchristliche Gemeinde zu beleuchten. Die Arbeit stützt sich auf eine Auswertung der relevanten Quellen und berücksichtigt den aktuellen Forschungsstand.
- Maria Magdalenas Rolle als Zeugin der Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung Jesu.
- Der Vergleich ihrer Darstellung in den synoptischen und johanneischen Evangelien.
- Die Interpretation ihrer Figur in den apokryphen Evangelien, insbesondere im Evangelium nach Maria und im Thomasevangelium.
- Die Entwicklung des Bildes von Maria Magdalena im Laufe der frühchristlichen Geschichte.
- Die Frage nach der Bedeutung und dem Einfluss von Maria Magdalena auf die frühchristlichen Gemeinden.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Faszination, die die Figur der Maria Magdalena bis heute ausübt. Sie unterstreicht die spärlichen und zufälligen urchristlichen Überlieferungen und die Schwierigkeit, biografische Daten zu rekonstruieren. Die Einleitung betont jedoch die Möglichkeit, aus den Quellen Erkenntnisse über ihre Stellung in der Jesusbewegung und den frühchristlichen Gemeinden zu gewinnen und deutet ihre Sonderstellung als Jüngerin, Auferstehungszeugin und apostolische Autorität an, sowohl im Neuen Testament als auch in gnostischen und apokryphen Schriften. Ein Forschungsüberblick wird kurz skizziert.
I. Prämissen: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die folgende Analyse. Es beleuchtet die Überlieferung und Entstehung der neutestamentlichen Evangelien, betrachtet den Sitz im Leben und den geographischen und sozialen Rahmen, um das Verständnis der Quellenlage zu verbessern und den Kontext von Maria Magdalenas Leben zu klären. Der Abschnitt über Magdala als Stadt und die Bedeutung des Namens Maria versucht, ihre Umgebung und Identität besser zu verstehen.
II. Maria Magdalena im Neuen Testament: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung Maria Magdalenas in den vier kanonischen Evangelien. Es untersucht ihre Rolle als Zeugin der Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung, wobei die jeweiligen Besonderheiten jedes Evangeliums herausgestellt werden. Die Kapitel vergleichen die Beschreibungen und beleuchten die unterschiedlichen Schwerpunkte der Evangelisten. Die Zusammenfassung jedes Evangeliums fasst die jeweilige Rolle Maria Magdalenas zusammen und betont ihre Bedeutung für die jeweilige Erzählung. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Darstellung ihrer Person und ihren Taten.
III. Maria Magdalena in den apokryphen Evangelien: Dieses Kapitel widmet sich der Betrachtung Maria Magdalenas in apokryphen Schriften. Es definiert zunächst den Begriff der apokryphen Evangelien. Die Analyse konzentriert sich auf das Evangelium nach Maria und das Thomasevangelium. Es werden die Entstehung und Überlieferung der Texte erörtert, um die historische Einordnung zu ermöglichen. Die Rolle Maria Magdalenas als Jüngerin, Stellvertreterin Jesu und Lehrerin wird analysiert. Insbesondere wird der Kontrast zwischen der Darstellung im Neuen Testament und den apokryphen Texten hervorgehoben, und es werden die verschiedenen Interpretationen ihrer Person diskutiert.
Schlüsselwörter
Maria Magdalena, Frühchristentum, Evangelien, Apokryphe Evangelien, Jüngerin, Zeugin, Auferstehung, Neues Testament, Frauen in der Bibel, Gnostizismus, Thomasevangelium, Evangelium nach Maria, apostolische Autorität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Stellung der Maria Magdalena im frühen Christentum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Maria Magdalena im frühen Christentum, indem sie ihre Darstellung in den neutestamentlichen und apokryphen Evangelien analysiert und ihre Bedeutung für die frühchristliche Gemeinde beleuchtet. Sie basiert auf einer Auswertung der relevanten Quellen und berücksichtigt den aktuellen Forschungsstand.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die neutestamentlichen Evangelien (Markus, Matthäus, Lukas, Johannes) und ausgewählte apokryphe Evangelien, insbesondere das Evangelium nach Maria und das Thomasevangelium. Die Analyse berücksichtigt die Überlieferungsgeschichte und den Entstehungskontext dieser Texte.
Welche Aspekte von Maria Magdalenas Rolle werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Maria Magdalenas Rolle als Zeugin der Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung Jesu. Sie vergleicht ihre Darstellung in den synoptischen und johanneischen Evangelien und analysiert ihre Interpretation in den apokryphen Evangelien. Ein weiterer Fokus liegt auf der Entwicklung ihres Bildes im Laufe der frühchristlichen Geschichte und ihrer Bedeutung und Einfluss auf die frühchristlichen Gemeinden. Die Frage nach ihrer apostolischen Autorität wird ebenfalls thematisiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den Prämissen (Überlieferung der Evangelien, Sitz im Leben, geographischer und sozialer Rahmen), ein Kapitel zu Maria Magdalena im Neuen Testament (Analyse der vier Evangelien), ein Kapitel zu Maria Magdalena in den apokryphen Evangelien (mit Fokus auf dem Evangelium nach Maria und dem Thomasevangelium) und abschließend ein Kapitel mit den Ergebnissen zur Stellung Maria Magdalenas im frühen Christentum. Zusätzlich enthält die Arbeit ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, Angaben zur Zielsetzung und zu den Themenschwerpunkten sowie Schlüsselwörter.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
(Diese Frage kann erst nach Lektüre der vollständigen Arbeit beantwortet werden. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt jedoch bereits einen Vorgeschmack auf die Ergebnisse.) Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild von Maria Magdalenas Rolle im frühen Christentum zu zeichnen, indem sie die verschiedenen Darstellungen in den kanonischen und apokryphen Texten vergleicht und interpretiert. Sie beleuchtet dabei sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede und diskutiert die jeweilige Bedeutung im Kontext der frühchristlichen Gemeinden.
Welche Bedeutung hat die Stadt Magdala für die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Magdala als Stadt und den möglichen Einfluss des Namens "Maria" auf das Verständnis von Maria Magdalenas Umfeld und Identität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Maria Magdalena, Frühchristentum, Evangelien, Apokryphe Evangelien, Jüngerin, Zeugin, Auferstehung, Neues Testament, Frauen in der Bibel, Gnostizismus, Thomasevangelium, Evangelium nach Maria, apostolische Autorität.
- Quote paper
- Sandra Arff (Author), 2007, Maria Magdalena. Ihre Stellung im frühen Christentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118068