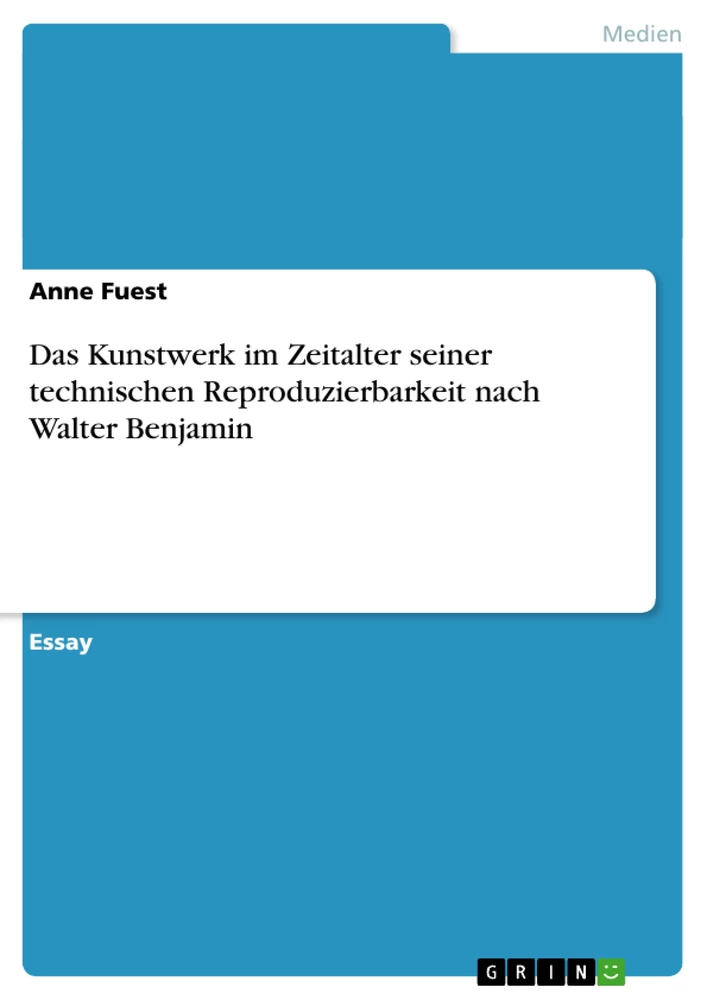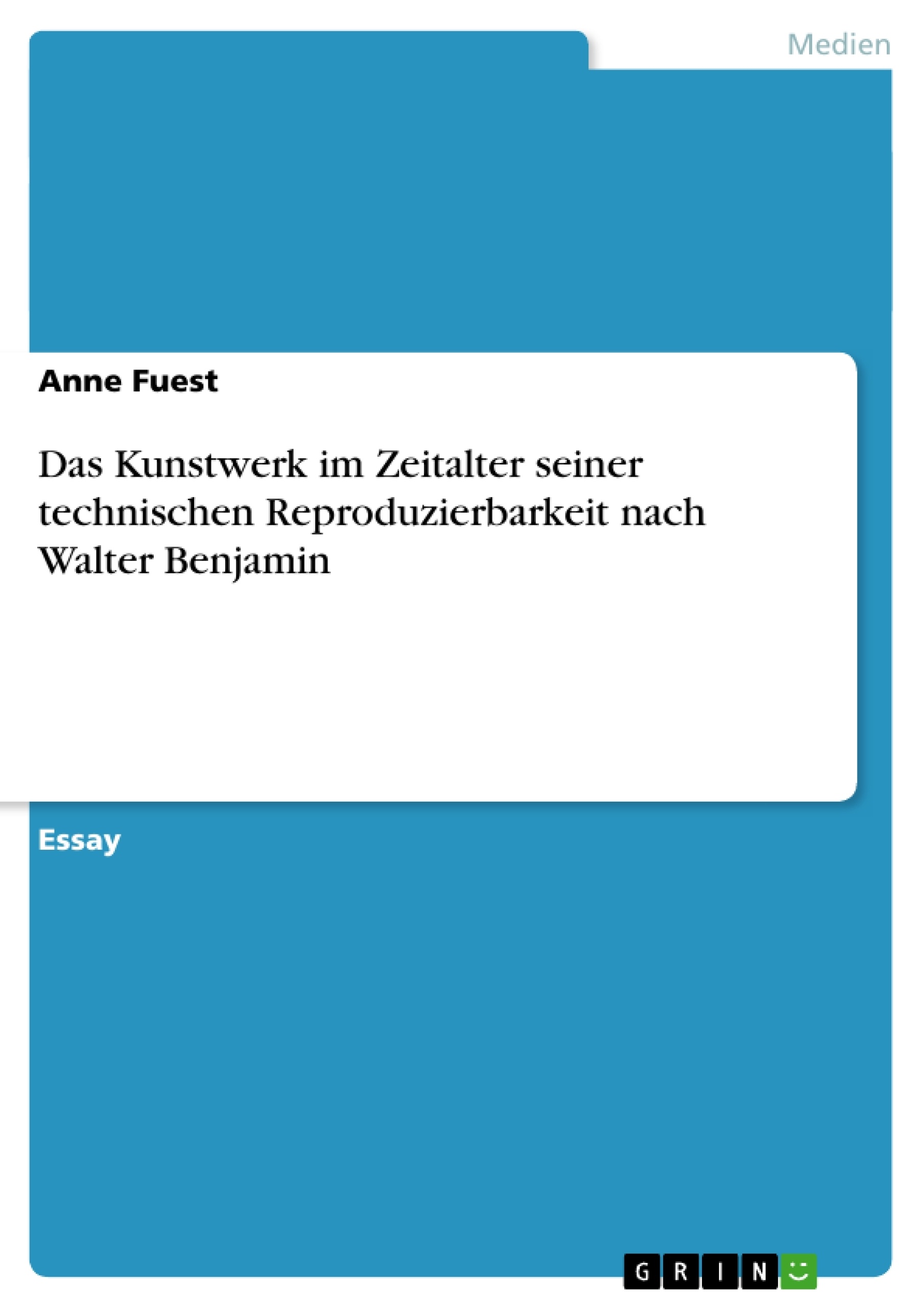In diesem Feedbackpaper möchte ich die Thesen von Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit herausarbeiten. Zunächst
werde ich kurz auf die Person Walter Benjamin eingehen, bevor ich im Hauptteil Benjamins
Thesen anhand der im Aufsatz verwendeten Schlüsselbegriffe darstelle. Nach einer
abschließenden Zusammenfassung möchte ich mich noch kritisch mit den Thesen
auseinandersetzen. Dabei werde ich überprüfen, ob Benjamins Thesen im historischen
Zusammenhang schlüssig sind.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Hauptteil
2.1 Kurzbiografie Walter Benjamin
2.2 Vorgehensweise von Walter Benjamin
2.3 Reproduktion
2.4 Echtheit, Aura, Masse
2.5 Film Zerstreuung
2.6 Zusammenfassung
3 Kritik an Walter Benjamins Thesen
4 Ausblick
5 Bibliografie
6 Internetquellen
1 Einleitung
In diesem Feedbackpaper möchte ich die Thesen von Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit herausarbeiten. Zunächst werde ich kurz auf die Person Walter Benjamin eingehen, bevor ich im Hauptteil Benjamins Thesen anhand der im Aufsatz verwendeten Schlüsselbegriffe darstelle. Nach einer abschließenden Zusammenfassung möchte ich mich noch kritisch mit den Thesen auseinandersetzen. Dabei werde ich überprüfen, ob Benjamins Thesen im historischen Zusammenhang schlüssig sind.
2 Hauptteil
2.1 Kurzbiografie Walter Benjamin
Walter Benjamin wird am 15. Juli 1892 in Berlin-Charlottenburg geboren. Seine Familie gehört dem assimilierten Judentum an. Nach dem Abitur 1912 beginnt Benjamin sein Studium der Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte in Freiburg, München und Berlin. 1917 heiratet Benjamin Dora Keller. Die Ehe hält 13 Jahre. Am 11. April 1918 kommt der gemeinsame Sohn, Stefan Rafael, zur Welt. 1919 promoviert Walter Benjamin in Bern bei Richard Herbertz mit einer Arbeit über den Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Anschließend kehrt er zurück nach Berlin, wo er sich als freier Schriftsteller und Publizist selbständig macht.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten zwingt Benjamin, im März 1933 nach Paris ins Exil zu gehen. Während seiner Zeit im Exil arbeitet Benjamin vor allem an seinem Fragment gebliebenen Passagen-Werk. Außerdem verfasste er den Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1936 in der Zeitschrift für Sozialforschung und Studien zu Baudelaire.
Nach der Rückkehr aus der Haft im November 1939 schreibt Benjamin seinen letzten Text, die Thesen Über den Begriff der Geschichte. Am 26. September 1940 begeht Benjamin in Port Bou Selbstmord.[1]
2.2 Vorgehensweise von Walter Benjamin
Walter Benjamin präsentiert uns mit seinem Auszug aus seinem Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von 1936 einen insgesamt medienfreundlichen Text, welcher sich mit Kunst und Reproduzierbarkeit auseinandersetzt. Benjamin stellt den als negativ zu bewertenden Auraverlust der Kunst der unstrittig als positiv zu bewertenden Zugänglichkeit der Kunst für die Massen gegenüber. Diese Partizipationsidee als eine typische Vorstellung der politisch Linken lässt auf den Hintergrund des Schreibers schließen, die Reichweite des Textes geht allerdings weit darüber hinaus. Der wegen seiner demokratischen Ideen zur Kommunikation und Aktivierung beziehungsweise Aufklärung der Massen für die Medientheorie relevante Text beschäftigt sich mit den visuellen Medien Film und Fotografie und in diesem Zusammenhang mit dem Konzept der technischen Reproduzierbarkeit. Benjamin stellt die in den Massenmedien innewohnende Logik der Reproduktion heraus und erklärt deren Wichtigkeit. Den Textgestus charakterisierten wir im Seminar als theoretisch-distanziert. Besonders bemerkenswert ist Benjamins positiver Massenbegriff, den er in diesem - im Exil geschriebenen - Text trotz des Volksempfängers als Nazi-Massenmedium entwickelt.
2.3 Reproduktion
Gleich zu Beginn seines Aufsatzes weist Walter Benjamin daraufhin, dass das Kunstwerk, grundsätzlich immer reproduzierbar gewesen sei.[2] Im Weiteren stellt Benjamin einen geschichtlichen Abriss verschiedener Verfahren der Reproduktion dar. Während die Griechen nur zwei Reproduktionsverfahren von Kunstwerken kannten, den Guss und die Prägung, bei denen die Möglichkeiten zur Massenreproduktion noch begrenzt waren, so führten Holzschnitt und Lithographie bis hin zum Tonfilm jeweils zu Quantensprüngen bezüglich der Reproduktionsfähigkeit. Während das historische Kunstwerk in seinem Wesen und Wirken durch die manuelle Reproduktion bisher unberührt blieb, tritt nun ein radikaler Wandeln ein. Die technische Reproduktion zeichnet sich durch mehr Selbständigkeit gegenüber dem Original aus. Sie ist perspektivenreicher und in der Lage „[…] das Abbild des Originals in Situationen zu bringen, die dem Original selbst nicht erreichbar sind.“[3] Die Zeitlupe bietet beispielsweise die Möglichkeit Bilder festzuhalten „[…] die sich der natürlichen Optik schlechtweg entziehen.“[4] Im weiteren Verlauf geht Benjamin auf die sich ergebenden Manipulationsmöglichkeiten der Wirklichkeit ein, sowie auf die Funktion der technischen Reproduktion hinsichtlich des Zusammenwachsens von Wissenschaft und Kunst.
[...]
[1] Vgl.: http://www.suhrkamp.de/autoren/autor.cfm?id=301 vom 05.11.2007.
[2] Vgl.: Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 1974. S. 474.
[3] Ebenda. S. 476.
[4] Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 1974. S. 476.
- Quote paper
- Anne Fuest (Author), 2008, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit nach Walter Benjamin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117864