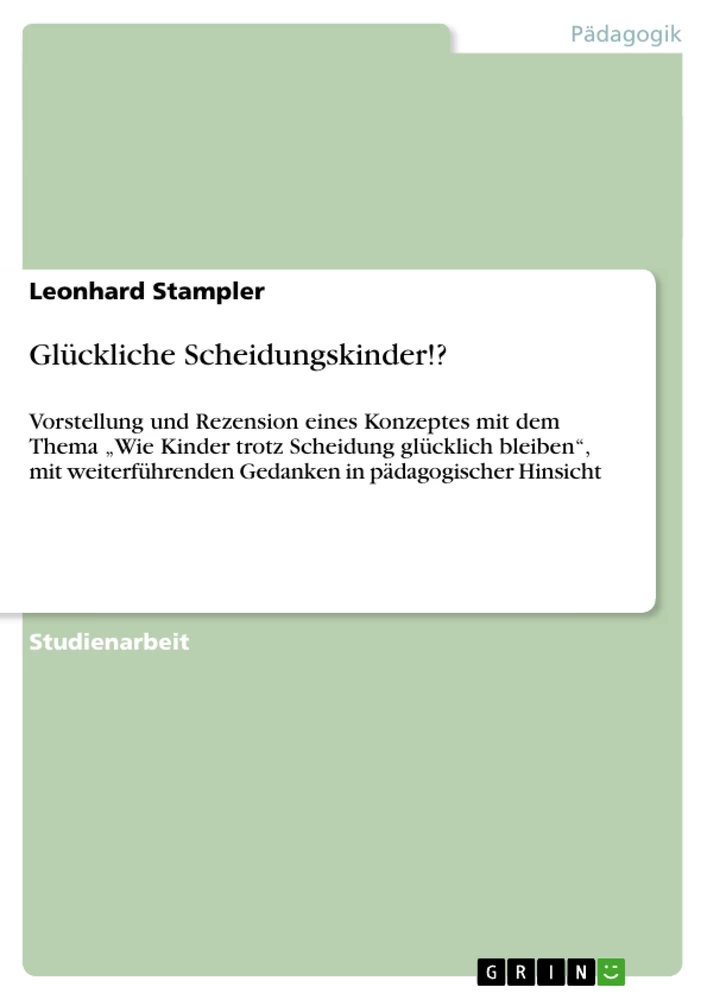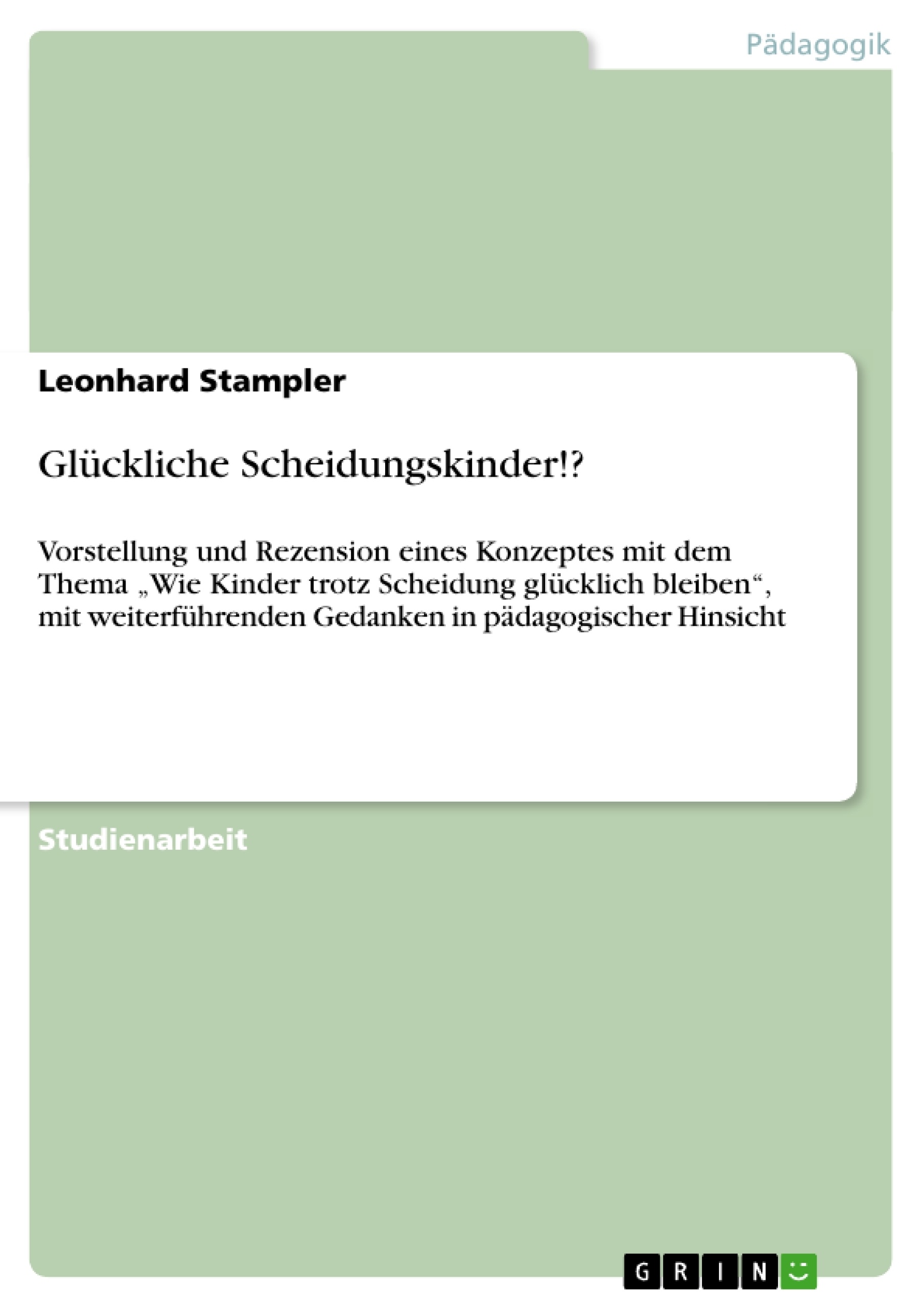Diese Arbeit setzt sich zum Ziel aufzuzeigen, wie Kinder in den Phasen vor einer Trennung, während der Trennung und auch nach der Trennung behandelt werden müssen, damit die Trennung nicht zu einem schmerzhaften Erlebnis wird. Es soll aufgezeigt werden, was Eltern tun müssen um ihrem Kind das Gefühl zu vermitteln, eine Trennung bedeutet nicht, sich von den Eltern und deren Zuwendung verabschieden zu müssen. Ein Abschied vom bisherigen Familienleben soll erleichtert werden und den Kindern das Gefühl gegeben werden, dass das Leben in einer neuen familiären Situation nicht bedeutet, dass von einem Elternteil weniger Zuwendung erfahren werden muss. Basis dieser Arbeit ist der Ratgeber von Remo H. Largo und Monika Czernin unter dem Titel „Glückliche Scheidungskinder“.
Diese Arbeit wird nicht unkritisch die Gedanken der beiden Autoren wiedergeben, sondern versuchen, im Ratgeber ungeklärten Fragen nachzugehen und die Gedanken der beiden Autoren weiterzudenken. Weiters beinhaltet diese Arbeit, da in einem pädagogischen Kontext verfasst, den Versuch einer Conclusio für PädagogInnen, d.h. sie wird versuchen aufzuzeigen, was nun anhand der Gedanken von Largo und Czernin eine Pädagogin oder ein Pädagoge konkret tun können und wie in der Klasse mit Kindern die Trennungserfahrungen machen oder gemacht haben umzugehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Glückliche Scheidungskinder
- 2.1 Grundgedanken zum Buch
- 2.2 Zum Zeitpunkt der Trennung
- 2.2.1 Wie sagen wir es unseren Kindern?
- 2.2.2 Was verstehen Kinder unter Liebe, Ehe, Trennung?
- 2.3 Der Alltag nach der Trennung
- 2.4 Getrennt leben - gemeinsam erziehen
- 2.5 Die Vielfalt der Familienformen
- 3 Conclusio für PädagogInnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert den Ratgeber „Glückliche Scheidungskinder“ von Remo H. Largo und Monika Czernin und untersucht, wie Kinder die Trennung ihrer Eltern bestmöglich bewältigen können. Der Fokus liegt auf der Unterstützung von Kindern vor, während und nach der Trennung, um schmerzhafte Erlebnisse zu vermeiden und das Gefühl der elterlichen Zuwendung zu erhalten. Die Arbeit erweitert die Gedanken der Autoren und bietet konkrete Handlungsempfehlungen für PädagogInnen im Umgang mit betroffenen Kindern.
- Entwicklungspsychologischer Ansatz der Bedürfnisbefriedigung bei Kindern
- Kommunikation mit Kindern zum Thema Trennung und Scheidung
- Der Alltag der Kinder nach der Trennung der Eltern
- Das gemeinsame Erziehungsverhalten getrennt lebender Eltern
- Die Bedeutung verschiedener Familienformen für Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Arbeit untersucht, wie Kinder vor, während und nach einer Trennung ihrer Eltern bestmöglich begleitet werden können, um negative Folgen zu minimieren. Sie analysiert den Ratgeber "Glückliche Scheidungskinder" von Largo und Czernin kritisch und erweitert dessen Gedanken, besonders im Hinblick auf pädagogische Handlungsansätze. Ziel ist es aufzuzeigen, wie Eltern und PädagogInnen dazu beitragen können, dass Kinder trotz der Trennung ein Gefühl der Geborgenheit und der elterlichen Zuwendung behalten.
2 Glückliche Scheidungskinder: Dieser Abschnitt bietet eine kritische Auseinandersetzung mit den einzelnen Kapiteln des Ratgebers "Glückliche Scheidungskinder". Der entwicklungspsychologische Ansatz des Buches, der die Befriedigung grundlegender physischer und psychischer Bedürfnisse des Kindes betont, wird erläutert und kritisch hinterfragt. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Nähe, Zuwendung, Schutz, Geborgenheit und sozialer Akzeptanz für das Wohlbefinden des Kindes und beleuchtet, wie diese Bedürfnisse auch nach einer Trennung erfüllt werden können. Der Fokus liegt darauf, dass der Wegzug eines Elternteils nicht gleichbedeutend mit dem Verlust der elterlichen Zuwendung sein muss.
2.1 Grundgedanken zum Buch: Das Kapitel erläutert den entwicklungspsychologischen Ansatz des Buches, der die Befriedigung der Grundbedürfnisse des Kindes (Nähe, Zuwendung, Schutz, Geborgenheit, soziale Akzeptanz, Förderung) als Grundlage für ein glückliches Leben nach der Trennung der Eltern postuliert. Die Arbeit hinterfragt die Vollständigkeit dieses Ansatzes und diskutiert, ob die Befriedigung dieser Bedürfnisse ausreicht, um negative Auswirkungen einer Trennung vollständig auszugleichen. Es wird jedoch betont, dass die Deckung dieser Bedürfnisse dazu beiträgt, mit den verletzenden Erfahrungen einer Trennung besser umzugehen, insbesondere indem der Kontakt zum weggezogenen Elternteil aufrechterhalten wird, was das Gefühl des Verlustes beim Kind minimieren soll.
2.2 Zum Zeitpunkt der Trennung: Dieses Kapitel behandelt den Umgang mit Kindern im Moment der Trennung. Es wird anhand von Beispielgeschichten gezeigt, wie unterschiedlich Kinder in diesem Alter auf die Nachricht reagieren und dass das Verständnis von Trennung und Scheidung vom Alter des Kindes abhängt. Die Arbeit unterstreicht die Wichtigkeit der Vorbereitung der Eltern auf dieses Gespräch, den Fokus auf das Verbindende anstatt das Trennende, die Bedeutung einer emotional stabilen Kommunikation der Eltern und das Vermeiden von negativen Gefühlen wie Wut und Hass in der Kommunikation mit den Kindern. Langfristige Geborgenheit wird als wichtiger erachtet als die Worte selbst, wobei positive Erfahrungen in der neuen Familiensituation entscheidend sind.
2.2.1 Wie sagen wir es unseren Kindern?: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die praktische Umsetzung der Kommunikation der Trennung an die Kinder. Es werden Beispiele für erfolgreiche und misslungene Gespräche analysiert, um die Bedeutung der altersgerechten Kommunikation und der Vermeidung von Ängsten beim Kind zu unterstreichen. Die Autoren betonen die Wichtigkeit, dass Eltern sich vor dem Gespräch absprechen, das Verbindende betonen und eine positive emotionale Verfassung beibehalten. Negative Gefühle zwischen den Eltern sollten vom Kind ferngehalten werden, um dessen Sicherheit und Geborgenheit zu gewährleisten. Die langfristige Erfahrung der neuen Situation, positiv geprägt, ist entscheidender als die Worte im Moment der Mitteilung.
2.2.2 Was verstehen Kinder unter Liebe, Ehe, Trennung?: Dieses Unterkapitel analysiert das kindliche Verständnis von Liebe, Ehe und Trennung. Es betont die Notwendigkeit, das kindliche Weltbild und die Entwicklung der Vorstellung sozialer Strukturen zu berücksichtigen. Das Kapitel hebt hervor, dass Kinder die Trennung der Eltern oft als eigenen Verlust interpretieren, was die Kommunikation und den Umgang mit dem Thema besonders sensibel erfordert.
Schlüsselwörter
Scheidung, Kinder, Trennung, Entwicklungspsychologie, Bedürfnisbefriedigung, Kommunikation, Eltern, Pädagogik, Familie, emotionale Entwicklung, Verlust, Geborgenheit, Zuwendung.
Häufig gestellte Fragen zu „Glückliche Scheidungskinder“
Was ist der Inhalt des Buches „Glückliche Scheidungskinder“ und dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert den Ratgeber „Glückliche Scheidungskinder“ von Remo H. Largo und Monika Czernin. Sie untersucht, wie Kinder die Trennung ihrer Eltern bestmöglich bewältigen können, mit Fokus auf Unterstützung vor, während und nach der Trennung. Die Arbeit erweitert die Autorenideen und bietet konkrete Handlungsempfehlungen für Pädagog*innen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt entwicklungspsychologische Ansätze der Bedürfnisbefriedigung bei Kindern, Kommunikation mit Kindern zum Thema Trennung und Scheidung, den Alltag nach der Trennung, das gemeinsame Erziehungsverhalten getrennt lebender Eltern und die Bedeutung verschiedener Familienformen für Kinder.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Zusammenfassung des Buches „Glückliche Scheidungskinder“ (einschließlich der Kapitel „Grundgedanken zum Buch“, „Zum Zeitpunkt der Trennung“, „Wie sagen wir es unseren Kindern?“, „Was verstehen Kinder unter Liebe, Ehe, Trennung?“), eine Schlussfolgerung für Pädagog*innen und eine Liste von Schlüsselbegriffen.
Welche zentralen Aussagen macht die Seminararbeit zum Umgang mit Kindern während und nach einer Trennung?
Die Arbeit betont die Wichtigkeit der Bedürfnisbefriedigung (Nähe, Zuwendung, Schutz, Geborgenheit, soziale Akzeptanz) bei Kindern. Sie unterstreicht die Bedeutung einer offenen, altersgerechten Kommunikation, die das Verbindende betont und negative Emotionen zwischen den Eltern vom Kind fernhält. Langfristige Geborgenheit und positive Erfahrungen in der neuen Familiensituation sind wichtiger als die Worte im Moment der Mitteilung.
Wie wird das kindliche Verständnis von Liebe, Ehe und Trennung in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert das kindliche Weltbild und die Entwicklung der Vorstellung sozialer Strukturen. Sie betont, dass Kinder die Trennung oft als eigenen Verlust interpretieren, was die Kommunikation und den Umgang mit dem Thema besonders sensibel erfordert.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Pädagog*innen, Eltern, sowie alle, die sich mit dem Thema Scheidung und deren Auswirkungen auf Kinder auseinandersetzen. Sie bietet praktische Handlungsempfehlungen und ein tiefergehendes Verständnis der kindlichen Perspektive.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Scheidung, Kinder, Trennung, Entwicklungspsychologie, Bedürfnisbefriedigung, Kommunikation, Eltern, Pädagogik, Familie, emotionale Entwicklung, Verlust, Geborgenheit, Zuwendung.
Wie wird der Ratgeber „Glückliche Scheidungskinder“ in der Seminararbeit bewertet?
Die Seminararbeit analysiert den Ratgeber kritisch und erweitert dessen Gedanken, besonders im Hinblick auf pädagogische Handlungsansätze. Der entwicklungspsychologische Ansatz des Buches wird erläutert und kritisch hinterfragt. Die Arbeit betont die Bedeutung der im Buch genannten Bedürfnisse, hinterfragt aber, ob deren Befriedigung negative Auswirkungen einer Trennung vollständig ausgleicht.
- Quote paper
- Leonhard Stampler (Author), 2004, Glückliche Scheidungskinder!?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117844