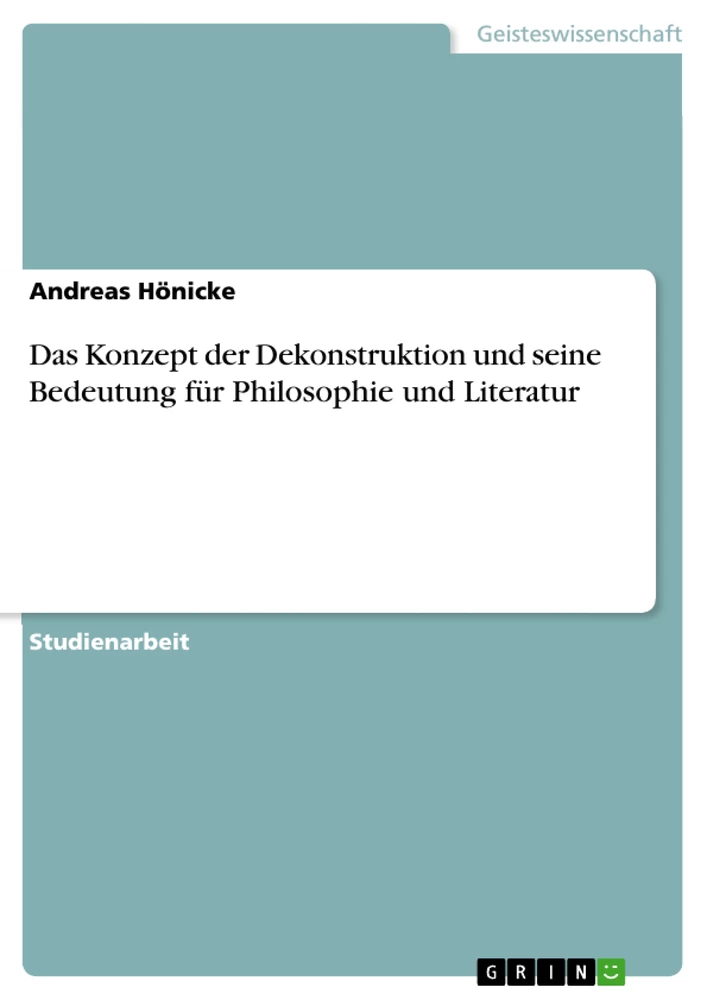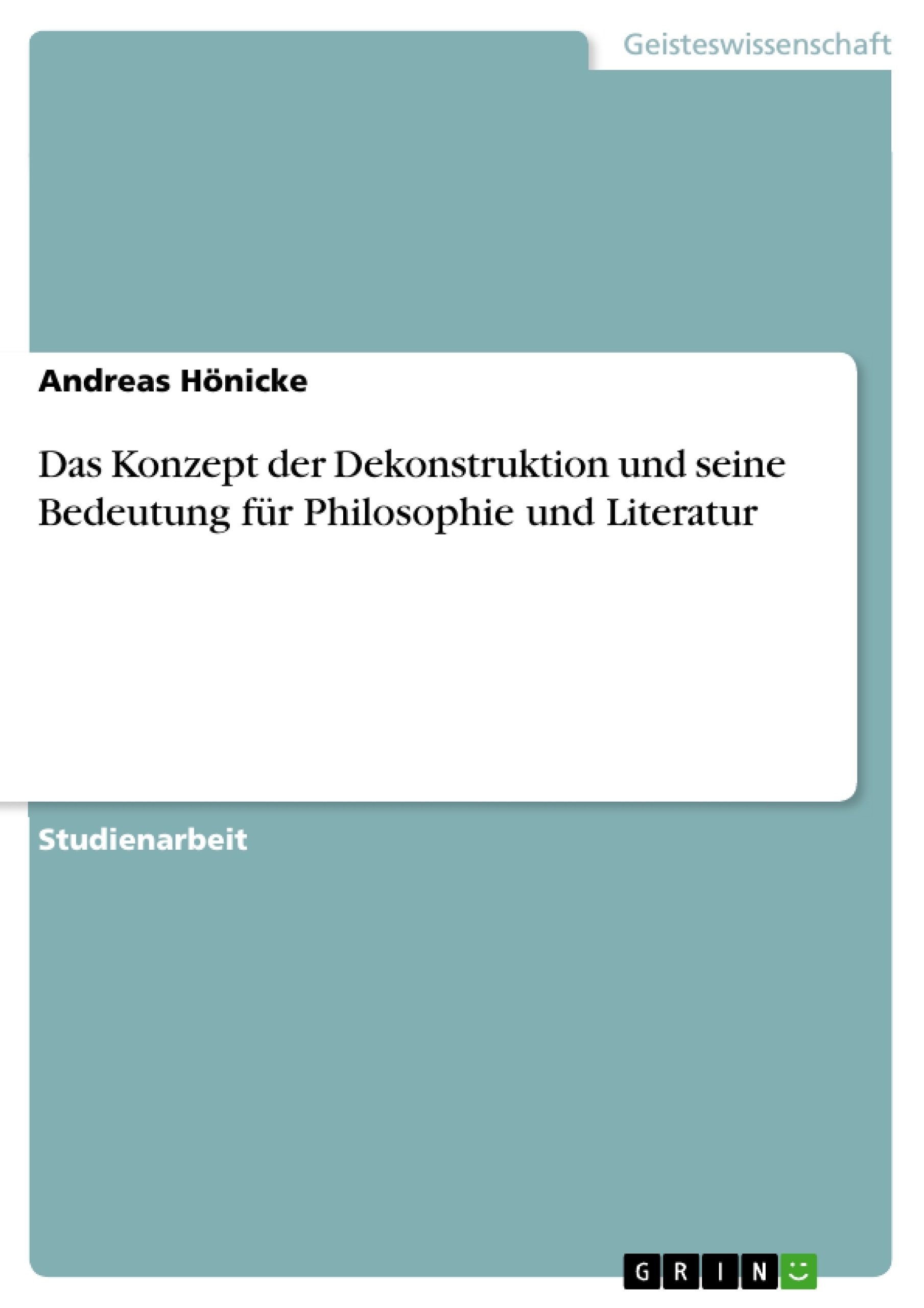Die Abhandlung schildert zunächst kurz die Biographie von Jacques Derrida, einem der maßgeblichen Väter der Dekonstruktion. Im Anschluss wird das Konzept sowie seine Bedeutung für Philosophie und Literatur ausführlich erläutert. Dies schließt auch eine Betrachtung der sogenannten Yale-School ein, welche eine der einflußreichsten literarischen Strömungen der USA in den 1970er Jahren darstellt. Anhand des Beispiels einer Detektivgeschichte von Jorge Luis wird Dekonstruktion in ihrer praktischen Dimension erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsgegenstand und Materiallage
- 1.2 Fragestellungen und Schwerpunkte der Arbeit
- 2. Kurzbiographie Jacques Derrida
- 3. Dekonstruktion in der Philosophie
- 4. Dekonstruktion in der Literatur
- 4.1 Allgemeine Anmerkungen
- 4.2 Die „Yale-School“
- 5. Dekonstruktion - Ein Beispiel
- 5.1 Detektivgeschichte „Der Tod und der Kompaß“
- 5.2 Auswertung
- 6. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das poststrukturalistische Konzept der Dekonstruktion in Philosophie und Literatur. Das Hauptziel besteht darin, anhand der vorhandenen Literatur spezifische Fragestellungen zur Dekonstruktion zu bearbeiten. Die Arbeit beleuchtet Derridas Biographie, erörtert die philosophischen Grundlagen der Dekonstruktion und deren Unterschiede zu strukturalistischen Konzepten. Weiterhin wird die Anwendung der Dekonstruktion in der Literaturwissenschaft, insbesondere im Kontext der Yale-School, untersucht. Ein praktisches Beispiel anhand einer Kurzgeschichte von Borges veranschaulicht die theoretischen Ausführungen.
- Biographie und Wirken Jacques Derridas
- Philosophische Grundlagen der Dekonstruktion
- Dekonstruktion in der Literaturwissenschaft (Yale-School)
- Praktische Anwendung der Dekonstruktion anhand eines literarischen Beispiels
- Vergleich zwischen Dekonstruktion und Strukturalismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand, die verwendete Literatur (von Standardwerken Derridas bis zu aktuellen Abhandlungen, u.a. von Culler und Zima) und die Internetrecherche als ergänzende Informationsquelle. Sie benennt die Forschungsfragen und Schwerpunkte der Arbeit, welche die Biographie Derridas, die philosophischen Grundlagen der Dekonstruktion, deren Anwendung in der Literaturwissenschaft und ein praktisches Beispiel umfassen. Die Arbeit fokussiert auf die Herausarbeitung des Charakters der Dekonstruktion und ihrer Unterschiede zu strukturalistischen Konzepten, sowie deren Auswirkungen auf geisteswissenschaftliches Arbeiten.
2. Kurzbiographie Jacques Derrida: Dieses Kapitel bietet eine chronologische Darstellung des Lebens von Jacques Derrida, beginnend mit seiner Geburt in Algerien und seinen frühen Erfahrungen mit Diskriminierung. Es schildert seinen Werdegang, einschließlich seiner Studien an der École Normale Supérieure in Paris, seiner Freundschaft mit Foucault, seiner Zeit an der Harvard University und seiner Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten, darunter die Sorbonne und Yale. Die Zusammenfassung betont Derridas intensive Beschäftigung mit philosophischen Werken und seine Rolle bei der Verbreitung der Dekonstruktion in den USA, die Gründung der „Yale School“ und seine zunehmende Anerkennung im Ausland, trotz Ausgrenzung im französischen akademischen Betrieb.
3. Dekonstruktion in der Philosophie: Dieses Kapitel erklärt die Dekonstruktion als zentrales Element des Poststrukturalismus und erläutert Derridas Konzept des Logozentrismus als Ziel der Dekonstruktion. Es analysiert, wie Derrida das abendländisch-metaphysische Denken als eine Kette von Ersetzungen eines zentralen Begriffs durch weitere metaphorische Begriffe betrachtet und Philosophien als Versionen dieses Logozentrismus einordnet. Derrida’s Kritik am Strukturalismus, welcher nach Derrida nicht vom Logozentrismus frei ist, wird hervorgehoben. Das Kapitel betont Derridas Anliegen, hierarchische Gegensätze des metaphysischen Denkens als Konstruktionen zu entlarven und ein unendliches Spiel von Differenzen an die Stelle eines starren Zentrums zu setzen.
4. Dekonstruktion in der Literatur: Dieses Kapitel behandelt die Anwendung der Dekonstruktion in der Literaturwissenschaft. Es geht auf allgemeine Anmerkungen zur Dekonstruktion in der Literatur ein und widmet sich ausführlich der „Yale School“, deren herausragende Stellung in der amerikanischen Literaturwissenschaft der 70er und 80er Jahre beschrieben wird. Das Kapitel legt den Fokus auf die Prinzipien und Methoden der Yale School im Umgang mit literarischen Texten und deren Bezug zur Dekonstruktionsmethode.
Schlüsselwörter
Dekonstruktion, Poststrukturalismus, Jacques Derrida, Logozentrismus, Strukturalismus, Yale-School, Philosophie, Literaturwissenschaft, Hermeneutik, Metaphysik, Binäre Oppositionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Dekonstruktion bei Jacques Derrida
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das poststrukturalistische Konzept der Dekonstruktion in Philosophie und Literatur. Sie beleuchtet Derridas Biographie, die philosophischen Grundlagen der Dekonstruktion und deren Anwendung in der Literaturwissenschaft, insbesondere im Kontext der Yale-School. Ein praktisches Beispiel anhand einer Kurzgeschichte von Borges veranschaulicht die theoretischen Ausführungen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich zwischen Dekonstruktion und Strukturalismus.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Biographie und das Wirken Jacques Derridas; die philosophischen Grundlagen der Dekonstruktion (inkl. Logozentrismus und Kritik am Strukturalismus); die Dekonstruktion in der Literaturwissenschaft (mit Fokus auf die Yale-School); die praktische Anwendung der Dekonstruktion anhand eines literarischen Beispiels (Borges); und ein Vergleich zwischen Dekonstruktion und Strukturalismus.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung (Forschungsgegenstand, Fragestellungen, verwendete Literatur); 2. Kurzbiographie Jacques Derrida; 3. Dekonstruktion in der Philosophie; 4. Dekonstruktion in der Literatur (inkl. Yale-School); 5. Dekonstruktion - Ein Beispiel (Analyse einer Kurzgeschichte von Borges); 6. Schlussfolgerung.
Welche Quellen wurden für die Seminararbeit verwendet?
Die Seminararbeit stützt sich auf Standardwerke Derridas sowie aktuelle Abhandlungen von Autoren wie Culler und Zima. Zusätzlich wurde Internetrecherche als ergänzende Informationsquelle genutzt.
Was ist das zentrale Ziel der Seminararbeit?
Das Hauptziel besteht darin, anhand der vorhandenen Literatur spezifische Fragestellungen zur Dekonstruktion zu bearbeiten und den Charakter der Dekonstruktion und ihre Unterschiede zu strukturalistischen Konzepten herauszuarbeiten, sowie deren Auswirkungen auf geisteswissenschaftliches Arbeiten zu beleuchten.
Wie wird die Dekonstruktion in der Literaturwissenschaft dargestellt?
Die Anwendung der Dekonstruktion in der Literaturwissenschaft wird behandelt, mit besonderem Fokus auf die "Yale-School" und deren herausragende Stellung in der amerikanischen Literaturwissenschaft der 70er und 80er Jahre. Die Arbeit beschreibt die Prinzipien und Methoden der Yale School im Umgang mit literarischen Texten und deren Bezug zur Dekonstruktionsmethode.
Welche Rolle spielt Jacques Derrida in der Seminararbeit?
Jacques Derrida steht im Zentrum der Arbeit. Seine Biographie wird skizziert, seine philosophischen Konzepte der Dekonstruktion und des Logozentrismus werden erläutert, und sein Einfluss auf die Literaturwissenschaft, insbesondere die Yale-School, wird analysiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Dekonstruktion, Poststrukturalismus, Jacques Derrida, Logozentrismus, Strukturalismus, Yale-School, Philosophie, Literaturwissenschaft, Hermeneutik, Metaphysik, Binäre Oppositionen.
Wie wird das Konzept des Logozentrismus in der Arbeit behandelt?
Der Logozentrismus wird als zentrales Element des abendländisch-metaphysischen Denkens dargestellt, das Derrida mit seiner Dekonstruktion kritisiert. Die Arbeit erläutert, wie Derrida das metaphysische Denken als eine Kette von Ersetzungen eines zentralen Begriffs durch metaphorische Begriffe betrachtet und Philosophien als Versionen dieses Logozentrismus einordnet.
- Arbeit zitieren
- Andreas Hönicke (Autor:in), 2001, Das Konzept der Dekonstruktion und seine Bedeutung für Philosophie und Literatur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11772