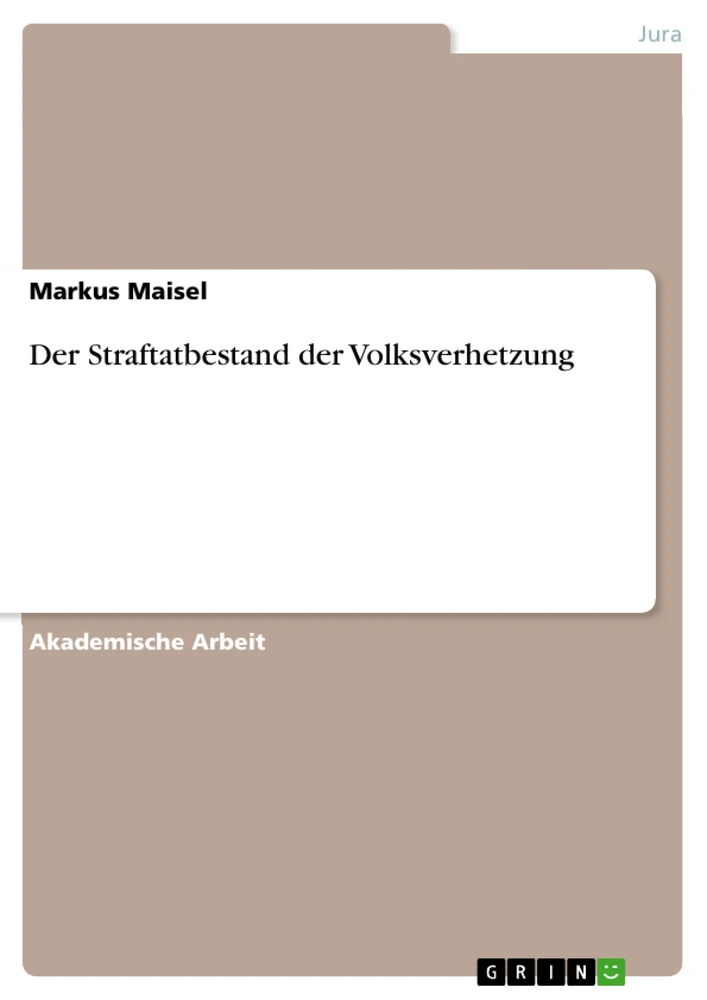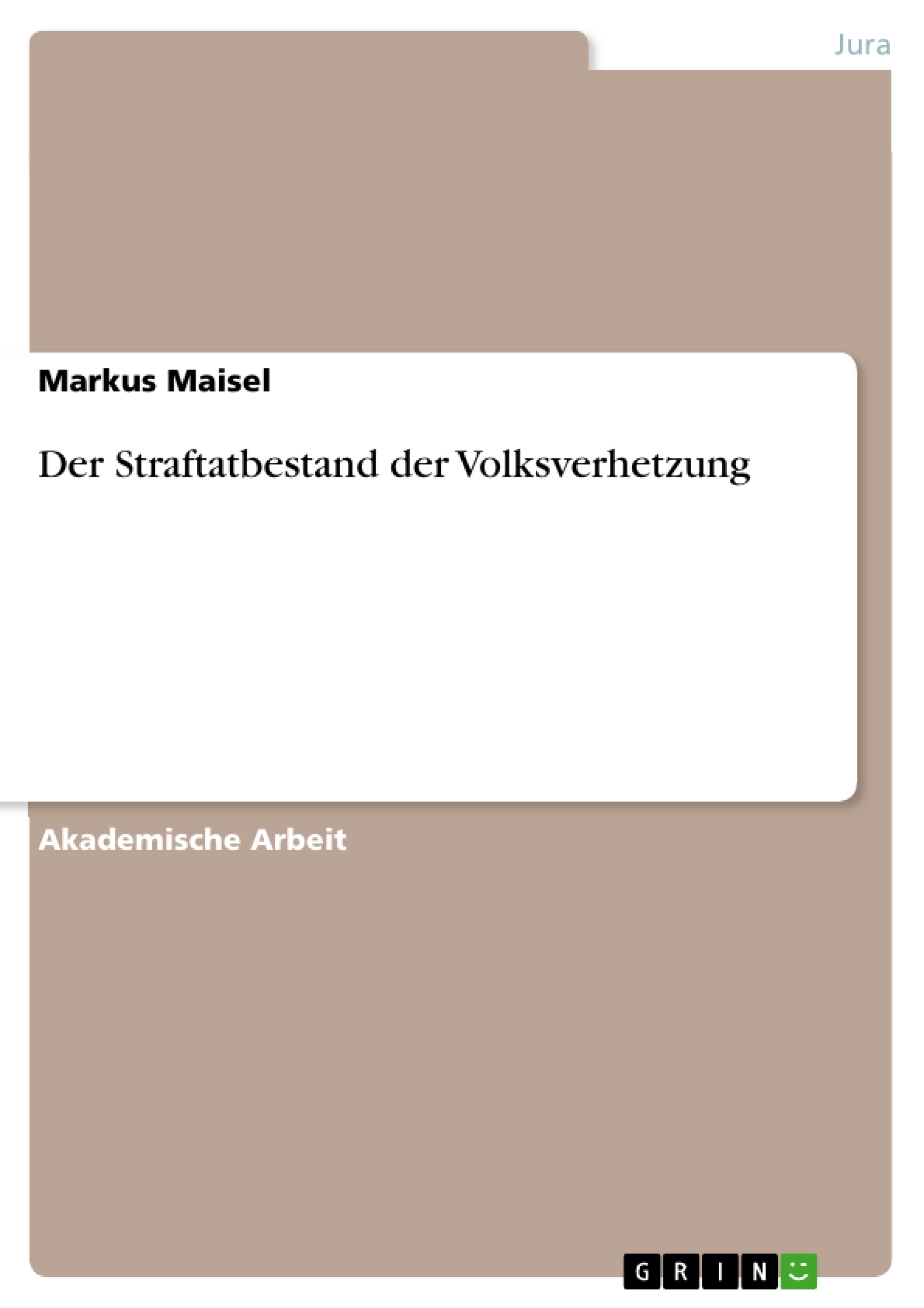Um eine große Schranke der Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland soll es in dieser Hausarbeit gehen: den Straftatbestand der Volksverhetzung. Volksverhetzung ist in der westlichen Welt omnipräsent. Ob in den Kommentarspalten der sozialen Medien oder in vollen Veranstaltungssälen: Die Begriffe "Hate Speech" und Volksverhetzung werden im heutigen digitalen Zeitalter zunehmend relevanter.
In dieser Arbeit wird geschildert, worum es sich beim Straftatbestand der Volksverhetzung handelt und welche Opfergruppen dies betrifft. Außerdem wird erläutert, wie der Straftatbestand der Volksverhetzung entstanden ist und innerhalb der vergangenen Jahrzehnte erweitert wurde. Darüber hinaus wird auf Volksverhetzung im klassischen Journalismus eingegangen sowie auf Beispiele der Volksverhetzung im Internet im modernen Zeitalter der Digitalisierung.
Nachdem die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im August 2019 eine Podiumsdiskussion in Stralsund abhielt, erhob sich ein Kommunalpolitiker der Alternative für Deutschland (AfD) im Plenum und richtete das Wort mit einem harten Angriff an Merkel. Der AfD-Politiker Thomas Naulin behauptete, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland massiv eingeschränkt sei. Darüber hinaus beschuldigte er die CDU-Politikerin, dass sie Deutschland spalte und dass es für Personen, die sich zur AfD bekannten, keine Meinungsfreiheit gebe.
Bundeskanzlerin Merkel reagierte gelassen. Darüber hinaus äußerte sie, dass jene Meinungsfreiheit in Deutschland existiere, diese allerdings durchaus von Schranken begrenzt sei: Die Meinungsfreiheit sei dann beschränkt, wenn Äußerungen die Würde andere Menschen in Gefahr brächten. Für ihre Äußerung erhielt Merkel im Nachhinein großen medialen Zuspruch, während der AfD- Kommunalpolitiker Naulin viel Spott erntete.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Volksverhetzung?
- 2.1 § 130 StGB
- 2.2 Opfergruppen
- 3. Geschichte des Straftatbestands der Volksverhetzung
- 3.1 Der Straftatbestand der Volksverhetzung im deutschen Kaiserreich
- 3.2 Erneuerung des § 130 StGB im Jahr 1960
- 3.3 Erstarkender Rechtsterrorismus in den 1990ern – Zusatz der Holocaustleugnung
- 3.3.1 Der Fall Deckert
- 4. Vorfälle der Volksverhetzung im Journalismus
- 4.1 Holocaustleugnung in einer Radioshow
- 4.1.1 Antisemitismus im Regensburger Wochenendblatt?
- 4.1.2 „All cops are berufsunfähig“
- 5. Volksverhetzung im Zeitalter der Digitalisierung
- 6. Fazit: Zunehmende Relevanz des Straftatbestands der Volksverhetzung in der Gegenwart
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Straftatbestand der Volksverhetzung in Deutschland. Ziel ist es, den juristischen Rahmen, die historische Entwicklung und die aktuelle Relevanz dieses Delikts zu beleuchten. Dabei werden verschiedene Fälle und Beispiele aus Journalismus und dem digitalen Raum analysiert.
- Definition und juristische Grundlagen der Volksverhetzung (§ 130 StGB)
- Historische Entwicklung des Straftatbestands
- Betroffene Opfergruppen und deren Schutz
- Volksverhetzung im traditionellen und digitalen Journalismus
- Die zunehmende Relevanz von Volksverhetzung im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Beispiel eines Konflikts zwischen einem AfD-Politiker und Angela Merkel, um die Relevanz des Themas der Meinungsfreiheit und ihrer Grenzen, insbesondere im Kontext der Volksverhetzung, zu verdeutlichen. Es wird der aktuelle, steigende Bedarf an einer Klärung der rechtlichen Konsequenzen von Hassreden, speziell im digitalen Zeitalter, betont.
2. Was ist Volksverhetzung?: Dieses Kapitel definiert den Straftatbestand der Volksverhetzung gemäß § 130 StGB. Es erläutert, wie die Meinungsfreiheit durch die Gefährdung des öffentlichen Friedens und die Verletzung der Menschenwürde eingeschränkt wird. Die verschiedenen Absätze des § 130 StGB werden kurz vorgestellt, mit einem Fokus auf die strafrechtlichen Konsequenzen für das Aufstacheln zu Hass und Gewalt gegen Teile der Bevölkerung.
2.2 Opfergruppen: Der Abschnitt beschreibt die verschiedenen Personengruppen, die von Volksverhetzung betroffen sein können. Es werden nationale, rassische, religiöse und ethnische Gruppen genannt, sowie weitere Teile der Bevölkerung, die aufgrund bestimmter Merkmale diskriminiert werden könnten. Die Definition von „Teilen der Bevölkerung“ wird präzisiert, inklusive Gruppen wie Menschen mit Behinderungen, und betont, dass sowohl ganze Gruppen als auch Einzelpersonen Opfer sein können.
3. Geschichte des Straftatbestands der Volksverhetzung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Straftatbestands der Volksverhetzung, von seiner Entstehung im deutschen Kaiserreich über die Erneuerung im Jahr 1960 bis hin zu den Erweiterungen im Kontext des Rechtsterrorismus der 1990er Jahre. Der Fokus liegt auf der Anpassung des Gesetzes an gesellschaftliche Veränderungen und die Herausforderungen der Bekämpfung von Hassreden.
4. Vorfälle der Volksverhetzung im Journalismus: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Beispiele für Volksverhetzung im traditionellen Journalismus. Es werden Fälle von Holocaustleugnung in Medien, antisemitische Äußerungen und die Verbreitung von Hassreden im Kontext der Polizeiarbeit analysiert. Diese Beispiele illustrieren die verschiedenen Formen, in denen Volksverhetzung im Journalismus auftreten kann und die Konsequenzen, die daraus resultieren können.
5. Volksverhetzung im Zeitalter der Digitalisierung: Dieses Kapitel widmet sich der spezifischen Herausforderung der Volksverhetzung im digitalen Raum. Es werden die Besonderheiten der Verbreitung von Hassreden und Hetze in sozialen Medien und im Internet behandelt, und die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung und Regulierung dieses Phänomens.
Schlüsselwörter
Volksverhetzung, § 130 StGB, Meinungsfreiheit, öffentlicher Frieden, Menschenwürde, Opfergruppen, Hassrede, Digitalisierung, Journalismus, Holocaustleugnung, Rechtsterrorismus, Strafgesetzbuch.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Volksverhetzung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht den Straftatbestand der Volksverhetzung in Deutschland. Sie beleuchtet den juristischen Rahmen, die historische Entwicklung und die aktuelle Relevanz dieses Delikts, analysiert verschiedene Fälle und Beispiele aus Journalismus und dem digitalen Raum.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: Definition und juristische Grundlagen der Volksverhetzung (§ 130 StGB), historische Entwicklung des Straftatbestands, betroffene Opfergruppen und deren Schutz, Volksverhetzung im traditionellen und digitalen Journalismus und die zunehmende Relevanz von Volksverhetzung im digitalen Zeitalter.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition von Volksverhetzung (§ 130 StGB) und Opfergruppen, Geschichte des Straftatbestands, Volksverhetzung im Journalismus, Volksverhetzung im digitalen Zeitalter, Fazit und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Aspekte des Themas zusammen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung verdeutlicht die Relevanz des Themas Meinungsfreiheit und deren Grenzen im Kontext von Volksverhetzung anhand eines Beispiels. Sie betont den aktuellen Bedarf an Klärung der rechtlichen Konsequenzen von Hassreden, insbesondere im digitalen Raum.
Wie wird Volksverhetzung definiert?
Kapitel 2 definiert Volksverhetzung gemäß § 130 StGB und erläutert, wie die Meinungsfreiheit durch die Gefährdung des öffentlichen Friedens und die Verletzung der Menschenwürde eingeschränkt wird. Die verschiedenen Absätze des § 130 StGB werden vorgestellt, mit Fokus auf die strafrechtlichen Konsequenzen für das Aufstacheln zu Hass und Gewalt.
Welche Opfergruppen werden betrachtet?
Kapitel 2.2 beschreibt die verschiedenen Personengruppen, die von Volksverhetzung betroffen sein können: nationale, rassische, religiöse und ethnische Gruppen sowie weitere Teile der Bevölkerung, die aufgrund bestimmter Merkmale diskriminiert werden könnten (z.B. Menschen mit Behinderungen).
Wie wird die historische Entwicklung des Straftatbestands dargestellt?
Kapitel 3 beleuchtet die historische Entwicklung des Straftatbestands der Volksverhetzung, von seiner Entstehung im deutschen Kaiserreich bis zu den Erweiterungen im Kontext des Rechtsterrorismus der 1990er Jahre. Der Fokus liegt auf der Anpassung des Gesetzes an gesellschaftliche Veränderungen.
Welche Beispiele für Volksverhetzung im Journalismus werden genannt?
Kapitel 4 präsentiert konkrete Beispiele für Volksverhetzung im traditionellen Journalismus, wie Holocaustleugnung in Medien, antisemitische Äußerungen und die Verbreitung von Hassreden im Kontext der Polizeiarbeit.
Wie wird Volksverhetzung im digitalen Zeitalter behandelt?
Kapitel 5 widmet sich der Herausforderung der Volksverhetzung im digitalen Raum. Es werden die Besonderheiten der Verbreitung von Hassreden und Hetze in sozialen Medien und im Internet und die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung und Regulierung behandelt.
Welches Fazit zieht die Hausarbeit?
Das Fazit (Kapitel 6) betont die zunehmende Relevanz des Straftatbestands der Volksverhetzung in der Gegenwart.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Volksverhetzung, § 130 StGB, Meinungsfreiheit, öffentlicher Frieden, Menschenwürde, Opfergruppen, Hassrede, Digitalisierung, Journalismus, Holocaustleugnung, Rechtsterrorismus, Strafgesetzbuch.
- Quote paper
- Markus Maisel (Author), 2021, Der Straftatbestand der Volksverhetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1177097