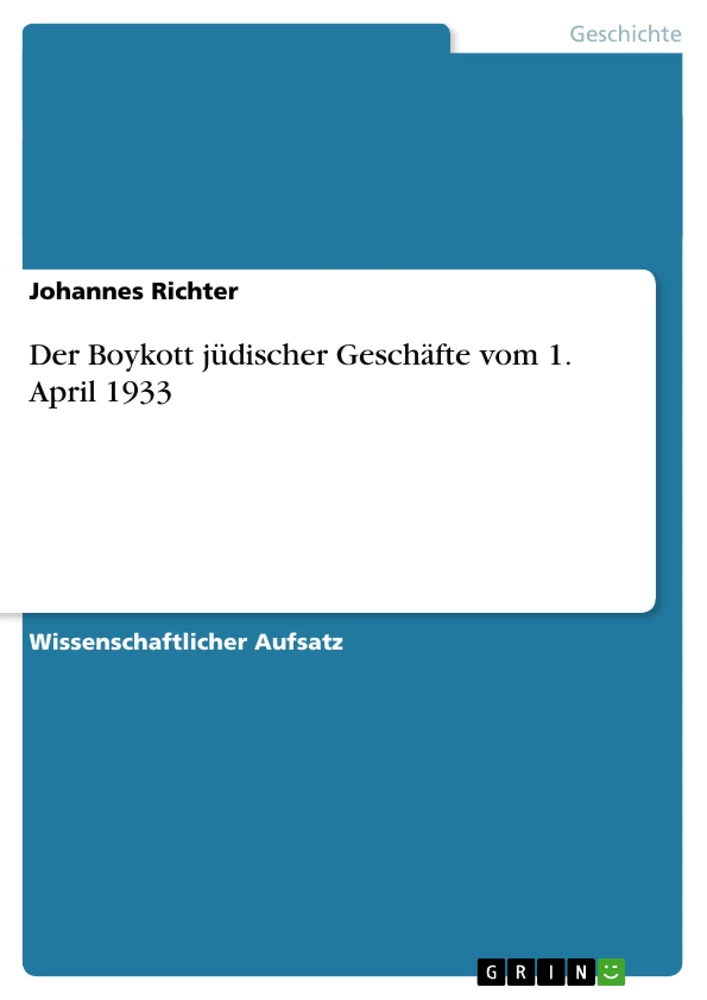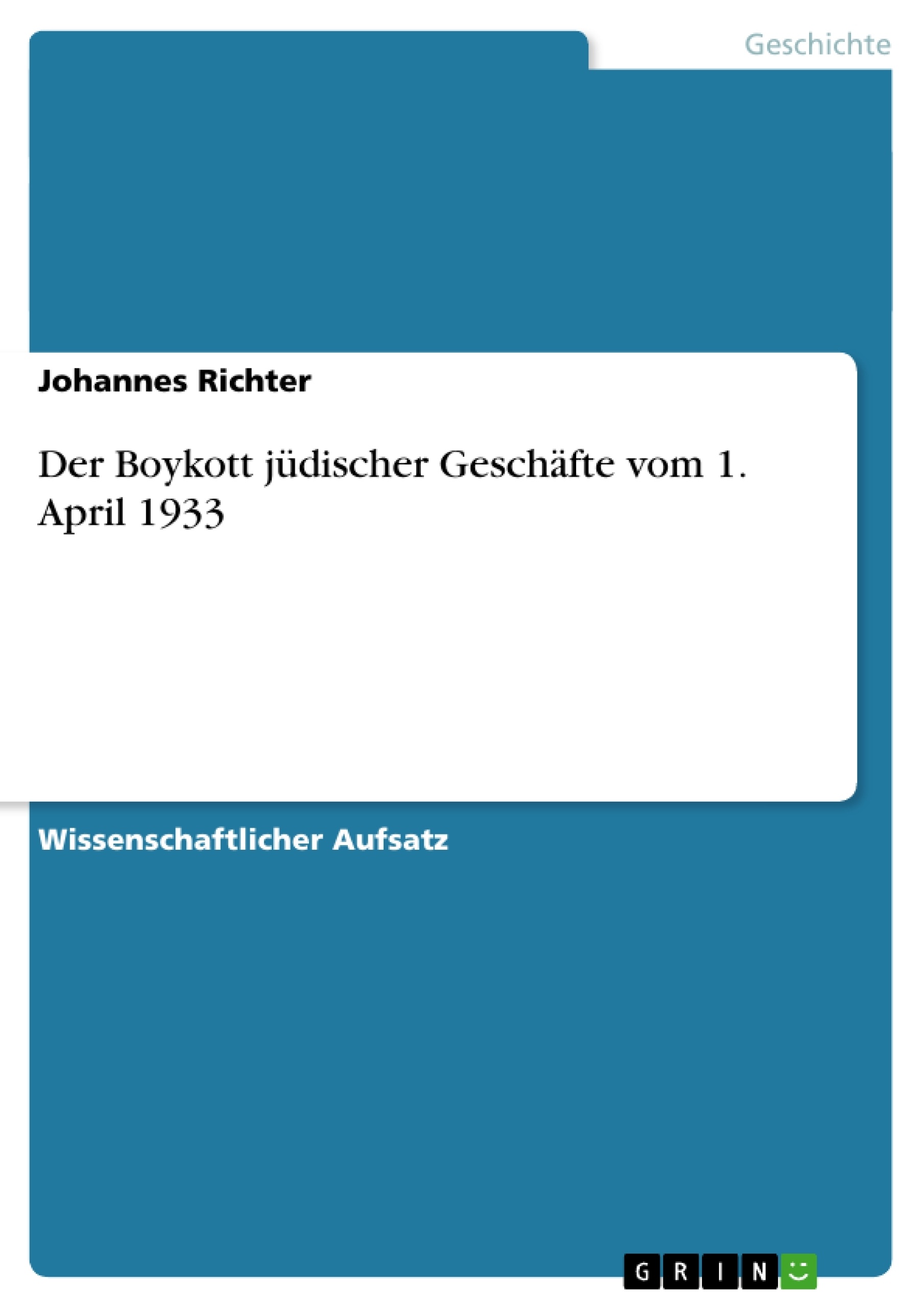Gegenstand dieser Arbeit ist der Boykott jüdische Geschäfte vom 1. April 1933 sowie seine Vorgeschichte, sein Verlauf und seine Auswirkungen. Im Vordergrund meiner Arbeit sollen die Fragen stehen, wie sich die deutsche Bevölkerung während des Aprilboykotts verhalten hat und in wieweit der Boykott charakteristisch für die weitere Vorgehensweise der NSDAP bei der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung war.
Anfeindungen gegenüber Juden sind schon seit über 2500 Jahren bekannt. Die Feindschaft, der das jüdische Volk gegenüber stand, reichte von Diskriminierung und Unterdrückung über Verfolgung und Vertreibung bis hin zum Versuch der Ausrottung. Der Boykott vom 1. April 1933 ist in sofern von grundlegender Bedeutung, als dieser den Übergang von bislang einzelnen sporadischen unkoordinierten Angriffen zu einer von staatlichen Organen gelenkten und legalisierten, planmäßig organisierten Diskriminierung und Verfolgung bis zur endgültigen physischen Vernichtung der europäischen Juden markierte. Der Aprilboykott wird von Historikern als erster Höhepunkt antijüdischer Gesetze und Verfolgung gesehen und steht im direkten Zusammenhang mit der unmittelbar zuvor erfolgten Machtergreifung der Nationalsozialisten durch die Wahl Adolf Hitlers zum Reichskanzler und der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes.
Diese Arbeit soll neben einer Darstellung der antisemitischen Tendenzen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik als politische und gesellschaftliche Vorbedingungen des Boykotts vom 1. April 1933, seine Planung und Organisation durch staatliche Organe, seine praktische Umsetzung und die Haltung und Reaktionen der nicht jüdischen Bevölkerung untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Antisemitische Tendenzen im Kaiserreich und während der Weimarer Republik
Die Phase zwischen der Machtübernahme und dem Boykott (30. Januar 1933 - 1. April 1933)
Der Boykott vom 1. April 1933
1.) Die Planung und Organisation des Boykotts
2.) Die mit dem Boykott verfolgten Ziele
3.) Der Verlauf des Boykotts
Fazit
Quellen und Literaturverzeichnisse
Einleitung
Gegenstand dieser Arbeit ist der Boykott jüdische Geschäfte vom 1. April 1933 sowie seine Vorgeschichte, sein Verlauf und seine Auswirkungen. Im Vordergrund meiner Arbeit sollen die Fragen stehen, wie sich die deutsche Bevölkerung während des Aprilboykotts verhalten hat und in wieweit der Boykott charakteristisch für die weitere Vorgehensweise der NSDAP bei der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung war.
Anfeindungen gegenüber Juden sind schon seit über 2500 Jahren bekannt. Die Feindschaft, der das jüdische Volk gegenüber stand, reichte von Diskriminierung und Unterdrückung über Verfolgung und Vertreibung bis hin zum Versuch der Ausrottung. Der Boykott vom 1. April 1933 ist in sofern von grundlegender Bedeutung, als dieser den Übergang von bislang einzelnen sporadischen unkoordinierten Angriffen zu einer von staatlichen Organen gelenkten und legalisierten, planmäßig organisierten Diskriminierung und Verfolgung bis zur endgültigen physischen Vernichtung der europäischen Juden markierte. Der Aprilboykott wird von Historikern als erster Höhepunkt antijüdischer Gesetze und Verfolgung gesehen und steht im direkten Zusammenhang mit der unmittelbar zuvor erfolgten Machtergreifung der Nationalsozialisten durch die Wahl Adolf Hitlers zum Reichskanzler und der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes.
Diese Arbeit soll neben einer Darstellung der antisemitischen Tendenzen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik als politische und gesellschaftliche Vorbedingungen des Boykotts vom 1. April 1933, seine Planung und Organisation durch staatliche Organe, seine praktische Umsetzung und die Haltung und Reaktionen der nicht jüdischen Bevölkerung untersuchen.
Antisemitische Tendenzen im Kaiserreich und während der Weimarer Republik
Mit dem Erstarken des Bürgertums in der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert und der zunehmenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Liberalisierung wurde auch die Gleichberechtigung der ca. 500.000 im Deutschen Reich lebenden Juden in der Reichsverfassung von 1871 aufgenommen.[1] Diese rechtliche Gleichstellung vermochte jedoch an den in weiten Teilen der Bevölkerung verbreiteten antisemitischen Tendenzen wenig zu ändern. So hatten z.B. Sprachwissenschaftler und Völkerkundler aus der Literatur des 18. Jahrhunderts den Begriff „Semiten“[2] übernommen und ihn zur Beschreibung des jüdischen „Volkcharakters“ benutzt. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde daraus eine Art pseudo-wissenschaftliche „Rassenlehre“, mit welcher der Versuch unternommen wurde die Verschiedenartigkeit des jüdischen Menschen gegenüber dem Europäer wissenschaftlich zu untermauern. Nachdem im Mittelalter Übergriffe auf Juden vor allem im Anschluss an Missernten oder Seuchen zu beobachten waren, machten Antisemiten die jüdische Bevölkerung jetzt für alle negativen Auswirkungen der Industrialisierung, den Kapitalismus und die Ausbeutung der Arbeiterschaft verantwortlich. In den darauf folgenden Jahren zwischen 1873 und 1890 wurden mehr als 500 antisemitische Schriften im Deutschen Reich verfasst. In diesen Jahren wurde der „Rassengedanke“ immer stärker hervorgehoben und es kam zu ersten Gründungen antisemitischer Parteien. Wenngleich diese Parteien bei den Reichstagswahlen im Jahre 1893 erzielten Stimmen von 2,9% noch keinen nennenswerte politischen Einfluss hatten, bildeten sie die Basis für die sich später entwickelnde antijüdische Bewegung. Mit Beginn des 1. Weltkrieges meldete sich eine Vielzahl jüdischer Männer freiwillig zur „Verteidigung ihres Vaterlandes“. Sie wollten damit auch demonstrieren, dass sie sich in erster Linie als Deutsche fühlten und erhofften sich damit, ihre Verbundenheit mit der Deutschen Nation unter Beweis stellen zu können. Dies verschaffte der jüdischen Bevölkerung jedoch nicht die erhoffte Anerkennung in der Gesellschaft. Mit dem Ende des Krieges kam es in Deutschland verstärkt zu antisemitischen Aktivitäten. Wie vor Beginn des 1. Weltkrieges wurde die jüdische Minderheit, die weniger als 1% der deutschen Bevölkerung ausmachte, in den Nachkriegsjahren zum „Sündenbock“ für die Probleme, der durch den Krieg und dessen Folgen traumatisierten Bevölkerung, gemacht. Die antisemitische Propaganda, die sich auf dem aus dem Kaiserreich übernommen „Rassengedanken“ stützte, bezeichnete die jüdische Bevölkerung als Träger negativer Rasse- und Charakter-Eigenschaften. Den Juden wurde vorgeworfen sich nicht am Krieg beteiligt und sich stattdessen durch dubiose Geschäfte bereichert zu haben. Insbesondere im Zusammenhang mit der so genannten „Dolchstoßlegende“ wurde den Juden die Hauptschuld an der Kriegsniederlage gegeben. Antisemitische Parteien fanden in diesen Jahren immer mehr Anhänger, die sich insbesondere aus dem Mittelstand und dem Bildungsbürgertum rekrutierten. Vor allem Kleinhändler, Ärzte und Anwälte hegten eine starke Angst vor den vermeintlich überlegenen Juden. Besonders die aus dem Osten zugewanderten orthodoxen osteuropäischen Juden mit ihrem traditionellen und fremdartigen Erscheinungsbild zogen den Hass der Bevölkerung auf sich. Aus diesem Grund verlangten nationale Gruppen die weitere Einwanderung von Juden aus dem Osten zu stoppen, da sie diese für die wirtschaftlichen Probleme im Deutschen Reich verantwortlich machten. Durch ostjüdische Revolutionäre wie Rosa Luxemburg, die die Bevölkerung zum Klassenkampf und Bürgerkrieg aufriefen, fiel es rechten Gruppierungen leicht, diese als Vorboten des Bolschewismus zu stigmatisieren. Die Juden galten als Verfechter der kommunistischen Revolution und auch die Weimarer Republik galt als „von Grund auf jüdisch“. Die Repräsentanten der Weimarer Republik waren als so genannte „November-Verbrecher“ verhasst, die angeblich dem Judentum und dem westlichen Kapitalismus in die Hände spielten. Am 24. Juni 1922 ließ eine rechtsextreme Organisation Walther Rathenau ermorden, der der erste jüdische Außenminister des Deutschen Reiches war. Schon 1920 rief die 1918 gegründete Deutschnationale Volkspartei (DNVP) zum Kampf gegen die „Vorherrschaft des Judentums in Regierung und Öffentlichkeit“ auf.[3] Am 24. Februar 1920 entstand aus der Deutschen Arbeiterpartei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), an deren Spitze Adolf Hitler stand. Nach dem gescheiterten Putsch Hitlers wurde diese Partei im Jahre 1924 zwar zunächst verboten, in den Jahren 1924 bis 1930 organisierte Adolf Hitler die Partei jedoch neu und nutzte die durch die Weltwirtschaftskrise ausgelöste Massenverelendung, um für das vor allem antisemitische Programm der Partei in der deutschen Bevölkerung zu werben. Nach den immer größeren Wahlerfolgen der NSDAP, in den Jahren der Wirtschaftskrise, wurde Adolf Hitler schließlich am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt.
[...]
[1] „ Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur Theilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher Ämter vom religiösen Bekenntniß unabhängig sein.“ -Gesetz betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung vom 3. Juli 1869.
[2] „ Menschen die eine semitisch Sprache sprechen. Zu den semitisch sprechenden Völkern der Antike zählen die Bewohner von Aram, Assyrien, Babylonien, Kanaan (einschließlich der Israeliten) und Phönikien. Heute sprechen die Araber und die Juden, insbesondere in Israel, noch semitische Sprachen.“ –Definition der Encarta-Enzyklopädie.
[3] Aus dem Parteiprogramm des Deutschnationalen Volkspartei von 1920
- Citar trabajo
- Johannes Richter (Autor), 2008, Der Boykott jüdischer Geschäfte vom 1. April 1933 , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117689