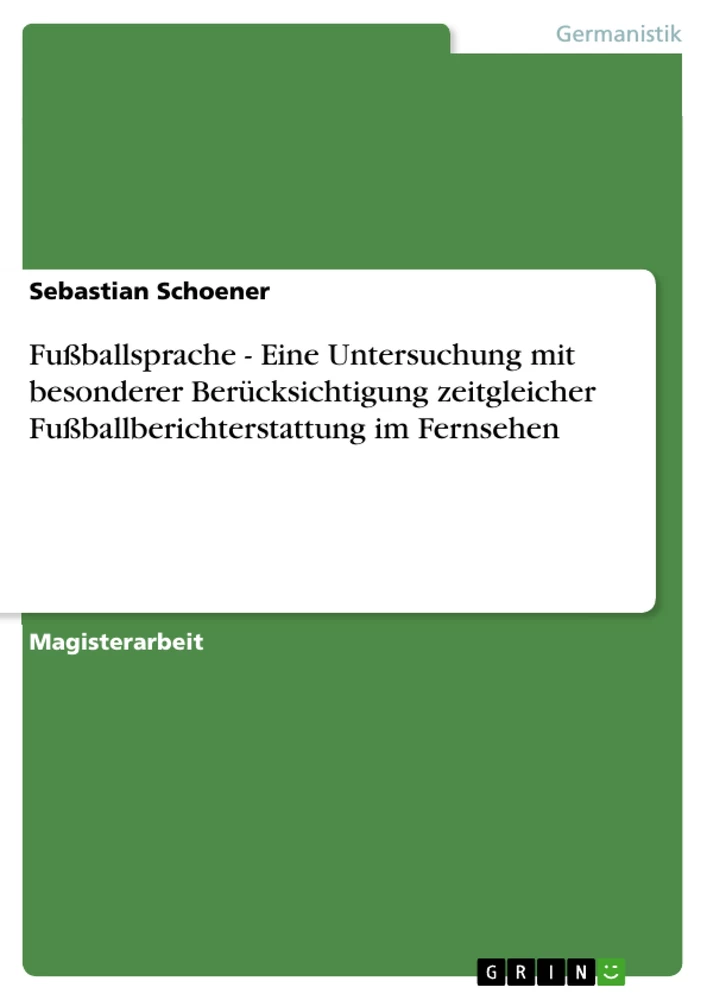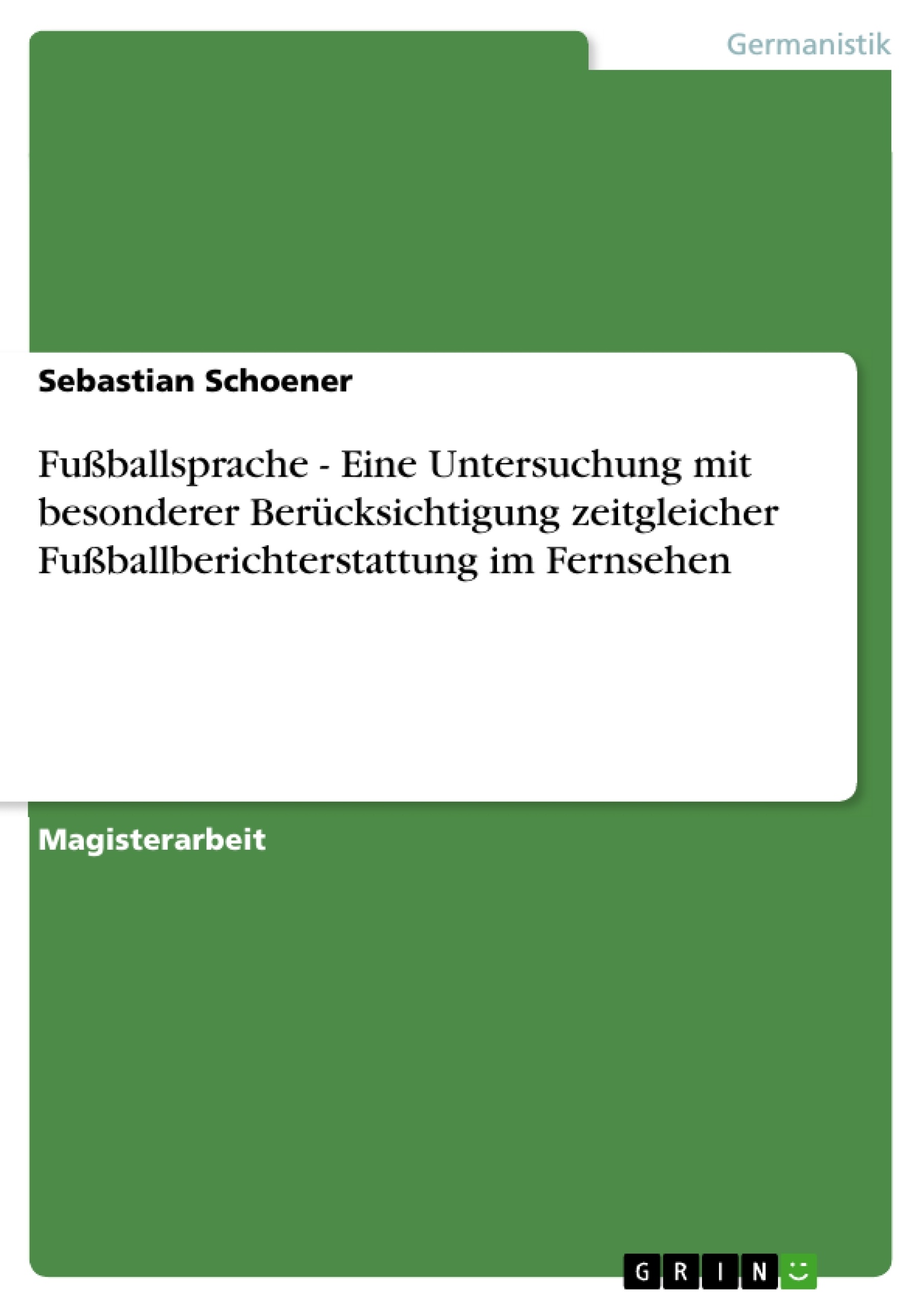Die vorliegende Arbeit macht sich zur Aufgabe über Fußball zu diskutieren und dabei eine ganz bestimmte Facette dieses Massensports näher zu beleuchten. Die Rede ist von der Fußballsprache, insbesondere ihrer spezifischen Erscheinungsform im Fernsehen.
Der Aufbau gliedert sich dabei in drei Teile, von denen die ersten beiden deskriptiv gehalten sind, ehe im Anschluss daran ein analytischer Abschnitt folgt. Zu Beginn wird der Untersuchungskorpus der Fußballsprache näher beleuchtet. Als Basis hierfür dient der Aspekt ‚Fußball als mediatisierte Wirklichkeit’, unter welchem nicht nur die historische Entstehung des Sports, sondern auch dessen publizistischer Charakter herausgearbeitet werden. Einen zusätzlichen Grundstock für die Themenstellung liefert des Weiteren eine definitorische Auseinandersetzung mit dem Terminus ‚Fußballsprache’. Wie sich zeigen wird, stellt sich dieser als Bündelung mehrerer Konstituenten dar. Hinsichtlich dessen ist es allerdings nicht der Anspruch vorliegender Arbeit, exakte Kategorisierungsversuche zu unternehmen. Stattdessen wird das Konglomerat der Fußballsprache strukturell erklärt, um dadurch eine Grundlage für die anschließende linguistische Untersuchung desselben zu schaffen.
Der nächste Teilabschnitt setzt sich dann auf zweierlei Weise mit der Berichterstattung über Fußball auseinander. Einerseits stellt er dessen historische Entwicklung innerhalb der einzelnen Medienformen – Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internet – dar, andererseits sucht er selbige Medienformen nach deren spezifischen kommunikativen Besonderheiten zu differenzieren. Die eigentliche Auseinandersetzung mit der Thematik vollzieht sich dann in den folgenden beiden Teilabschnitten. Zuerst werden die Charakteristika der Sprache der Fußballberichterstattung mit Hilfe der Forschungsliteratur eingehend dokumentiert, wobei die zur Veranschaulichung verwendeten Sprachbeispiele auch aus eigenen Erfahrungen als Rezipient resultieren. Im Weiteren sollen die auf diese Weise erarbeiteten Kennzeichen der Fußballsprache schließlich analytisch auf ein konkretes im Fernsehen übertragenes Fußballspiel angewendet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hinführung: Fußball, Medien und Sprache
- 1. Fußballsprache als Untersuchungskorpus
- 1.1 Fußball als mediatisierte Wirklichkeit
- 1.2 Was ist Fußballsprache?
- 2. Medien und Fußballberichterstattung
- 2.1 Die historische Entwicklung der Medienformen
- 2.2 Die Differenzierung der Medienformen anhand kommunikativer Aspekte
- III. Weiterführung: Sprache der Fußballberichterstattung
- 1. Komposition
- 2. Derivation
- 3. Auslassungen
- 4. Parenthesen
- 5. Dominierende Wortfelder
- 5.1 „Gewalt“
- 5.2 „Leistung“
- 5.3 „Unterhaltung“
- 6. Metaphorik
- 7. Metonymie
- 8. Simplifizierende Abstraktion
- 9. Superlativstil/Hyperbolik
- 10. „Human-Touch“
- 11. Personalisierung
- 12. Pathos
- 13. Euphemismen
- 14. Nationalismus
- 15. Spitz-, Beinamen und Antonomasien
- 16. Sonstiges
- IV. Analyse zeitgleicher Fußballberichterstattung im Fernsehen
- 1. Komposition
- 2. Derivation
- 3. Auslassungen
- 4. Parenthesen
- 5. Dominierende Wortfelder
- 5.1 „Gewalt“
- 5.2 „Leistung“
- 5.3 „Unterhaltung“
- 6. Metaphorik
- 7. Metonymie
- 8. Simplifizierende Abstraktion
- 9. Superlativstil/Hyperbolik
- 10. „Human-Touch“
- 11. Personalisierung
- 12. Pathos
- 13. Euphemismen
- 14. Nationalismus
- 15. Spitz-, Beinamen und Antonomasien
- 16. Sonstiges
- 17. Weitere Auffälligkeiten
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Fußballsprache, insbesondere ihre Erscheinungsform in der zeitgleichen Fernsehberichterstattung. Ziel ist es, die sprachlichen Besonderheiten dieser Berichterstattung zu beschreiben und zu analysieren. Die Arbeit verbindet deskriptive und analytische Ansätze.
- Fußball als mediatisierte Wirklichkeit
- Definition und Charakteristika der Fußballsprache
- Sprachliche Mittel in der Fußballberichterstattung (Komposition, Derivation, Metaphorik etc.)
- Analyse der zeitgleichen Fernsehberichterstattung
- Kommunikative Aspekte verschiedener Medien im Kontext der Fußballberichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Wahl des Themas mit dem persönlichen Interesse des Autors an Fußball und Sprache. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und erläutert die methodische Vorgehensweise. Der Bezug zu dem "Deutschen Fußballspruch des Jahres" verdeutlicht die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs und seiner Sprache. Die Arbeit fokussiert auf die sprachliche Ausgestaltung der Fußballberichterstattung im Fernsehen.
II. Hinführung: Fußball, Medien und Sprache: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Analyse. Zunächst wird der Begriff "Fußballsprache" definiert und eingegrenzt. Es wird herausgestellt, dass Fußball als mediatisierte Wirklichkeit zu verstehen ist, wobei die historische Entwicklung des Sports und die Rolle der Medien betont werden. Anschließend werden verschiedene Medienformen (Presse, Hörfunk, Fernsehen, Internet) in ihrer historischen Entwicklung und ihren kommunikativen Besonderheiten im Kontext der Fußballberichterstattung verglichen und differenziert.
III. Weiterführung: Sprache der Fußballberichterstattung: Dieser Abschnitt beschreibt die sprachlichen Charakteristika der Fußballberichterstattung auf Basis bestehender Forschungsliteratur und eigener Beobachtungen. Es werden verschiedene stilistische Mittel wie Komposition, Derivation, Auslassungen, Parenthesen, dominierende Wortfelder ("Gewalt", "Leistung", "Unterhaltung"), Metaphorik, Metonymie, Simplifizierende Abstraktion, Superlativstil/Hyperbolik, "Human-Touch", Personalisierung, Pathos, Euphemismen, Nationalismus, Spitznamen und Antonomasien analysiert und mit Beispielen illustriert.
IV. Analyse zeitgleicher Fußballberichterstattung im Fernsehen: In diesem Kapitel wird die im vorherigen Abschnitt erarbeitete linguistische Analyse auf konkrete Beispiele aus der zeitgleichen Fernsehberichterstattung angewendet. Die gleichen sprachlichen Mittel wie in Kapitel III werden untersucht und ihre Funktion im Kontext des Fernsehübertragung analysiert. Zusätzliche Auffälligkeiten der Sprache im Fernsehen werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Fußballsprache, Medien, Fernsehberichterstattung, Linguistik, Stilistik, Metaphorik, Metonymie, Zeitgleichkommentar, Gewalt, Leistung, Unterhaltung, Nationalismus, Soziologie des Fußballs, Massenkommunikation.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Fußballsprache in der Medienberichterstattung
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert die Sprache der Fußballberichterstattung, insbesondere im Fernsehen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung und Analyse der sprachlichen Besonderheiten der zeitgleichen Fernsehübertragung von Fußballspielen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die sprachlichen Mittel und Stilfiguren in der Fußballberichterstattung zu identifizieren und zu beschreiben. Es werden deskriptive und analytische Methoden kombiniert, um die kommunikativen Aspekte der Berichterstattung zu untersuchen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Fußball als mediatisierte Wirklichkeit, Definition und Charakteristika der Fußballsprache, verschiedene sprachliche Mittel (Komposition, Derivation, Metaphorik, Metonymie etc.), Analyse der zeitgleichen Fernsehberichterstattung und kommunikative Aspekte verschiedener Medien im Kontext der Fußballberichterstattung. Es werden auch Wortfelder wie "Gewalt", "Leistung" und "Unterhaltung" im Detail untersucht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Hinführung (Fußball, Medien und Sprache), Weiterführung (Sprache der Fußballberichterstattung), Analyse zeitgleicher Fußballberichterstattung im Fernsehen und Schluss. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und vertieft die Analyse schrittweise.
Welche sprachlichen Mittel werden analysiert?
Die Analyse umfasst eine Vielzahl sprachlicher Mittel, darunter Komposition, Derivation, Auslassungen, Parenthesen, dominierende Wortfelder, Metaphorik, Metonymie, simplifizierende Abstraktion, Superlativstil/Hyperbolik, "Human-Touch", Personalisierung, Pathos, Euphemismen, Nationalismus, Spitznamen und Antonomasien.
Welche Medienformen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Medienformen wie Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internet im Hinblick auf ihre historische Entwicklung und ihre kommunikativen Besonderheiten in der Fußballberichterstattung.
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Das vierte Kapitel analysiert konkrete Beispiele aus der zeitgleichen Fernsehberichterstattung, um die im dritten Kapitel beschriebenen sprachlichen Mittel in Aktion zu zeigen und zusätzliche Auffälligkeiten der Fernsehsprache hervorzuheben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fußballsprache, Medien, Fernsehberichterstattung, Linguistik, Stilistik, Metaphorik, Metonymie, Zeitgleichkommentar, Gewalt, Leistung, Unterhaltung, Nationalismus, Soziologie des Fußballs, Massenkommunikation.
Wo liegt der Fokus der Arbeit?
Der Fokus der Arbeit liegt auf der sprachlichen Ausgestaltung der Fußballberichterstattung im Fernsehen und der Analyse der zeitgleichen Kommentare.
Welche methodische Vorgehensweise wird verwendet?
Die Arbeit kombiniert deskriptive und analytische Ansätze, um die sprachlichen Besonderheiten der Fußballberichterstattung umfassend zu erfassen.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Schoener (Autor:in), 2008, Fußballsprache - Eine Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung zeitgleicher Fußballberichterstattung im Fernsehen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117686