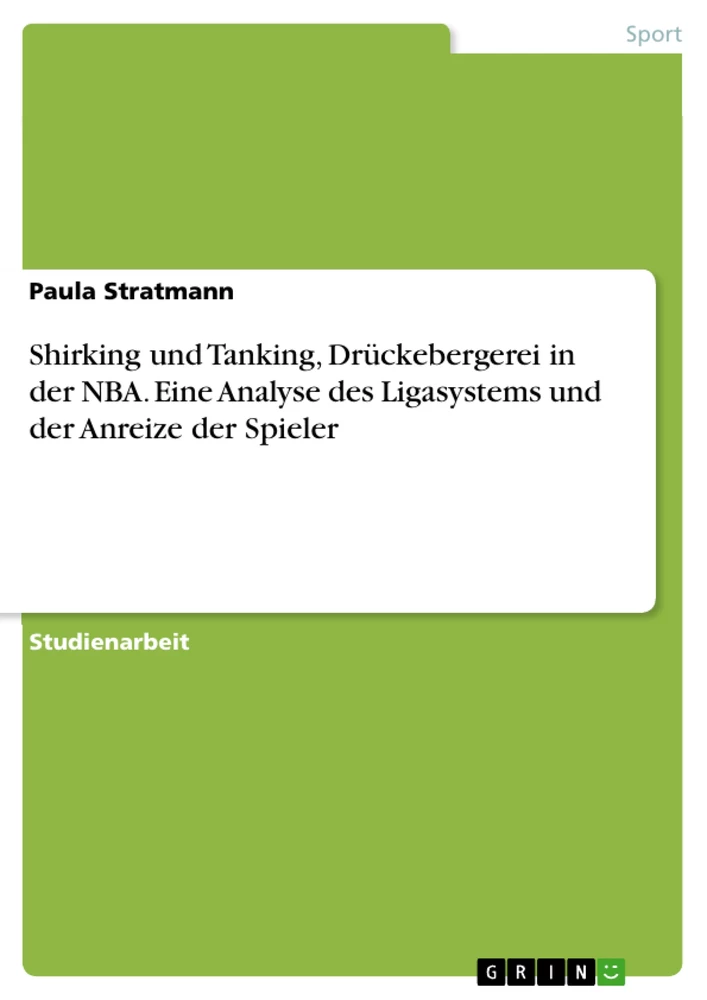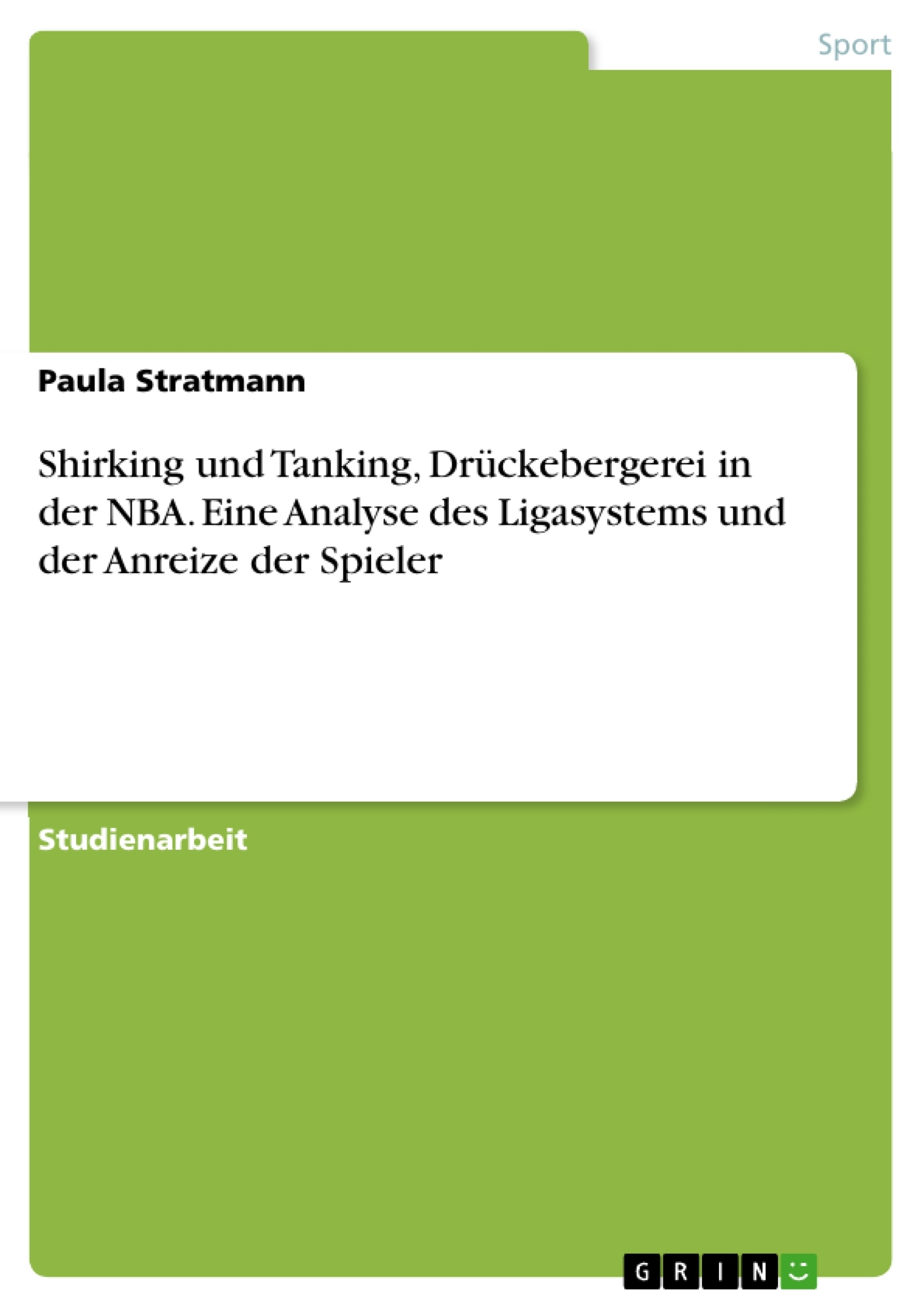Shirking und Tanking sind Methoden in der National Basketball League, mit denen ein Team oder Spieler mit nicht maximaler Leistungsanstrengung ein Ziel verfolgt, dass ihm maximale Rendite verspricht. So lohnt es sich für Teams am Ende der Saison, wenn sie es nicht in die Playoffs geschafft haben, einen möglichst schlechten Tabellenplatz zu erreichen, damit sie in den Drafts eine bessere Ausgangsposition haben. Diese Arbeit analysiert das System und die Anreize von Shirking und Tanking und stellt eventuelle Lösungsmöglichkeiten dar.
Die garantierten Vertragsgehälter in der National Basketball Association (NBA) steigen kontinuierlich. Superstars wie Kevin Garnett unterschreiben Langzeitverträge, die eine garantierte Entlohnung von ungefähr 126 Millionen US-Dollar beinhalten. Zweifellos erregt ein solcher Betrag öffentliche Aufmerksamkeit und führt zu einer Analyse der Leistung des Sportlers. Die allgemeine Auffassung ist, dass weniger Aufwand betrieben würde, sobald sie einen langfristigen Vertrag unterschrieben haben. Diese Einbuße der Leistung des Spielers lässt sich auf das sogenannte „shirking“ zurückführen, welches die bewusste Verweigerung eines Arbeitnehmers, seine arbeitsvertragliche Leistung zu erbringen, darstellt. Shirking kann frei mit „Drückebergerei“ übersetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Anreiztheorie und das Prinzipal - Agent Modell
- 2.2 Turniertheorie
- 3. Evidenz in der NBA
- 3.1 Langzeitverträge
- 3.2 Draftsysteme
- 4. Maßnahmen gegen Drückebergerei
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Anreize und die Umsetzung von Drückebergerei im Profisport, insbesondere in der National Basketball Association (NBA). Es wird untersucht, unter welchen Bedingungen sich Drückebergerei (Shirking und Tanking) für Spieler und Teams lohnt und wie Anreizstrukturen angepasst werden können, um dieses Verhalten zu verhindern. Die Arbeit beleuchtet die ökonomischen Hintergründe und Implikationen dieser Problematik.
- Anreizstrukturen in der NBA und deren Einfluss auf Spielerverhalten
- Analyse von Drückebergerei ("Shirking" und "Tanking") in der NBA
- Anwendung der Anreiz- und Turniertheorie auf die NBA
- Prinzipal-Agent-Problematik im Kontext von Langzeitverträgen und Draftsystemen
- Mögliche Maßnahmen zur Vorbeugung von Drückebergerei
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Drückebergerei (Shirking und Tanking) in der NBA ein. Sie beleuchtet die steigenden garantierten Gehälter von NBA-Spielern und die damit verbundene Debatte über deren Leistungsbereitschaft. Die Arbeit untersucht die Anreize für Drückebergerei, die sowohl durch Langzeitverträge als auch durch das Ligasystem und dessen Draftverfahren entstehen. Insbesondere das "Tanking", also das absichtliche Verlieren von Spielen, um im Draft bessere Spieler auswählen zu können, wird als zentrales Thema hervorgehoben. Die Arbeit skizziert ihren weiteren Aufbau und die Methodik.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die Analyse. Es erklärt die ökonomische Anreiztheorie und das Prinzipal-Agent-Modell, um das Verhalten von Spielern und Teams im Kontext von Informationsasymmetrien zu verstehen. Die Anreiztheorie wird im Zusammenhang mit vollständiger und unvollständiger Information erläutert. Das Prinzipal-Agent-Modell wird als Rahmenmodell für die Analyse der Beziehung zwischen Liga/Team (Prinzipal) und Spieler/Team (Agent) eingeführt. Moral Hazard als zentrales Problem im Kontext von unvollständigen Verträgen wird diskutiert.
3. Evidenz in der NBA: Dieses Kapitel untersucht empirische Evidenz in der NBA bezüglich Drückebergerei. Es analysiert die Auswirkungen von Langzeitverträgen auf die Spielerleistung und diskutiert den Einfluss des Draftsystems auf das Verhalten der Teams. Die Kapitel analysieren, wie Langzeitverträge und das Draftsystem Anreize für "Shirking" und "Tanking" setzen und wie sich diese Phänomene in der Datenlage widerspiegeln. Es werden hier Daten und Studien aus der NBA herangezogen um das Modell zu überprüfen.
Schlüsselwörter
Drückebergerei, Shirking, Tanking, Anreiztheorie, Prinzipal-Agent-Modell, NBA, Langzeitverträge, Draftsysteme, Wettbewerbsgleichgewicht, Informationsasymmetrie, Moral Hazard, Risikoaversion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Anreize und Drückebergerei in der NBA
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert Anreize und die Umsetzung von Drückebergerei (Shirking und Tanking) im Profisport, speziell in der National Basketball Association (NBA). Sie untersucht die Bedingungen, unter denen sich Drückebergerei für Spieler und Teams lohnt, und wie Anreizstrukturen angepasst werden können, um dieses Verhalten zu verhindern. Die ökonomischen Hintergründe und Implikationen werden beleuchtet.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die ökonomische Anreiztheorie, das Prinzipal-Agent-Modell und die Turniertheorie. Diese werden verwendet, um das Verhalten von Spielern und Teams im Kontext von Informationsasymmetrien zu verstehen und zu analysieren.
Welche Aspekte der NBA werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Langzeitverträgen und dem Draftsystem auf das Spielerverhalten und die Entstehung von Drückebergerei (Shirking und Tanking). Sie analysiert, wie diese Strukturen Anreize für solches Verhalten schaffen und wie sich dies in den Daten widerspiegelt.
Was ist "Shirking" und "Tanking"?
„Shirking“ beschreibt das bewusste Unterschreiten der eigenen Leistungsfähigkeit durch Spieler. „Tanking“ bezeichnet das absichtliche Verlieren von Spielen durch Teams, um im Draft bessere Spieler auswählen zu können.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (Anreiztheorie, Prinzipal-Agent-Modell, Turniertheorie), Evidenz in der NBA (Langzeitverträge, Draftsysteme), Maßnahmen gegen Drückebergerei und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Drückebergerei, Shirking, Tanking, Anreiztheorie, Prinzipal-Agent-Modell, NBA, Langzeitverträge, Draftsysteme, Wettbewerbsgleichgewicht, Informationsasymmetrie, Moral Hazard, Risikoaversion.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Die Arbeit analysiert die Anreizstrukturen in der NBA und deren Einfluss auf das Spielerverhalten, untersucht Drückebergerei (Shirking und Tanking), wendet die Anreiz- und Turniertheorie auf die NBA an, betrachtet die Prinzipal-Agent-Problematik im Kontext von Langzeitverträgen und Draftsystemen und schließlich mögliche Maßnahmen zur Vorbeugung von Drückebergerei.
Wie wird die Problematik der Drückebergerei in der NBA untersucht?
Die Arbeit untersucht empirische Evidenz in der NBA, analysiert die Auswirkungen von Langzeitverträgen auf die Spielerleistung und diskutiert den Einfluss des Draftsystems auf das Verhalten der Teams. Dabei werden Daten und Studien aus der NBA herangezogen.
- Quote paper
- Paula Stratmann (Author), 2021, Shirking und Tanking, Drückebergerei in der NBA. Eine Analyse des Ligasystems und der Anreize der Spieler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1176284