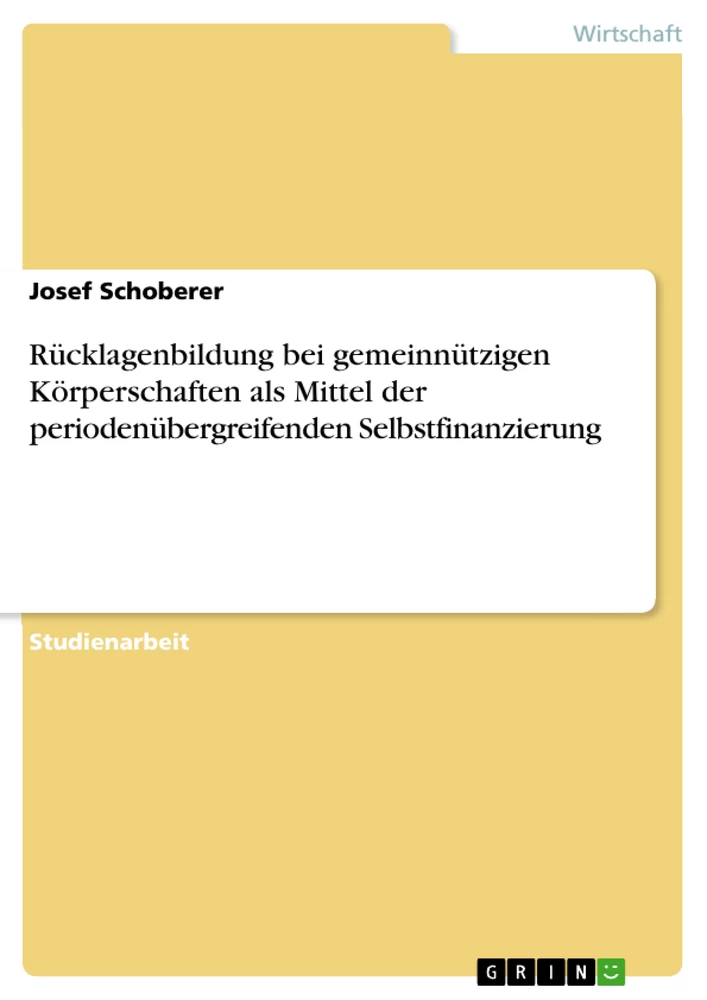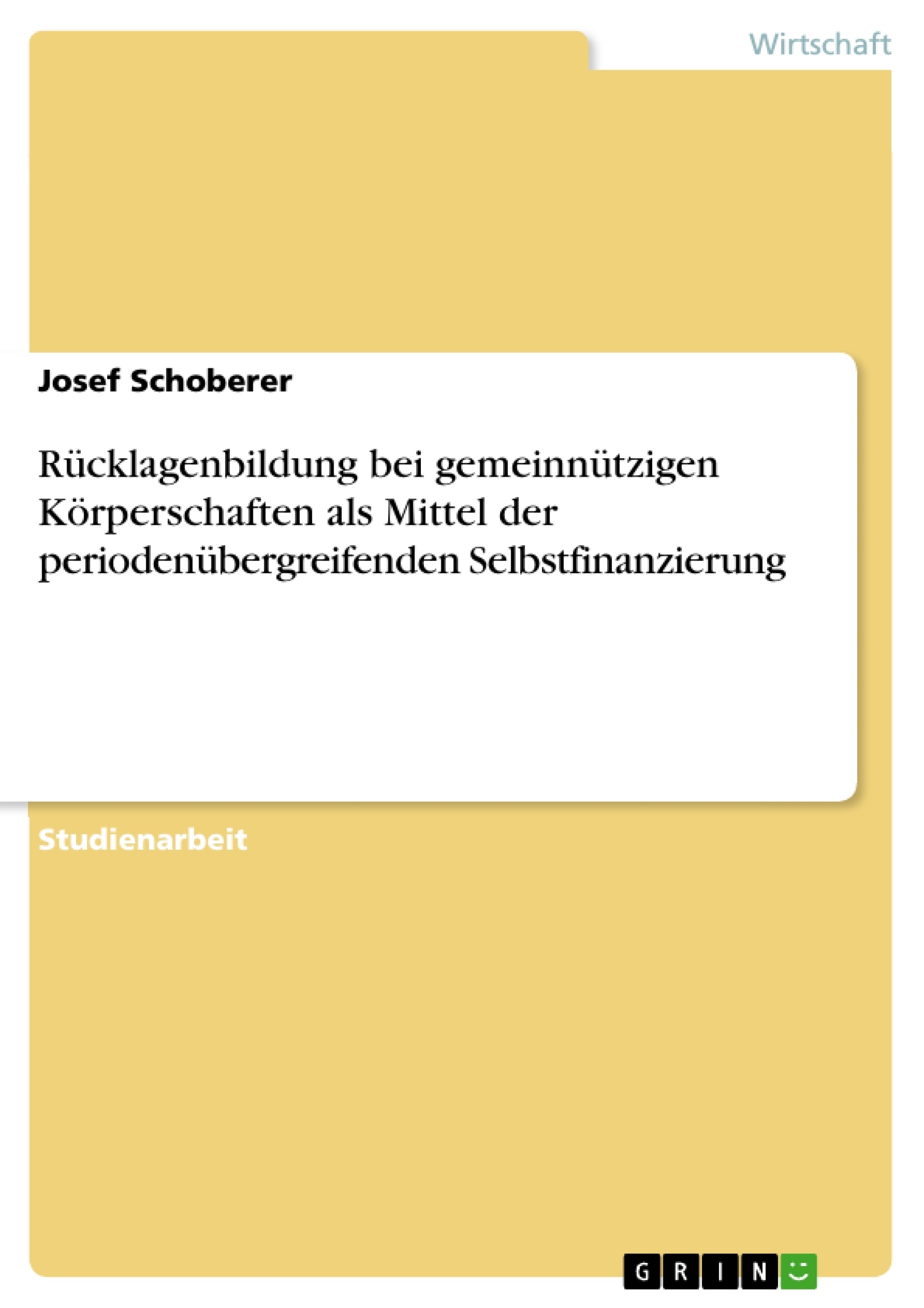Die Grundlagen und Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit sind in den §§ 51 bis 68 AO festgelegt. Nach dem Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung müssen gemeinnützige Körperschaften die zugeflossenen Mittel im Jahr der Vereinnahmung, spätestens jedoch mit Ablauf des Folgejahrs für satzungsmäßige Zwecke verwenden. Dies hat zur Folge, dass das Rechtsgebilde die Mittel zwar entsprechend der Satzung verwendet, jedoch nicht immer sinnvoll eingesetzt und die satzungsmäßigen Ziele dadurch nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen zu realisieren sind.
Um diese zu erreichen und auch der gemeinnützigen Körperschaft die Möglichkeit der „Risikovorsorge“ und der „Vermögensbildung“ zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber die zulässige Rücklagenbildung in der AO und im AEAO gesetzlich geregelt
Selbstfinanzierung ist ein Synonym der Innenfinanzierung, also kein Mittelzufluss von außen wie bei der Außenfinanzierung (Mittelzufluss von außerhalb des Unternehmens).
Bei der Innenfinanzierung erzielt eine gemeinnützige Körperschaft Einnahmen bzw. Umsätze in seinen steuerlichen Tätigkeitsbereichen. Dazu müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen müssen die Einnahmen bzw. Verkaufserlöse der Körperschaft in liquider Form zugeflossen sein und somit das Bankguthaben oder den Kassenbestand erhöht haben. Zum anderen dürfen dem Geldmittelzufluss in derselben Periode keine ausgabewirksamen Aufwendungen gegenüberstehen.
Diese Bedingungen werden bei der (offenen) Selbstfinanzierung erfüllt, wenn finanzwirtschaftliche Überschüsse bzw. Gewinne in den steuerlichen Tätigkeitsbereichen erzielt werden und diese in derselben Periode nicht oder nur zum Teil für ausgabewirksamen Aufwand verwendet werden.
Diese Mittel stehen der gemeinnützigen Körperschaft zur Realisierung bestimmter Projekte oder zum Vermögensaufbau zur Verfügung.
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der zulässigen Rücklagenbildung nach dem Gemeinnützigkeitsrecht. Er soll dem interessierten Leser (Anwender) die Möglichkeiten aufzeigen und deren Anwendung erleichtern. Die Mittelverwendungsrechnung ist nicht Gegenstand des Beitrags.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Rücklagenbegriff im Gemeinnützigkeitsrecht
- 3. Grundsatz und Ausnahmen von der zeitnahen Mittelverwendung nach den Gemeinnützigkeitsvorschriften der Abgabenordnung
- 3.1 Grundsatz der zeitgemäßen Mittelverwendung
- 3.2 Ausnahmen von der zeitgemäßen Mittelverwendung
- 4. Zulässige Rücklagenbildung
- 4.1 Die sog. zweckgebundene (projektbezogene) Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO
- 4.1.1 Zweckgebundene (projektbezogene) Rücklagen
- 4.1.2 Betriebsmittelrücklage
- 4.2 Die sog. freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7 a und b und Nr. 12 AO, die auch zum Aufbau eines Vermögens eingesetzt werden können
- 4.2.1 Rücklage aus Überschüssen der Vermögensverwaltung nach § 58 Nr. 7 a 1. Halbsatz AO
- 4.2.2 Sonstige freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7 a 2. Halbsatz AO
- 4.2.3 Rücklagen zum Erwerb von Gesellschaftsrechten nach § 58 Nr. 7 b AO
- 4.2.4 Stiftungsrücklage nach § 58 Nr. 12 AO
- 4.3 Sonstige Rücklagen im Bereich der Vermögensverwaltung und im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
- 4.3.1 Vermögensverwaltung
- 4.3.2 Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
- 4.1 Die sog. zweckgebundene (projektbezogene) Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO
- 5. Synopse
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag zielt darauf ab, die zulässige Rücklagenbildung bei gemeinnützigen Körperschaften nach dem Gemeinnützigkeitsrecht zu erläutern und die Anwendung der entsprechenden Vorschriften zu vereinfachen. Die Mittelverwendungsrechnung wird dabei nicht behandelt.
- Der Rücklagenbegriff im Gemeinnützigkeitsrecht im Vergleich zum handels- und steuerrechtlichen Rücklagenbegriff.
- Zulässige Formen der Rücklagenbildung nach der Abgabenordnung (AO).
- Unterscheidung zwischen zweckgebundenen und freien Rücklagen.
- Die Bedeutung der zeitnahen Mittelverwendung und Ausnahmen davon.
- Zusammenhang zwischen Rücklagenbildung und Vermögensaufbau gemeinnütziger Körperschaften.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung bei gemeinnützigen Körperschaften nach §§ 51 bis 68 AO und die daraus resultierenden Herausforderungen für die sinnvolle Mittelverwendung und die Erreichung satzungsmäßiger Ziele. Sie führt in das Thema der zulässigen Rücklagenbildung als Mittel der Selbstfinanzierung ein, um Risiken vorzubeugen und Vermögensbildung zu ermöglichen. Die gesetzliche Regelung in AO und AEAO wird erwähnt, und der Unterschied zwischen Innen- und Außenfinanzierung wird erklärt. Der Fokus liegt auf der offenen Selbstfinanzierung, bei der finanzielle Überschüsse in den steuerlichen Tätigkeitsbereichen erzielt und nicht sofort für Ausgaben verwendet werden.
2. Der Rücklagenbegriff im Gemeinnützigkeitsrecht: Dieses Kapitel beleuchtet den Unterschied zwischen dem Rücklagenbegriff im Gemeinnützigkeitsrecht und dem im Handels- und Steuerrecht. Es betont, dass der gemeinnützigkeitsrechtliche Rücklagenbegriff weiter gefasst ist und die Abgabenordnung die Grenzen der Vermögensbildung im Einklang mit dem Ziel der Gemeinnützigkeit und der zeitnahen Mittelverwendung definiert. Der Rücklagenbegriff wird im Kontext des Bilanzrechts und der Kapitalbildung erläutert (§§ 270 und 272 Abs. 2 bis 4 HGB), wobei der Gewinnvortrag keine Rücklage darstellt. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit, die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen nachzuweisen und die Möglichkeit einer einfachen Kontrolle durch das Finanzamt.
Schlüsselwörter
Rücklagenbildung, Gemeinnützigkeitsrecht, Abgabenordnung (AO), Selbstfinanzierung, zeitnahe Mittelverwendung, Vermögensbildung, Zweckgebundene Rücklagen, Freie Rücklagen, Handelsrecht, Steuerrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Zulässige Rücklagenbildung bei gemeinnützigen Körperschaften"
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit der zulässigen Rücklagenbildung bei gemeinnützigen Körperschaften nach dem deutschen Gemeinnützigkeitsrecht. Er erläutert die relevanten Vorschriften der Abgabenordnung (AO) und vereinfacht deren Anwendung. Die Mittelverwendungsrechnung wird dabei explizit ausgeschlossen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt den Rücklagenbegriff im Gemeinnützigkeitsrecht im Vergleich zum handels- und steuerrechtlichen Rücklagenbegriff. Er untersucht die zulässigen Formen der Rücklagenbildung nach der AO, differenziert zwischen zweckgebundenen und freien Rücklagen, erklärt die Bedeutung der zeitnahen Mittelverwendung und deren Ausnahmen und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Rücklagenbildung und Vermögensaufbau gemeinnütziger Körperschaften.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zum Rücklagenbegriff im Gemeinnützigkeitsrecht, den Grundsätzen und Ausnahmen der zeitnahen Mittelverwendung, den zulässigen Formen der Rücklagenbildung (zweckgebunden und frei), einer Synopse und einem Resümee. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Was ist der Unterschied zwischen dem gemeinnützigkeitsrechtlichen und dem handels-/steuerrechtlichen Rücklagenbegriff?
Der Text hebt hervor, dass der gemeinnützigkeitsrechtliche Rücklagenbegriff weiter gefasst ist als der im Handels- und Steuerrecht. Die Abgabenordnung definiert die Grenzen der Vermögensbildung im Einklang mit dem Ziel der Gemeinnützigkeit und der zeitnahen Mittelverwendung. Der Gewinnvortrag wird beispielsweise nicht als Rücklage betrachtet.
Welche Arten von Rücklagen werden unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen zweckgebundenen (projektbezogenen) Rücklagen nach § 58 Nr. 6 AO (inkl. Betriebsmittelrücklage) und freien Rücklagen nach § 58 Nr. 7 a und b und Nr. 12 AO, die auch zum Aufbau eines Vermögens eingesetzt werden können. Zu den freien Rücklagen gehören beispielsweise Rücklagen aus Überschüssen der Vermögensverwaltung, sonstige freie Rücklagen und Rücklagen zum Erwerb von Gesellschaftsrechten. Zusätzlich werden sonstige Rücklagen im Bereich der Vermögensverwaltung und im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb behandelt.
Welche Bedeutung hat die "zeitnahe Mittelverwendung"?
Die zeitnahe Mittelverwendung ist ein Grundsatz im Gemeinnützigkeitsrecht. Der Text erläutert diesen Grundsatz und die Ausnahmen, die eine Rücklagenbildung ermöglichen. Die zulässige Rücklagenbildung dient der Selbstfinanzierung, um Risiken vorzubeugen und Vermögensbildung zu ermöglichen, ohne das Prinzip der zeitnahen Mittelverwendung zu verletzen.
Wie ist der Zusammenhang zwischen Rücklagenbildung und Vermögensaufbau?
Der Text zeigt den Zusammenhang zwischen der zulässigen Rücklagenbildung und dem Vermögensaufbau gemeinnütziger Körperschaften auf. Die Bildung von Rücklagen, insbesondere von freien Rücklagen, ermöglicht es gemeinnützigen Organisationen, ihr Vermögen aufzubauen und langfristige Ziele zu finanzieren.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden behandelt?
Der Text bezieht sich hauptsächlich auf die Abgabenordnung (AO) und deren relevante Paragraphen (§§ 51 bis 68 AO, § 58 Nr. 6, 7a, 7b, 12 AO) sowie auf das Handelsgesetzbuch (HGB) (§§ 270 und 272 Abs. 2 bis 4 HGB).
- Quote paper
- Josef Schoberer (Author), 2008, Rücklagenbildung bei gemeinnützigen Körperschaften als Mittel der periodenübergreifenden Selbstfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117618