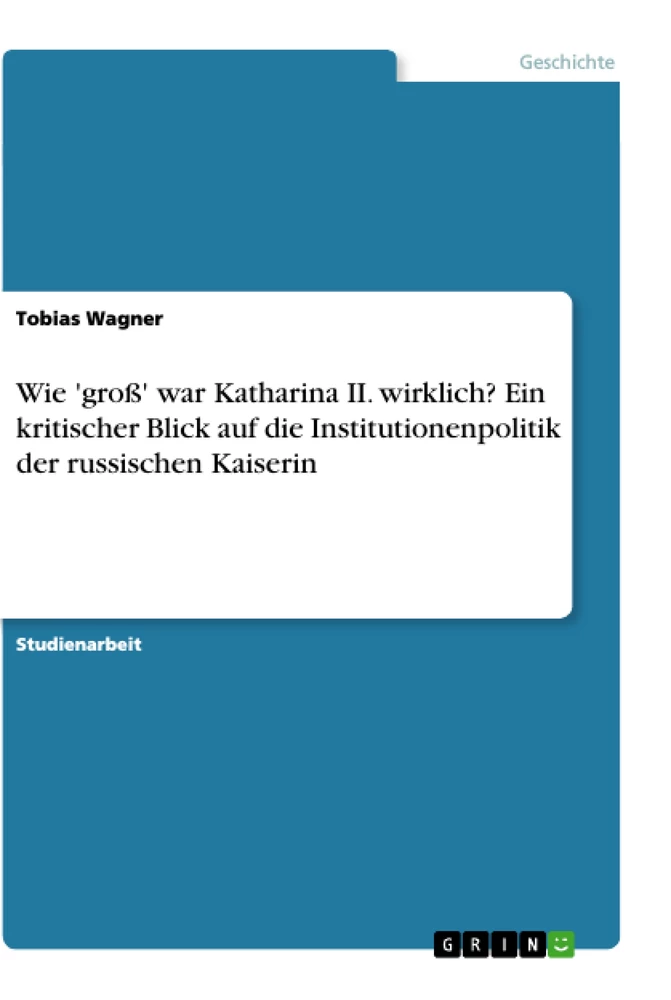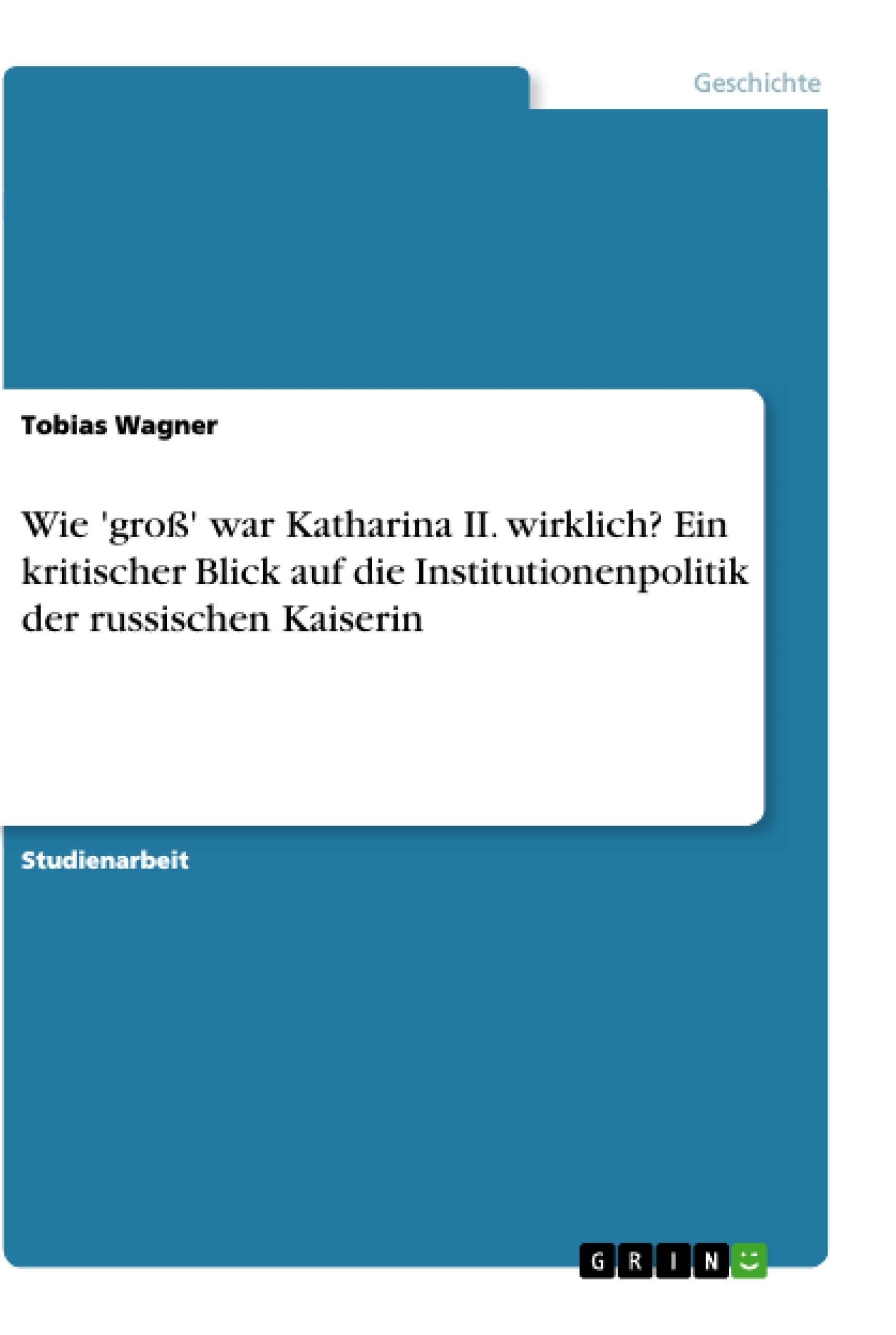Die russische Kaiserin Katharina II. ist die einzige Herrscherin in der Geschichtsschreibung, der der Beiname 'die Große' verliehen wurde. Inwieweit ist diese Bezeichnung gerechtfertigt? Ein Blick auf die Politik der Zarin mit dem Schwerpunkt auf der Schaffung neuer sowie der Erweiterung bestehender Institutionen in der Bildungslandschaft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Reformen Peters des Großen
- 3. Katharinas Bildungspolitik
- 3.1 Neue und erweiterte Institutionen
- 3.2 Ständische Aufstiegsmöglichkeiten
- 3.3 Erlaubnis zum Publizieren
- 4. Negative Aspekte und öffentliche Meinung
- 4.1 Schlussendlich doch Zensur
- 4.2 Abneigung verschiedener Gesellschaftsschichten
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die Bildungspolitik Katharinas der Großen und bewertet deren Erfolg hinsichtlich der Einrichtung und Erweiterung von Bildungseinrichtungen. Er analysiert Katharinas Maßnahmen im Kontext der bestehenden bildungspolitischen Situation im vorangegangenen Russland und bewertet sowohl positive als auch negative Aspekte ihrer Politik.
- Bewertung der Bildungspolitik Katharinas II. im Hinblick auf die Errichtung und Ausweitung von Institutionen.
- Einordnung von Katharinas Reformen im Kontext der Bildungslandschaft vor ihrer Regierungszeit.
- Analyse der positiven Auswirkungen von Katharinas Bildungspolitik.
- Untersuchung negativer Aspekte und öffentlicher Reaktionen auf Katharinas Bildungspolitik.
- Bewertung des Einflusses von Peters des Großen Reformen auf Katharinas Politik.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Der Aufsatz befasst sich kritisch mit der Frage, inwieweit Katharina die Große, insbesondere im Bildungssektor, ihren Beinamen „die Große“ verdient. Der Fokus liegt auf der Einrichtung und Erweiterung von Bildungsinstitutionen als messbare Erfolge ihrer Reformpolitik. Vor diesem Hintergrund wird die bildungspolitische Situation vor ihrer Regierungszeit beleuchtet, um den Kontext ihrer Maßnahmen zu verdeutlichen. Die Arbeit untersucht sowohl positive als auch negative Aspekte ihrer Herrschaft und prüft ihren Erfolg anhand der etablierten Institutionen und den zeitgenössischen Reaktionen.
2. Die Reformen Peters des Großen: Dieses Kapitel beleuchtet die bildungspolitischen Reformen unter Peter dem Großen. Es zeigt, wie Peter den Bedarf an Fachkräften im militärischen und zivilen Bereich erkannte und daraufhin Fach- und allgemeinbildende Schulen gründete. Die Moskauer Mathematik- und Navigationsschule wird als Beispiel für die Etablierung säkularer Bildungseinrichtungen genannt. Der Große Nordische Krieg wird als initialer Motor für diese Reformen identifiziert, wobei der Fokus der Ausbildung im Laufe der Zeit von rein militärischen Aspekten zu breiteren administrativen und diplomatischen Fähigkeiten erweitert wurde. Die positive Wirkung des Auslandsstudiums für russische Studenten und die Weitergabe von Wissen werden hervorgehoben. Abschließend wird Peters Reformwerk als Fundament für die spätere Politik Katharinas II. bewertet.
3. Katharinas Bildungspolitik: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Bildungspolitik Katharinas der Großen. Es untersucht die Neuerrichtung und Erweiterung bestehender Institutionen, die Aufstiegschancen verschiedener Stände und die Erlaubnis zum Publizieren als Schlüsselmaßnahmen. Es zeigt auf, wie diese Maßnahmen die bestehende Bildungslandschaft veränderten und zu einem erweiterten Zugang zu Bildung führten. Die Analyse umfasst die Schaffung neuer Institutionen, die verbesserte Zugangsmöglichkeiten für verschiedene soziale Schichten darstellten und die Liberalisierung des Druckwesens, welche die Verbreitung von Wissen förderte. Die einzelnen Unterkapitel befassen sich mit diesen Aspekten im Detail und tragen zum Gesamtbild von Katharinas Bildungspolitik bei.
4. Negative Aspekte und öffentliche Meinung: Dieses Kapitel präsentiert die Schattenseiten von Katharinas Bildungspolitik und der öffentlichen Reaktion darauf. Die Schließung privater Druckereien, die im Widerspruch zu früheren Maßnahmen stand, wird analysiert. Ebenso werden die unterschiedlichen Reaktionen verschiedener gesellschaftlicher Schichten auf Katharinas Reformen beleuchtet. Es wird gezeigt, dass trotz anfänglicher Erfolge und positiver Resonanz, ihre Politik nicht unumstritten war und auf Widerstand stieß, welcher unter anderem in der Wiedereinführung der Zensur zum Ausdruck kam. Die Kapitel analysiert die Gründe für die Kritik und die Ambivalenz der öffentlichen Meinung gegenüber Katharinas Reformen.
Schlüsselwörter
Katharina die Große, Bildungspolitik, Russland, Zarenreich, Institutionen, Reformen, Peter der Große, Öffentliche Meinung, Zensur, Bildungslandschaft, Ständische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bildungspolitik Katharinas der Großen
Was ist der Gegenstand dieses Aufsatzes?
Der Aufsatz untersucht kritisch die Bildungspolitik Katharinas der Großen in Russland und bewertet deren Erfolg anhand der Errichtung und Erweiterung von Bildungseinrichtungen. Er analysiert ihre Maßnahmen im Kontext der vorhergehenden Bildungslandschaft, insbesondere der Reformen Peters des Großen, und beleuchtet sowohl positive als auch negative Aspekte.
Welche Themen werden im Aufsatz behandelt?
Der Aufsatz behandelt folgende Themen: Bewertung von Katharinas Bildungspolitik hinsichtlich der Einrichtung und Ausweitung von Institutionen; Einordnung ihrer Reformen im Kontext der Bildungslandschaft vor ihrer Regierungszeit; Analyse der positiven Auswirkungen ihrer Politik; Untersuchung negativer Aspekte und öffentlicher Reaktionen; und Bewertung des Einflusses von Peters des Großen Reformen auf Katharinas Politik.
Welche Kapitel umfasst der Aufsatz und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Aufsatz umfasst fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung): Stellt die Forschungsfrage und den Fokus auf messbare Erfolge im Bildungssektor dar. Kapitel 2 (Reformen Peters des Großen): Beleuchtet die bildungspolitischen Reformen unter Peter dem Großen als Grundlage für Katharinas Politik. Kapitel 3 (Katharinas Bildungspolitik): Beschreibt detailliert Katharinas Maßnahmen, einschließlich der Neuerrichtung und Erweiterung von Institutionen, Aufstiegschancen und Publizierungsfreiheit. Kapitel 4 (Negative Aspekte und öffentliche Meinung): Analysiert negative Aspekte, wie z.B. die Wiedereinführung der Zensur, und die öffentlichen Reaktionen darauf. Kapitel 5 (Schluss): (Inhalt nicht explizit im Preview beschrieben).
Welche Schlüsselmaßnahmen von Katharina werden analysiert?
Der Aufsatz analysiert die Neuerrichtung und Erweiterung bestehender Bildungsinstitutionen, die Verbesserung der Aufstiegschancen verschiedener Stände und die anfängliche Erlaubnis zum Publizieren als Schlüsselmaßnahmen von Katharinas Bildungspolitik.
Wie wird die Bildungspolitik Katharinas im Kontext der Geschichte bewertet?
Der Aufsatz bewertet Katharinas Bildungspolitik, indem er sie in den Kontext der bestehenden Bildungslandschaft vor ihrer Regierungszeit und im Bezug auf die vorherigen Reformen Peters des Großen einordnet. Er untersucht sowohl die Erfolge als auch die Misserfolge und die Reaktionen der Öffentlichkeit.
Welche Rolle spielen die Reformen Peters des Großen?
Die Reformen Peters des Großen werden als Grundlage und Kontext für die Bildungspolitik Katharinas der Großen betrachtet. Der Aufsatz zeigt auf, wie Peters Reformen den Bedarf an Fachkräften erkannten und Fach- und allgemeinbildende Schulen gründeten, die als Basis für Katharinas spätere Maßnahmen dienten.
Welche negativen Aspekte werden im Aufsatz hervorgehoben?
Der Aufsatz hebt negative Aspekte wie die spätere Wiedereinführung der Zensur und die unterschiedlichen, teilweise ablehnenden Reaktionen verschiedener Gesellschaftsschichten auf Katharinas Bildungspolitik hervor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Aufsatz am besten?
Schlüsselwörter sind: Katharina die Große, Bildungspolitik, Russland, Zarenreich, Institutionen, Reformen, Peter der Große, Öffentliche Meinung, Zensur, Bildungslandschaft, Ständische Gesellschaft.
- Quote paper
- Tobias Wagner (Author), 2021, Wie 'groß' war Katharina II. wirklich? Ein kritischer Blick auf die Institutionenpolitik der russischen Kaiserin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1174024