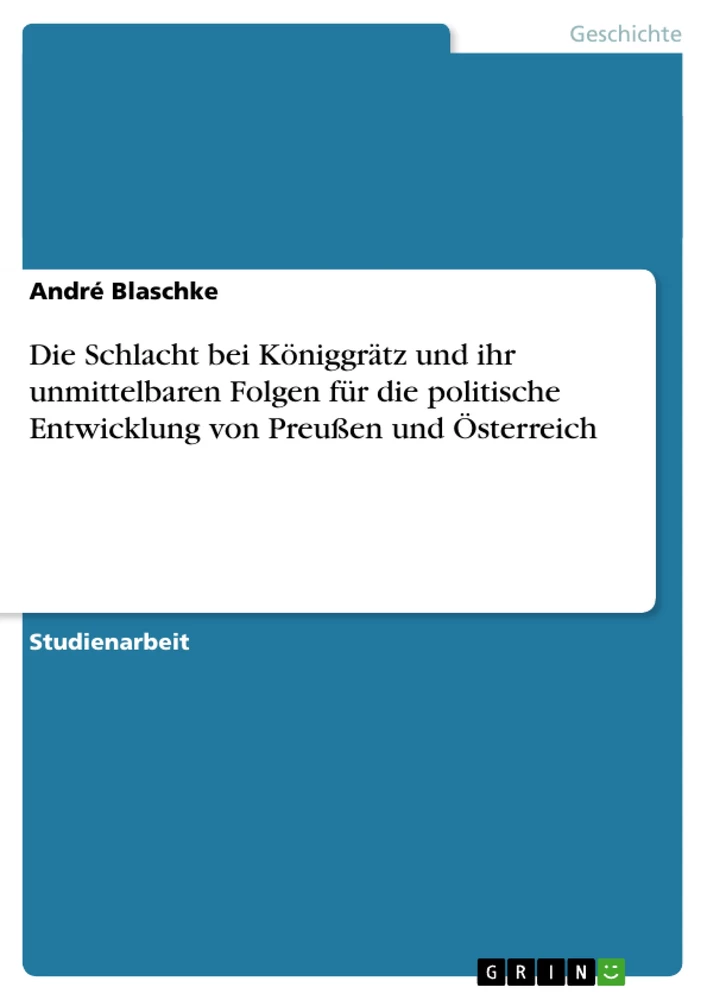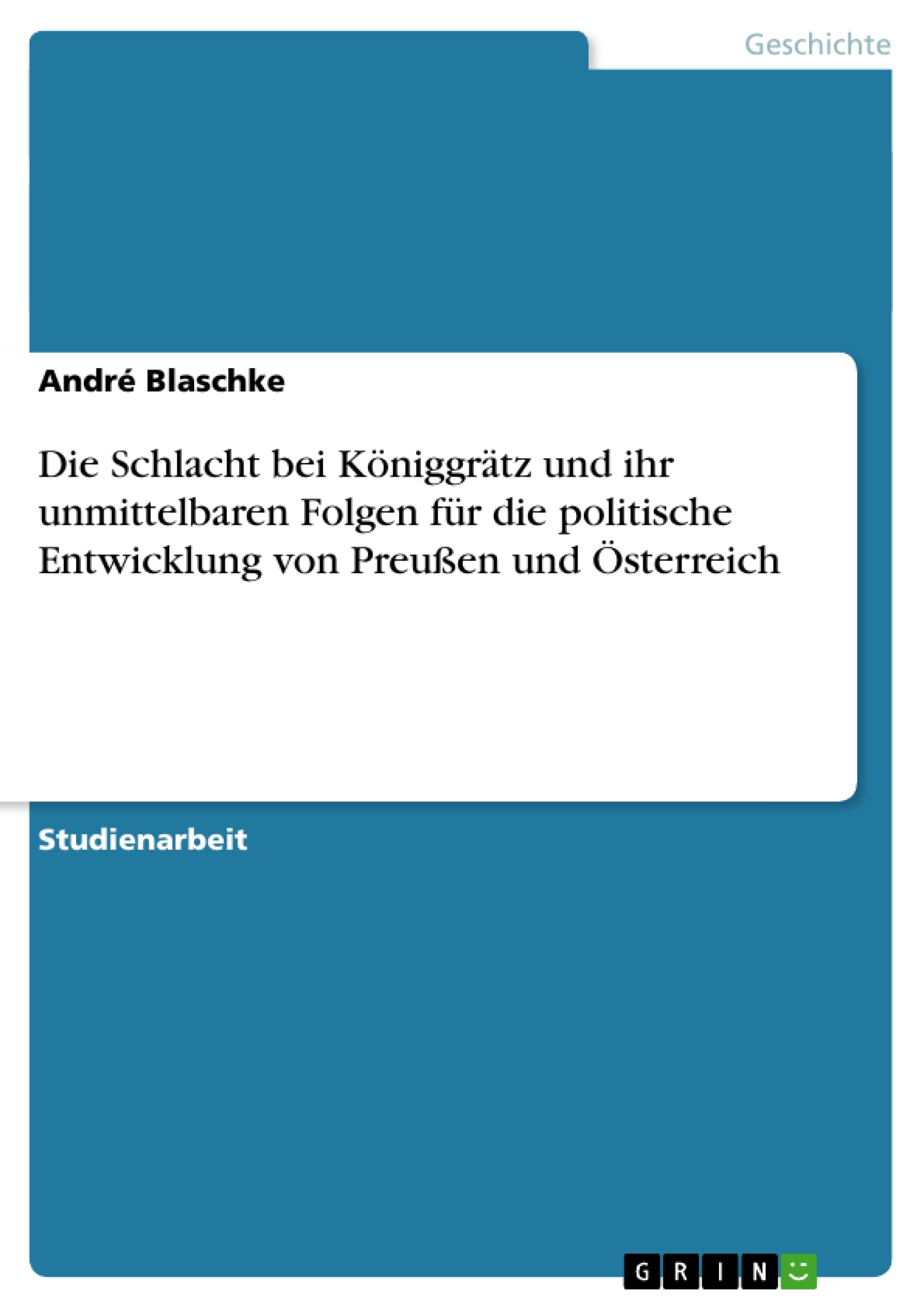Betrachtet man ein Geschichtsbuch mit den wichtigsten historischen Ereignissen der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert, so begegnen einem viele Geschehnisse. Angefangen mit den Befreiungskriegen gegen Napoleon, dem Wiener Kongress 1815, den Revolutionsbewegungen 1848 und als Höhepunkt der Deutsch - Französische Krieg 1870 mit der Kaiserkrönung 1871. Eventuell kann man den Krimkrieg 1853 - 1856 und den Sardinischen Krieg 1859 mit hinzuzählen, da Österreich als Bundesmitglied mit involviert war. Das Jahr 1866 ist hingegen für die Geschichtsschreibung eher unbedeutend. Jedoch nicht für den Verlauf der deutschen Geschichte. Der epochale Umbruch bildete die Vorraussetzung für die Gründung des ersten Deutschen Kaiserreiches.
Schließlich war es die literarische Ausgangssituation, welche mich motivierte, sich mit diesen Ereignissen von 1866 zu beschäftigen. Der Deutsche Krieg und vor allem die Schlacht bei Königgrätz wird in vielen Büchern ausführlich wiedergegeben. Oftmals werden aber nur der Verlauf bzw. die militärischen Operationen beschrieben. Doch welche Folgen hatte der Krieg? Wie entwickeln sich zwei Staaten, die über tausend Jahre miteinander verbunden waren? Was nach dem Zusammenbruch des Deutschen Bundes mit den deutschen Mittel- und Kleinstaaten geschah und wie sie sich auf Grund der Begebenheiten der kommenden Jahre orientierten, ist heute eher nebensächlich.
Ziel meiner Arbeit soll es sein, dem Leser ein Bild davon zu geben, welche Folgen die Schlacht bei Königgrätz für die beiden Großmächte Preußen und Österreich hatte und welche innen- und außenpolitischen Entwicklungen sich nach dem Ende des Dualismus ergaben.
Weiterführend könnte man sich auch mit den Reaktionen befassen, wie die Monarchen der anderen europäischen Großmächte in Frankreich, Russland oder England die Situation bewerteten und über den Zusammenbruch des zentraleuropäischen Staatenbundes dachten. Jedoch wäre dies für diese Arbeit zu umfangreich.
Aufgebaut ist mein Text eher deduktiv. Anfangs erhält man einen Überblick über die Ereignisse im Deutschen Bund im Jahr 1866. Vor allem, wie die einzelnen Staaten politisch und wirtschaftlich entwickelt waren und in welchem Verhältnis sie zu den Führungsstaaten des Bundes standen. Da der Preußisch – Deutsche Krieg nur indirekt zu meinem Thema gehört, beschränke ich mich auf die Endscheidungsschlacht und den Ausgang der Auseinandersetzung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Situation im Deutschen Bund um 1866
- 3. Das Ende des preußisch-österreichischen Dualismus
- 3.1. Königgrätz und das Ende des preußisch-deutschen Krieges 1866
- 3.2. Der Friedensvertrag von Prag und seine territorialen Auswirkungen auf Mitteleuropa für Preußen
- 3.3. „Schmerzhafte Niederlage oder Anstoß zum Neuanfang?”
- 4. Fazit Österreichs politische Neuorientierung nach dem deutschen Krieg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Folgen der Schlacht bei Königgrätz 1866 für Preußen und Österreich. Ziel ist es, die innen- und außenpolitischen Entwicklungen beider Großmächte nach dem Ende des preußisch-österreichischen Dualismus darzustellen.
- Die politische und wirtschaftliche Situation im Deutschen Bund vor 1866
- Die Schlacht bei Königgrätz als Wendepunkt in der deutschen Geschichte
- Die Auswirkungen des Prager Friedensvertrages auf Preußen und Österreich
- Die innenpolitischen Veränderungen in Preußen und Österreich nach 1866
- Die außenpolitische Neuorientierung Österreichs nach dem Krieg
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung des Jahres 1866 für die deutsche Geschichte, die trotz ihrer Bedeutung in vielen Geschichtsbüchern nur oberflächlich behandelt wird. Der Autor betont die Notwendigkeit, die Folgen des Krieges und die Entwicklung der beteiligten Staaten im Detail zu betrachten, und definiert die Zielsetzung der Arbeit, welche die Folgen der Schlacht bei Königgrätz für Preußen und Österreich beleuchten soll. Die Arbeit konzentriert sich auf die politischen und außenpolitischen Entwicklungen nach dem Ende des Dualismus.
2. Zur Situation im Deutschen Bund um 1866: Dieses Kapitel beschreibt die heterogene politische und wirtschaftliche Situation im Deutschen Bund vor 1866. Es hebt die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den norddeutschen, vor allem preußischen, industrialisierten Gebieten und den rückständigen Regionen Süddeutschlands hervor. Die Kapitel analysiert die unterschiedlichen politischen Systeme und die Rolle einzelner Staaten wie Hannover, Sachsen und Thüringen, ihre jeweiligen Beziehungen zu Preußen und Österreich, und wie diese die Entwicklung zum Nationalstaat beeinflussten. Besonderes Augenmerk liegt auf den unterschiedlichen Positionen der beteiligten Akteure gegenüber dem preußischen Führungsanspruch.
3. Das Ende des preußisch-österreichischen Dualismus: Dieses Kapitel behandelt die Schlacht bei Königgrätz und ihre unmittelbaren Folgen, insbesondere den Prager Frieden und dessen territorialen Auswirkungen auf Mitteleuropa. Es analysiert den Übergang vom Dualismus zu einer neuen politischen Ordnung. Die Auswirkungen auf die innere und äußere Politik von Preußen und Österreich werden detailliert untersucht und die verschiedenen Interpretationen der Niederlage Österreichs werden beleuchtet, indem die Frage aufgeworfen wird, ob es sich um eine "Schmerzhafte Niederlage oder Anstoß zum Neuanfang?" handelte.
4. Fazit Österreichs politische Neuorientierung nach dem deutschen Krieg: (Diese Zusammenfassung wurde auf Wunsch des Nutzers ausgelassen, um Spoiler zu vermeiden.)
Schlüsselwörter
Schlacht bei Königgrätz, Preußisch-Österreichischer Krieg, Deutscher Bund, Prager Frieden, Bismarck, Deutscher Nationalstaat, Preußen, Österreich, Innenpolitik, Außenpolitik, Dualismus, Industrialisierung, Nationalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Folgen der Schlacht bei Königgrätz 1866
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text analysiert die Folgen der Schlacht bei Königgrätz (1866) für Preußen und Österreich. Er untersucht die innen- und außenpolitischen Entwicklungen beider Großmächte nach dem Ende des preußisch-österreichischen Dualismus und beleuchtet die Bedeutung dieses Ereignisses für die deutsche Geschichte.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die politische und wirtschaftliche Situation im Deutschen Bund vor 1866, die Schlacht bei Königgrätz als Wendepunkt, die Auswirkungen des Prager Friedensvertrages, die innenpolitischen Veränderungen in Preußen und Österreich nach 1866 sowie die außenpolitische Neuorientierung Österreichs.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und erläutert die Zielsetzung. Kapitel 2 beschreibt die Situation im Deutschen Bund vor 1866. Kapitel 3 behandelt das Ende des preußisch-österreichischen Dualismus, die Schlacht bei Königgrätz und den Prager Frieden. Kapitel 4 (Fazit) beschäftigt sich mit Österreichs politischer Neuorientierung nach dem Krieg (Zusammenfassung ausgelassen, um Spoiler zu vermeiden).
Welche Schlüsselwörter sind für den Text relevant?
Schlüsselwörter sind: Schlacht bei Königgrätz, Preußisch-Österreichischer Krieg, Deutscher Bund, Prager Frieden, Bismarck, Deutscher Nationalstaat, Preußen, Österreich, Innenpolitik, Außenpolitik, Dualismus, Industrialisierung, Nationalismus.
Welche Zielsetzung verfolgt der Autor?
Der Autor möchte die Folgen der Schlacht bei Königgrätz für Preußen und Österreich detailliert darstellen und die innen- und außenpolitischen Entwicklungen beider Großmächte nach dem Ende des preußisch-österreichischen Dualismus analysieren. Der Text hebt hervor, dass dieses Ereignis trotz seiner Bedeutung in vielen Geschichtsbüchern nur oberflächlich behandelt wird.
Wie wird die Situation im Deutschen Bund vor 1866 beschrieben?
Die Situation im Deutschen Bund vor 1866 wird als heterogen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, beschrieben. Es werden die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den norddeutschen, industrialisierten Gebieten und den rückständigen Regionen Süddeutschlands hervorgehoben. Der Text analysiert die unterschiedlichen politischen Systeme und die Beziehungen der einzelnen Staaten zu Preußen und Österreich.
Wie wird der Prager Friede bewertet?
Der Prager Friede wird als unmittelbare Folge der Schlacht bei Königgrätz dargestellt und seine territorialen Auswirkungen auf Mitteleuropa werden analysiert. Der Text untersucht den Übergang vom Dualismus zu einer neuen politischen Ordnung und die Auswirkungen auf die innere und äußere Politik von Preußen und Österreich.
Welche Interpretationen der österreichischen Niederlage werden diskutiert?
Der Text beleuchtet verschiedene Interpretationen der österreichischen Niederlage, indem er die Frage aufwirft, ob es sich um eine "Schmerzhafte Niederlage oder Anstoß zum Neuanfang?" handelte.
- Quote paper
- André Blaschke (Author), 2008, Die Schlacht bei Königgrätz und ihr unmittelbaren Folgen für die politische Entwicklung von Preußen und Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117239