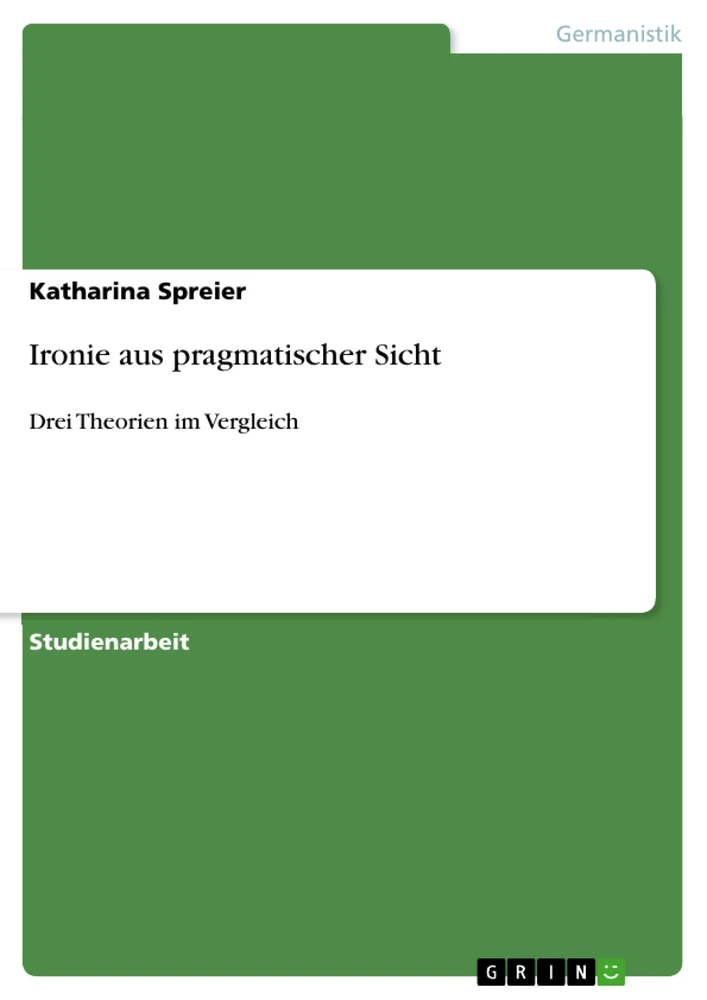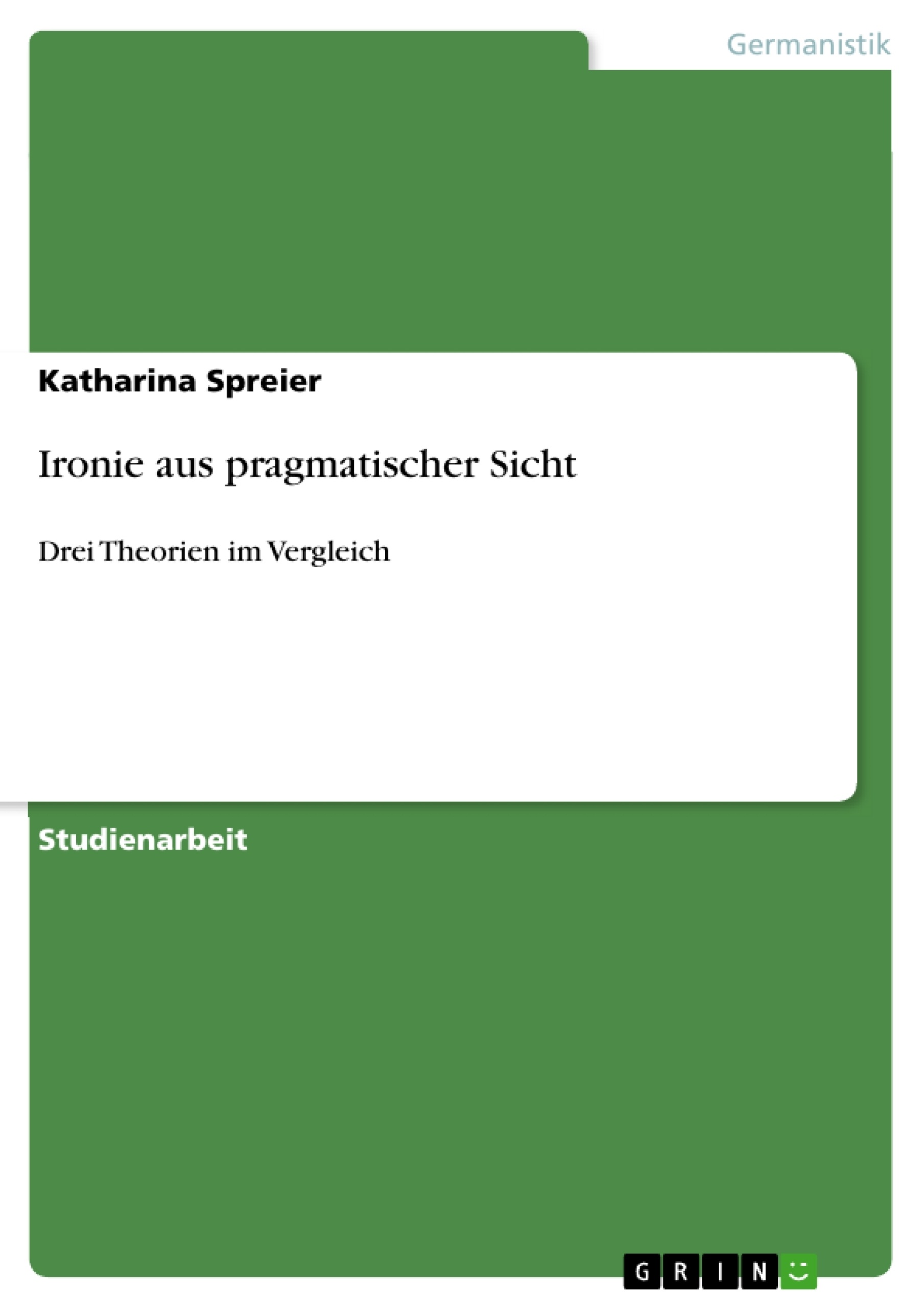Verbale Ironie ist ein gängiges Element der Alltagssprache und dem Großteil der Menschen ein Begriff. Der allgemeine Konsens außerhalb der Wissenschaft ist, dass eine ironische Aussage das Gegenteil davon meint, was der eigentliche propositionale Gehalt der Aussage ist. Pragmatisch gesehen ist verbale Ironie also eine Form des nicht-wörtlichen Sprechens. Die zentralen Problemstellungen für die Pragmatik sind zum einen die Frage nach der Definition von Ironie sowie die Prozesse der Konzeption und Rezeption von ironischen Äußerungen. Drei besonders prägende Theorien, die diese Fragen erstmalig zu begründen zu versuchten, sollen in dieser Arbeit vorgestellt werden.
Paul Grice vertritt einen klassischen Ansatz und sieht die Ironie als gemeintes Gegenteil, das durch das Verletzen der Konversationsmaximen und durch konversationelle Implikaturen hervorgerufen wird. Wilson & Sperber bauen ihre Theorie zwar auf den von Grice etablierten Grundlagen auf, sahen ihre Konzeption von Ironie als Echo jedoch als eine wesentlich zielführendere Theorie an, da sie behaupten, Fragen zu beantworten, die zuvor bei Grice offen geblieben waren. Die Theorie von Clark & Gerrig hingegen definiert Ironie als eine Art „Pretence“, also „Vortäuschung“, und stellt eine konkurrierende Ansicht zur Echo-Theorie dar, obwohl die beiden ebenso viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Auf die Erklärung der wesentlichen Merkmale der jeweiligen Theorien wird ein Überblick über die Vorteile des jeweiligen Ansatzes sowie eine Sammlung der gängigsten Aspekte der Kritik folgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsabgrenzung: Was ist verbale Ironie?
- Ironie als konversationelle Implikatur nach Grice
- Vorteile der Theorie von Grice
- Kritik
- Ironie als Echo nach Wilson & Sperber
- Vorteile der Echo-Theorie
- Kritik
- Echo als Pretence nach Clark & Gerrig
- Vorteile der Pretence-Theorie
- Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie verbale Ironie in der Pragmatik verstanden werden kann. Sie analysiert und vergleicht drei zentrale Theorien, die sich mit der Definition und den Prozessen der Konzeption und Rezeption ironischer Äußerungen auseinandersetzen.
- Die Definition von Ironie
- Die Rolle des Kontextes in der Interpretation von Ironie
- Die unterschiedlichen Theorien über die Funktion von Ironie in der Kommunikation
- Die Stärken und Schwächen der einzelnen Theorien
- Der Einfluss der Theorien auf die aktuelle Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt verbale Ironie als ein häufiges Phänomen in der Alltagssprache vor und erläutert die Bedeutung der pragmatischen Forschung in Bezug auf dieses Thema. Sie identifiziert zentrale Probleme der Ironieforschung, wie die Definition des Begriffs und die Analyse der Prozesse der Konzeption und Rezeption von ironischen Äußerungen. Die Arbeit fokussiert sich auf drei bedeutende Theorien, die diese Fragen beleuchten: die Theorie von Paul Grice, die Theorie von Wilson & Sperber und die Theorie von Clark & Gerrig.
Begriffsabgrenzung: Was ist verbale Ironie?
Dieses Kapitel geht der Frage nach, was verbale Ironie eigentlich ist und wie sie sich von anderen Formen nicht-wörtlichen Sprechens abgrenzen lässt. Es wird darauf hingewiesen, dass Ironie nicht nur ein pragmatisches, sondern auch ein stilistisches und rhetorisches Phänomen ist. Der Kapitel analysiert die Intention des Sprechers als entscheidenden Faktor für die Unterscheidung von Ironie von anderen Formen wie Spott, Hohn oder Sarkasmus. Das Kapitel verdeutlicht die Bedeutung des Kontextes bei der Interpretation von ironischen Äußerungen.
Ironie als konversationelle Implikatur nach Grice
Dieses Kapitel stellt die Theorie von Paul Grice vor, die die Ironie als das Gegenteil einer Aussage betrachtet, das durch die Verletzung der Konversationsmaximen und die Entstehung von konversationellen Implikaturen hervorgerufen wird. Grice's Theorie, die als die erste pragmatische Rekonstruktion der Ironie gilt, wird im Detail erläutert.
3.1 Vorteile der Theorie von Grice
Dieses Unterkapitel beleuchtet die Vorteile der Griceschen Theorie, wie z.B. die Anlehnung an die klassische Konzeption von Ironie und die logische und zielführende Herangehensweise.
3.2 Kritik
Dieses Unterkapitel analysiert die Kritik an Grices Theorie, die sich unter anderem auf die fehlende Berücksichtigung aller Fälle von Ironie und die Kürze der Abhandlung bezieht.
Schlüsselwörter
Verbale Ironie, Pragmatik, Konversationsmaximen, konversationelle Implikaturen, Echo-Theorie, Pretence-Theorie, Kommunikation, Sprecherintention, Kontext, Nicht-wörtliches Sprechen.
- Quote paper
- Katharina Spreier (Author), 2020, Ironie aus pragmatischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1172377