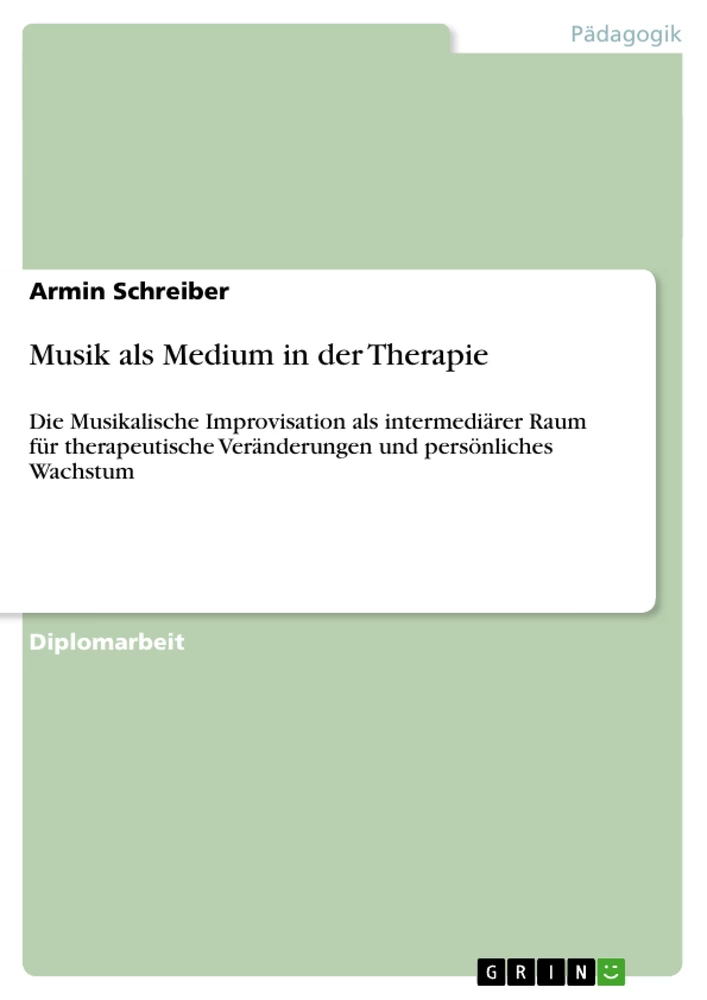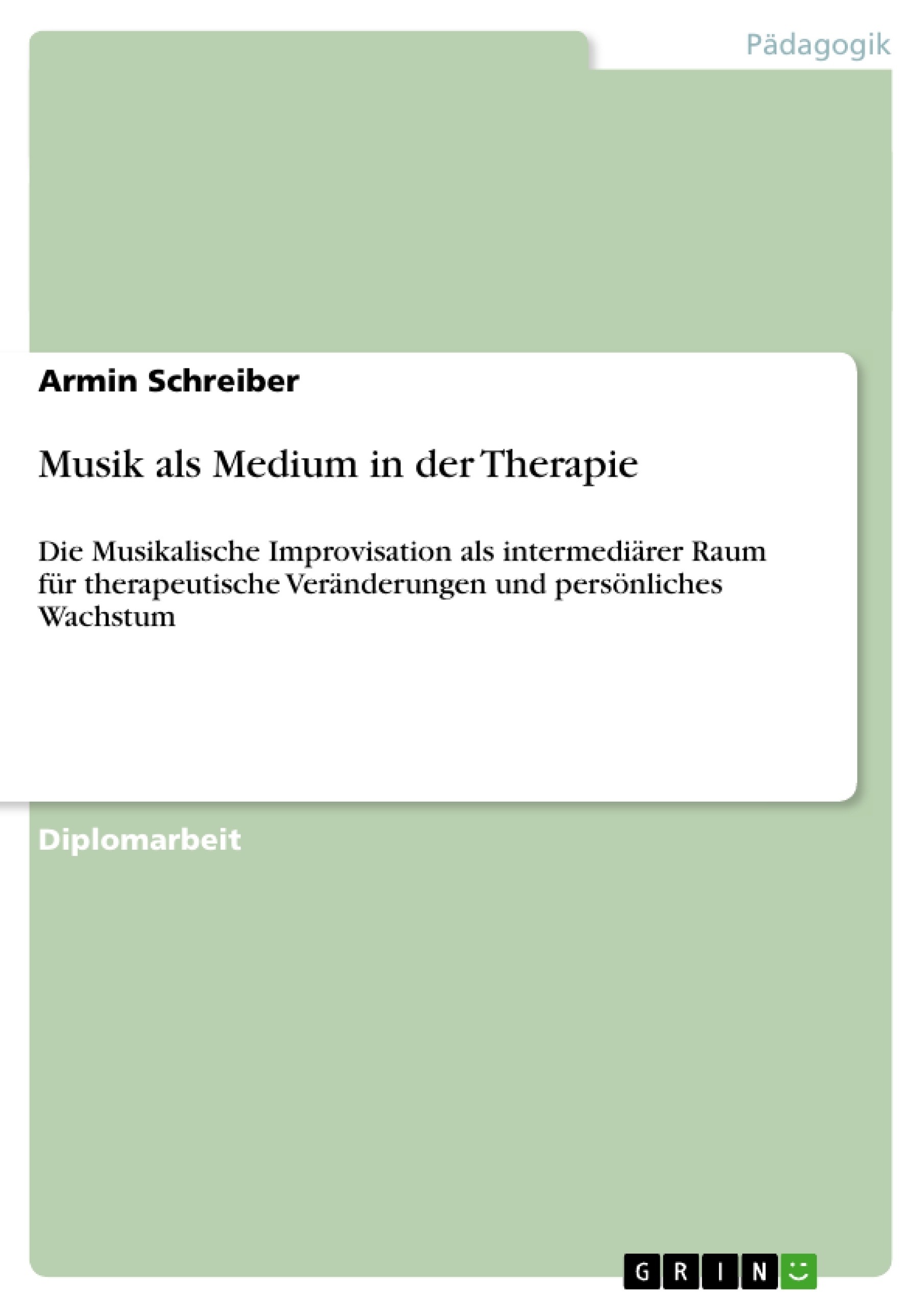[...] Auf der Grundlage der Musiktherapie als Psychotherapie werde ich der Frage nachgehen,
welche Funktion die musikalische Improvisation im therapeutischen Prozess hat, welche
spezifischen Wirkungen sie aufweist, welche inneren Prozesse sie im Spieler auszulösen vermag und worin ihr therapeutisches Potential als Methode der aktiven Musiktherapie
liegt. Ausgehend von der These, dass die Methode der musikalischen Improvisation ein
geeignetes Verfahren ist, im Bereich von psychischen Krankheiten heilsame Prozesse
anzustoßen, die zu positiven Veränderungen des Krankheitszustandes führen, werde ich
mich in dieser Arbeit auf verschiedene musiktherapeutische Strömungen und
konzeptionelle Ansätze beziehen. Aufgrund der vielfältigen konzeptionellen Ansätze der
Musiktherapie ist es mir leider nicht möglich, alle gegenwärtigen theoretischen und
methodischen Ansätze der Musiktherapie einzubeziehen. Die vorliegende Arbeit baut
daher auf den theoretischen Grundlagen der gestalttherapeutischen, der integrativen, der
morphologischen und der analytische n Strömung der Musiktherapie auf. Obwohl diese
Richtungen von ihrer jeweiligen theoretischen und methodischen Fundierung Unterschiede
aufweisen, können sie sich m.E. für eine psychologische Betrachtungsweise der
Improvisation fruchtbar ergänzen. Im Dschungel der musiktherapeutischen Literatur zeichnet sich ein Erscheinungsbild der
verschiedenen musiktherapeutischen Strömungen ab, dass sich sehr uneinheitlich gestaltet.
Dabei sind auch die einzelnen Richtungen nicht klar voneinander abgegrenzt. Bruhn macht
in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass „[...] kein Psychotherapie-Modell in
Reinform in der Musiktherapie vertreten ist.“1 Daher sieht er die moderne Musiktherapie
als eine eklektische Mischform aus therapeutischen Richtungen. 2 Dennoch zeichnet sich
ab, dass für den Großteil der Musiktherapeuten in ihrer Arbeit eine tiefenpsychologische
Denkweise bestimmend ist, auch wenn wesentliche Anteile anderer Therapiemodelle
enthalten sind. Aufgrund dieser Tatsache werden in der vorliegenden Arbeit an einigen
Stellen Aussagen von Autoren, die sich zu unterschiedlichen musiktherapeutischen
Richtung bekennen, nebeneinander existieren. Eine klare Abgrenzung der verschiedenen
musiktherapeutischen Strömungen ist jedoch dort aufzufinden, wo auf wesentliche
theoretische und methodische Grundlagen Bezug genommen wird.
1 Bruhn 2000, S. 76.
2 Vgl. Bruhn 2000, S. 77.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. GRUNDZÜGE DER MUSIKTHERAPIE
- 1. Definition: Musiktherapie als Psychotherapie
- 2. Die geschichtliche Entwicklung der Musiktherapie
- 2.1. Die magisch-mythische Form der Musikheilung
- 2.2. Die rational-wissenschaftliche Musikheilung
- 2.3. Musik und Medizin vom 15. - 19. Jahrhundert
- 3. Wirkungsweisen der Musik
- 3.1. Entwicklungsgeschichtliche Aspekte
- 3.1.1. Ontogenetische Aspekte
- 3.1.2. Hirnphysiologische Aspekte
- 3.2. Physiologische Aspekte
- 3.2.1. Ergotrope Musik
- 3.2.2. Trophotrope Musik
- 3.3. Tiefenpsychologische Aspekte des Musikerlebens
- 4. Die Beziehung zwischen Musiktherapie und anderen Therapiemodellen
- 4.1. Das medizinische Modell
- 4.2. Das tiefenpsychologisch-psychodynamische Modell
- 4.3. Das lerntheoretische Modell
- 4.4. Theoretische Fundierung der Musiktherapie
- 5. Gegenwärtige Therapieformen und Therapieverfahren
- 5.1. Die rezeptive Musiktherapie
- 5.2. Die aktive Musiktherapie
- 5.3. Einzel- und Gruppentherapie
- 5.3.1. Einzeltherapie
- 5.3.2. Gruppentherapie
- 6. Indikation
- 7. Therapeutische Ziele der Musiktherapie
- II. GRUNDLAGEN DER IMPROVISATION
- 1. Die musikalische Improvisation
- 1.1. Zum Musikverständnis
- 1.2. Wesen und Funktion der musikalischen Improvisation
- 1.3. Improvisationsformen
- 1.3.1. Freie Improvisation
- 1.3.2. Strukturierte Improvisation
- 2. Die einzelnen Komponenten der Musik
- 2.1. Klang
- 2.2. Rhythmus
- 2.3. Melodie
- 2.4. Dynamik
- 2.5. Form
- 2.6. Anmerkungen zur therapeutischen Arbeit mit dem Komponentenmodell
- 3. Die Musikinstrumente und ihre Funktionen
- 3.1. Das Instrumentarium
- 3.2. Zur Funktion der Musikinstrumente im therapeutischen Prozess
- 3.3. Das Instrument und die Musik als Übergangs- und Intermediärobjekt
- 4. Musik und Kommunikation
- 4.1. Allgemeines
- 4.2. Kommunikationstheoretische Aspekte
- 4.3. Zur therapeutischen Bedeutung der kommunikationstheoretischen Betrachtung
- Definition und geschichtliche Entwicklung der Musiktherapie
- Wirkungsweisen der Musik auf den Menschen
- Beziehung zwischen Musiktherapie und anderen Therapiemodellen
- Grundlagen der musikalischen Improvisation
- Die Bedeutung von Musik und Kommunikation im therapeutischen Prozess
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und skizziert die Relevanz der musikalischen Improvisation in der Therapie.
- I. GRUNDZÜGE DER MUSIKTHERAPIE: Dieser Abschnitt beleuchtet die Definition, die Geschichte, die Wirkungsweisen und die theoretischen Grundlagen der Musiktherapie. Die verschiedenen Therapiemodelle werden vorgestellt und die Beziehung der Musiktherapie zu diesen Modellen erörtert.
- II. GRUNDLAGEN DER IMPROVISATION: Dieser Abschnitt erforscht das Wesen und die Funktion der musikalischen Improvisation. Die verschiedenen Komponenten der Musik und ihre Bedeutung im therapeutischen Kontext werden untersucht. Darüber hinaus werden die Funktionen von Musikinstrumenten im therapeutischen Prozess sowie der Zusammenhang zwischen Musik und Kommunikation im Detail betrachtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der musikalischen Improvisation im Kontext der Musiktherapie. Ziel ist es, die musikalische Improvisation als intermediären Raum für therapeutische Veränderungen und persönliches Wachstum zu betrachten. Dabei werden sowohl theoretische Grundlagen der Musiktherapie und der Improvisation als auch praktische Aspekte beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Musiktherapie, musikalische Improvisation, intermediärer Raum, therapeutische Veränderungen, persönliches Wachstum, Wirkungsweisen der Musik, Therapiemodelle, Kommunikation, Musik und Kommunikation, Instrumentarium, therapeutischer Prozess.
- Quote paper
- Armin Schreiber (Author), 2002, Musik als Medium in der Therapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11722