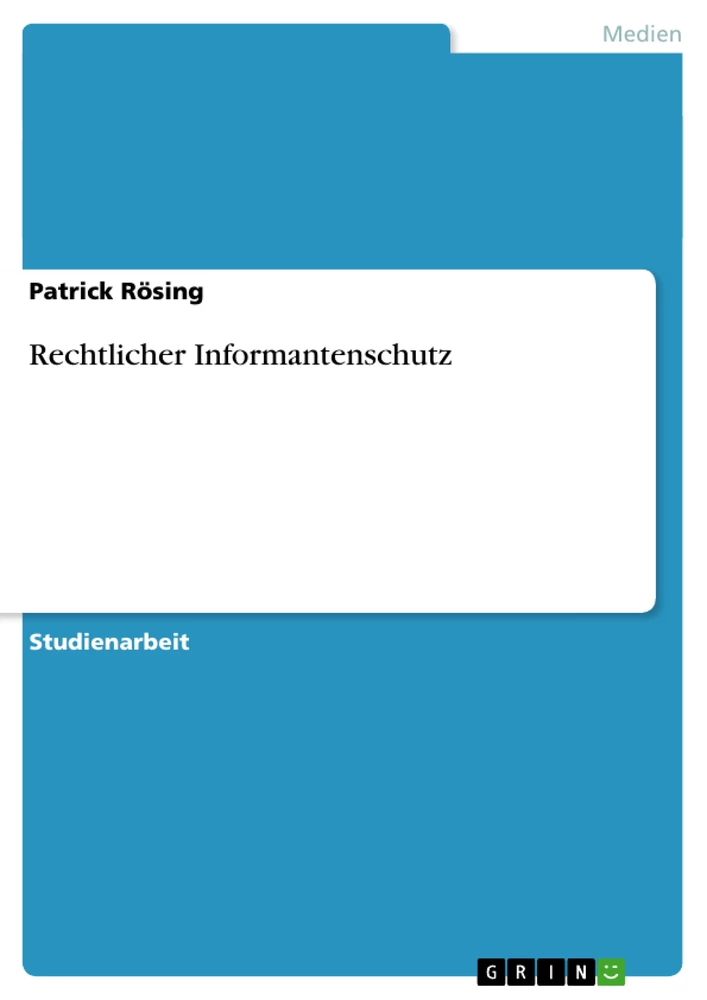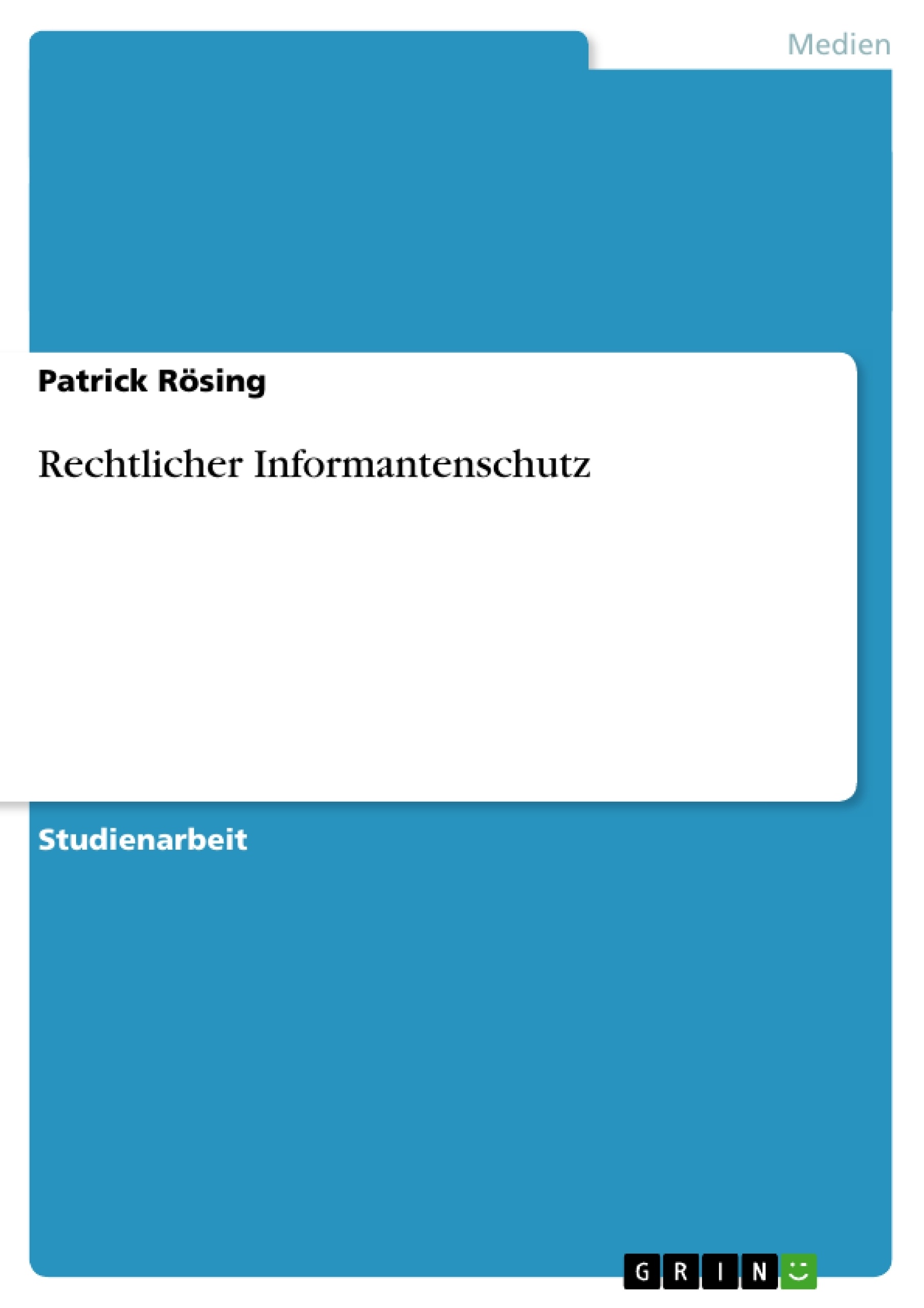Eine Untersuchung des rechtlichen Informantenschutz in Deutschland. Defintion des
Informantenbegriffes und Blick auf die USA und GB. Es folgt eine Analyse des Informantenschutzes anhand der vorhandenen Rechtslage, ein Hinweis auf mögliche Gefahren, sowie ein Ausblick auf mögliche erweiterte Schutzgesetze.
[...]
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
1. BEGRIFFSDEFINITION INFORMANT / WHISTLEBLOWER
2. INFORMANTENSCHUTZ IM AUSLAND
2.1. USA
2.2. Großbritannien
3. INFORMANTENSCHUTZ IN DEUTSCHLAND
3.1. Zeugnisverweigerungsrecht
3.2. Publizistische Verwertung rechtswidrig erlangter Materialien und Informationen
3.3. Beschlagnahme- und Durchsuchungsverbot
4. GEFAHREN FÜR DEN INFORMANTENSCHUTZ
4.1. Vorratsdatenspeicherung
4.2. Online-Durchsuchung
4.3. Abhören
5. AUSBLICK
5.1 Konkreter Informantenschutz
FAZIT
QUELLEN / LITERATUR
Einleitung
Whistleblower, Insider – aber auch Maulwurf oder Denunziant. Es existiert eine ansehnliche Auswahl unterschiedlich eingefärbter Synonyme für eine bedeutende Quelle für Journalisten: den Informanten.
Besonders für Enthüllungsjournalisten ist es unerlässlich bei ihrer Arbeit auf einen Kontakt von innen zurückgreifen zu können. Auf jemanden, der sich im jeweiligen System des Ermittlungsbereiches auskennt, der Zugang zu Informationen hat und auch Missverhältnisse erkennt, die nur einem Insider auffallen.
Und der auch bereit ist, diese (meist heiklen) Informationen zu liefern, was nicht selbstverständlich ist. Denn potentielle Informanten gehen meist ein bedeutendes Risiko ein, wenn sie sich mit Pressevertretern einlassen. Grund: die Informationen, die sie nach außen tragen sind alles andere als für die Öffentlichkeit bestimmt – und deswegen auch so schwer zu bekommen. Im Gegenteil: Oft decken sie Skandale auf, enthüllen Missstände oder bringen andere Dinge ans Tageslicht, die von gewissen Interessensvertretern oder Systemoberen bewusst unter den Teppich gekehrt werden sollen. Nicht selten handelt es sich um schwere Verstöße gegen Gesetz, Moral oder Sitten, welche die Öffentlichkeit nach dem Erscheinen aufrütteln. Sei es aus Idealismus oder materiellen Interessen: Sobald ein Informant Informationen jeglicher Art an einen Journalisten weitergibt, setzt er sich einem Risiko aus. Im „besten“ Fall riskiert er lediglich seinen Arbeitsplatz oder ein Vertrauensverhältnis, noch schlimmer ist es wenn ihm nach der Veröffentlichung gar Gefahr für Leib und Leben drohen. Ausserdem ist die Beschaffung mancher Informationen strafrechtlich relevant, wenn dabei etwa gegen Gesetze wie das Bank- oder Steuergeheimnis verstoßen wird.
Informanten sind ein wichtiges Instrument für die Medien um Ihre Kontrollfunktion gegenüber Wirtschaft und Staat entsprechend wahrzunehmen. Aber im Gegensatz zu einem Journalisten macht der Informant die Gratwanderung ohne die Möglichkeit, sich auf mediale Sonderrechte berufen zu können. (vgl. auch LUDWIG 2007, S. 299). Daher ist Informantenschutz sehr wichtig. Denn nur wenn ein potentieller Informant sich der Wahrung seiner Anonymität absolut sicher sein kann, wird er überhaupt bereit zur Kooperation sein.
Wie es dabei um die rechtliche Seite des Informantenschutz bestellt ist, wird in dieser Arbeit erörtert. Der Begriff des Informanten wird definiert, sowie der Informantenschutz im Ausland am Beispiel USA und Großbritannien in Augenschein genommen. Es folgt ein ausführlicher Blick auf die Ist-Situation in Deutschland und ein Ausblick. Zum Schluss wird ein auswertendes Fazit gezogen.
1. Begriffsdefinition Informant / Whistleblower
Für einen Journalisten ist jeder ein Informant, der a) ein höheres Sachwissen besitzt als der Rechercheur zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme und der b) in den aufzuklärenden Sachverhalt nicht involviert ist. (Beispiele: ein Mitwisser, ehemaliges Mitglied, Fachmann, Augen-/Ohrenzeuge, aber auch ein Konkurrent) […]
(HALLER 2004, S. 205).
Informanten befinden sich demnach also im engeren Umfeld des Geschehens, haben Zugang zu verschlossenen Informationen oder wissen über vertrauliche Sachverhalte bescheid ohne selbst aktiv verwickelt zu sein, was ihn nach Haller zu einem Akteur machen würde.
Im englischen Sprachraum werden Informationsgeber von innen gemeinhin als „Whistleblower“ (wörtlich: „Pfeifenbläser“) bezeichnet. Als Motivation wird meist Zivilcourage vermutet, Whistleblower möchten auf Missstände aufmerksam machen und „blasen“ daher die „Alarm-Pfeife“ (blowing the whistle). Aufgrund der (angenommenen) ehrenhaften Beweggründe, ist der Begriff eher positiv behaftet. (vgl. auch GAP 2008).
Oft haftet einem Informanten bzw. Whistleblower trotz aller Ehrenhaftigkeit nach wie vor das Image eines illoyalen Denunzianten an. Damit tut man ihnen jedoch wohl meistens Unrecht. So gibt es gar die These, in modernen Gesellschaften seien die auskunftsfreundigen Insider notwendig:
Moderne Gesellschaften sind auf Whistleblower angewiesen, die Insider- Hinweise auf gravierendes Fehlverhalten oder erhebliche Missstände und Risiken geben. Beschäftigte, die bei drohenden Risiken Alarm schlagen, können frühzeitig auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen und damit einem Betrieb, Unternehmen oder einer Dienststelle erhebliche Folgekosten oder Regressansprüche ersparen (D EISEROTH 2004, S, 304)
2. Informantenschutz im Ausland
Ob und in welcher Form Informanten rechtlich geschützt sind, hängt vor allem mit der Regierungsform eines Landes und dem dortigen Umgang mit der Presse- und Informationsfreiheit zusammen. In autokratisch regierten Ländern etwa, wird es kaum so umfangreiche Schutzmaßnahmen für die Informationsgeber geben wie in einer Demokratie. Untenstehend erfolgt ein kurzer Blick auf die Situation in den USA und Großbritannien. Ein Blick auf jene Länder ist zudem sinnvoll, da die Medienwelt in beiden Staaten eine gewisse Vorbildfunktion auf das Bundesdeutsche Modell nach Gründung der Republik hatte.
2.1. USA
In den USA gibt es konkrete Gesetze zum Schutz von Informanten, etwa den
„Whistleblower Protection Act“ (WPA). Der WPA gewährleistet Whistleblowern einen gesetzlichen Schutz. Er trat erstmals 1989 in Kraft. Ziel war es damals den Schutz für „Federal Employees“ (etwa: Bundes- Angestellte) zu verbessern bzw. zu verstärken, um Repressalien vorzubeugen. Der WPA sollte mithelfen Fehler der Regierung zu eliminieren, indem Arbeitnehmer auf Ungereimtheiten hinweisen (WHITAKER 2007).
Die Gesetzeslage wird ständig modifiziert. Am 31. Juli 2008 beschloss der US- Kongress mit dem Inkrafttreten neuer Whistleblower-Schutzregelungen im Bereich Produktsicherheit (vgl. (WHISTLEBLOWER-NET 2008) die jüngsten Änderungen.
2.2. Großbritannien
Auch in Großbritannien gibt es konkrete Gesetze zum Schutz von Informanten. Der sog. "Public Interest Disclosure Act" (PIDA) schreibt seit 1999 den Schutz von Informanten in England, Schottland und Wales vor (vgl. INFORMANTEN 2008). Der PIDA wurde nach einer Reihe von Katastrophen und Skandalen in den 1980er und frühen 1990 Jahren nach einer Analyse angeregt. Demnach ergab fast jede öffentliche Untersuchung, dass Arbeiter drohender Gefahren gewahr waren, jedoch entweder zu ängstlich waren um Alarm zu schlagen oder das Thema auf die falsche Art gegenüber der falschen Person aufkommen ließen (PCAW 2008).
3. Informantenschutz in Deutschland
Im deutschen Grundgesetz ist im Artikel 5, Absatz 2 die Pressfreiheit und deren Gewährleistung festgeschrieben. Eine Gewährleistung der Pressefreiheit ist wichtig, damit die Medien weiterhin ihre Wachhundfunktion gegenüber Wirtschaft und Staat ausfüllen können. Das funktioniert nicht ohne einen wirksamen Informantenschutz, denn ohne diesen ist es deutlich schwerer kooperationsbereite Insider aufzutreiben. Und ohne die berühmten gutunterichteten inneren Quellen hätte eine nicht geringe Anzahl von Skandalen der Vergangenheit wohl nie den Weg an die Öffentlichkeit gefunden.
Der rechtliche Informantenschutz in Deutschland unterscheidet sich jedoch von dem oben angeführten in den USA oder Großbritannien. Hierzulande gibt es (noch) keine konkreten Regelungen zum Schutz von Informanten. Aber es gibt Verordnungen und Gesetze, welche den Quellenschutz von Journalisten gewährleisten und so sicherstellen, dass die Anonymität ihrer Informationsgeber gewahrt bleibt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Informantenschutz, einschließlich Definitionen, internationaler Vergleiche (USA, Großbritannien) und der Situation in Deutschland. Es zielt darauf ab, die rechtlichen Aspekte des Informantenschutzes zu beleuchten.
Was ist ein Informant oder Whistleblower laut diesem Text?
Ein Informant ist eine Person, die über höheres Sachwissen als der Journalist verfügt und nicht in den aufzuklärenden Sachverhalt involviert ist. Im Englischen wird oft der Begriff "Whistleblower" verwendet, der eine Person bezeichnet, die Missstände aufdeckt, oft aus Zivilcourage.
Wie wird Informantenschutz im Ausland geregelt (USA und Großbritannien)?
In den USA gibt es den "Whistleblower Protection Act" (WPA), der Informanten, insbesondere Bundesangestellte, schützt. In Großbritannien existiert der "Public Interest Disclosure Act" (PIDA), der seit 1999 den Schutz von Informanten vorschreibt.
Wie ist die Situation des Informantenschutzes in Deutschland?
In Deutschland gibt es keine expliziten Gesetze zum Schutz von Informanten wie in den USA oder Großbritannien. Der Quellenschutz für Journalisten, der durch die Pressefreiheit im Grundgesetz (Artikel 5, Absatz 2) gewährleistet wird, dient jedoch indirekt dem Schutz von Informanten.
Was bedeutet Redaktionsgeheimnis in Deutschland?
Das Redaktionsgeheimnis bezieht sich auf die Freiheit der Presse, Informationen zu sammeln, ohne ihre Quellen offenlegen zu müssen. Es ist nicht explizit in den Pressegesetzen normiert, ergibt sich aber aus der Kombination verschiedener Normen, insbesondere strafrechtlicher.
Welche Gefahren für den Informantenschutz werden in dem Text erwähnt?
Der Text erwähnt Gefahren wie Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung und Abhören, die den Informantenschutz gefährden könnten.
Warum ist Informantenschutz wichtig?
Informantenschutz ist wichtig, damit Journalisten ihre Kontrollfunktion gegenüber Wirtschaft und Staat wahrnehmen können. Nur wenn Informanten sich der Wahrung ihrer Anonymität sicher sein können, sind sie bereit, Informationen preiszugeben.
- Quote paper
- Patrick Rösing (Author), 2008, Rechtlicher Informantenschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117192