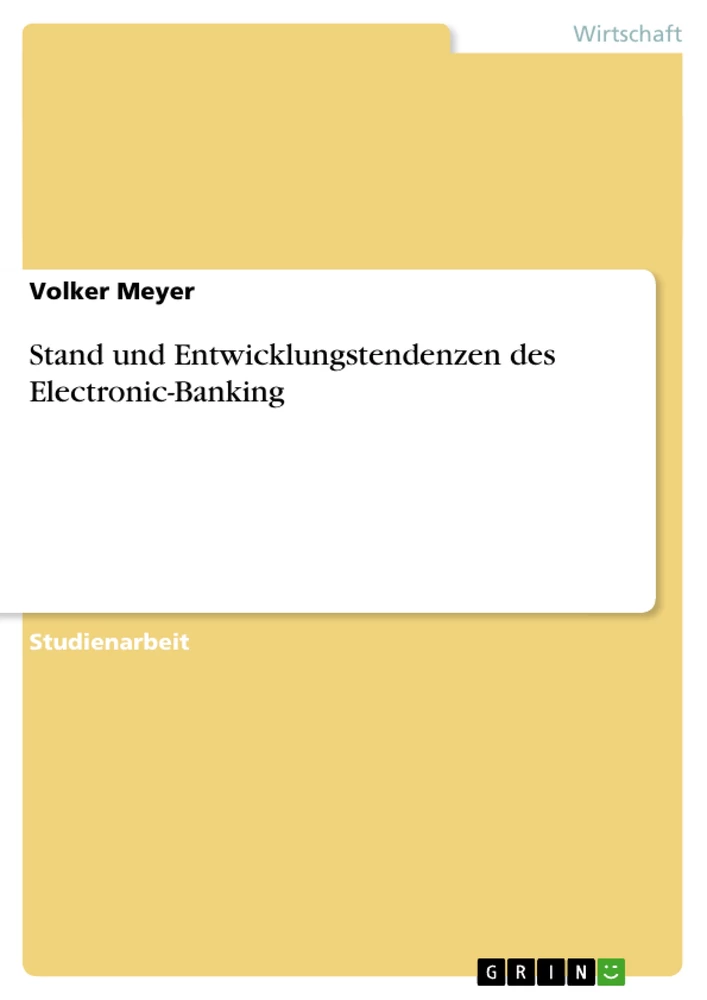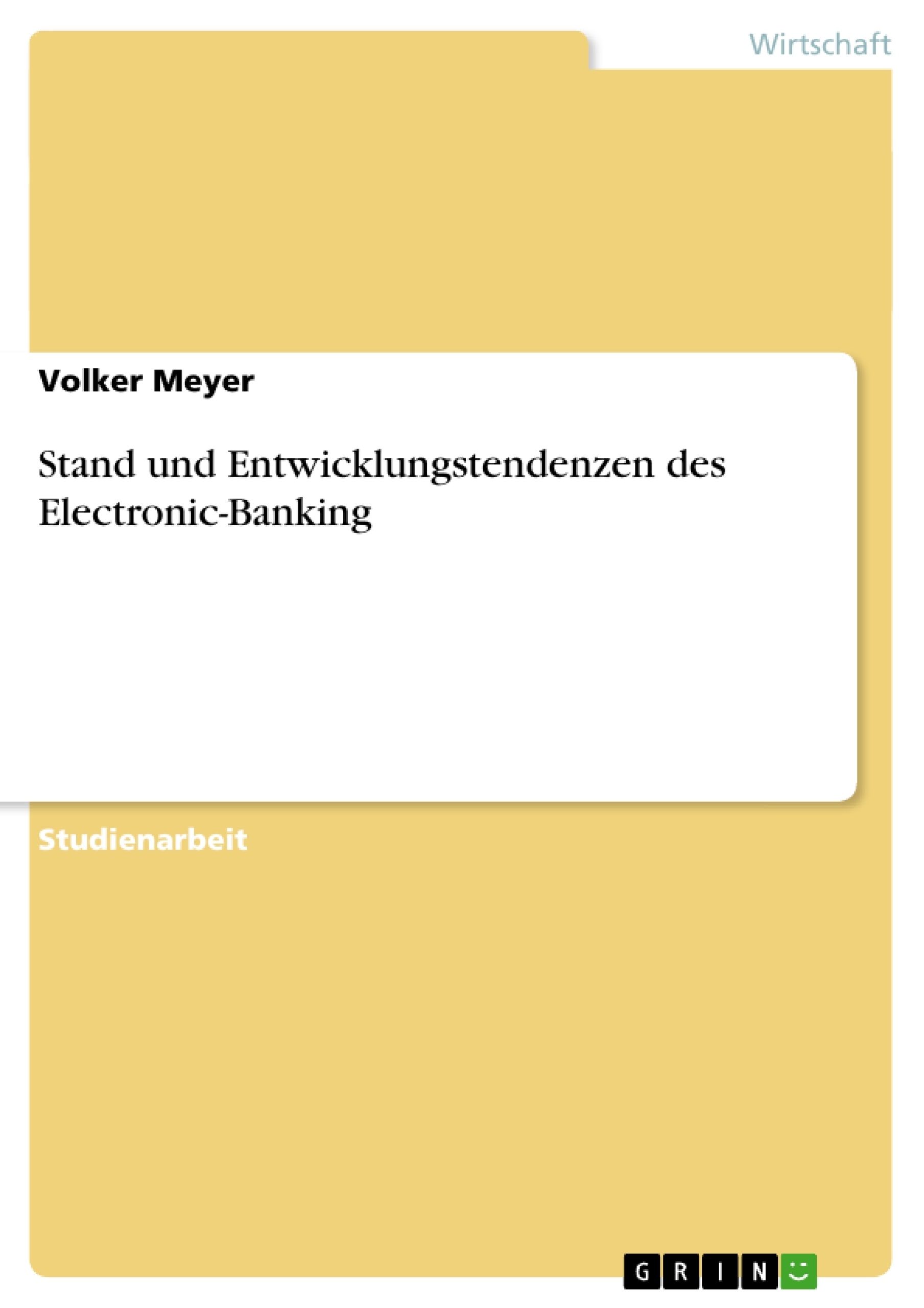“Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich schon seit mehreren Jahren in einer dynamischen strukturellen Umbruchsituation.“ Insbesondere durch neue technische Möglichkeiten wurde der Weg der Informationsversorgung sowie die Durchführung von Finanztransaktionen stark verändert. 37% der Deutschen wickeln ihre Bankgeschäfte bereits online ab – mit steigender Tendenz. Electronic Banking steht, im Wettbewerb um neue Kunden, für Innovation, Umsetzung, Betreuung und Unterstützung der neuen Techniken im Bankensektor.
In den folgenden Ausführungen werden zunächst einige für diesen Beitrag wichtige Begriffsdefinitionen vorgenommen. Anschließend geht das dritte Kapital auf die Entstehung und den aktuellen Stand des Electronic Banking ein. Außerdem werden grundsätzliche und sicherheitsspezifische Einsatzbereiche des Electronic Banking sowie am Beispiel einer niedersächsischen Sparkasse der organisatorische Aufbau einer Fachabteilung „E-Banking“ sowie dessen Aufgabebereiche näher eingegangen. Im vierten Kapitel werden die Entwicklungstendenzen in ausgewählten Teilaspekten anhand von zwei aktuellen Themenbereichen erläutert, wobei zunächst im Bereich Zahlungsverkehr auf das Thema SEPA und anschließend im Bereich Kommunikationsverfahren auf das Thema EBICS näher eingegangen wird. Ein abschließendes Fazit gibt einen kurzen perspektivischen Ausblick.
Diese Arbeit soll dazu dienen, den Stand des Electronic Banking näher aufzuzeigen sowie aktuell bedeutsame Entwicklungen darzulegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche Abgrenzungen
- 2.1. Definition Electronic Banking (E-Banking)
- 2.2. Definition Onlinebanking
- 2.3. Definition Internetbanking
- 2.4. Definition Telefonbanking
- 2.5. Definition SB-Banking
- 3. Entstehung und Stand des Electronic Banking
- 3.1. Entstehung und Entwicklung des Electronic Banking
- 3.2. Einsatzbereiche des Electronic Banking
- 3.2.1. Überblick der Einsatzbereiche
- 3.2.2. Sicherheitsverfahren und Sicherheitsmaßnahmen
- 3.3. Electronic Banking als Fachabteilung am Beispiel einer niedersächsischen Sparkasse
- 4. Entwicklungstendenzen in ausgewählten Teilbereichen
- 4.1. SEPA im Bereich Zahlungsverkehr
- 4.2. EBICS im Bereich Kommunikationsverfahren
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stand und die Entwicklungstendenzen des Electronic Banking. Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Formen des E-Bankings zu geben und aktuelle Entwicklungen im Zahlungsverkehr und der Kommunikationstechnologie zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition verschiedener E-Banking-Formen, die Entstehung und den aktuellen Stand des E-Bankings, sowie relevante Entwicklungstendenzen.
- Definition und Abgrenzung verschiedener E-Banking-Formen (Online-, Internet-, Telefon- und SB-Banking)
- Entstehung und Entwicklung des Electronic Banking
- Einsatzbereiche und Sicherheitsaspekte des Electronic Banking
- Organisatorischer Aufbau einer E-Banking-Fachabteilung
- Aktuelle Entwicklungstendenzen im Zahlungsverkehr (SEPA) und in der Kommunikationstechnologie (EBICS)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den dynamischen Wandel in der Finanzdienstleistungsbranche durch neue Technologien und den steigenden Anteil an Online-Banking-Nutzern in Deutschland. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit, der sich auf Begriffsdefinitionen, Entstehung und Stand, Einsatzbereiche, organisatorische Aspekte und Entwicklungstendenzen konzentriert.
2. Begriffliche Abgrenzungen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen für Electronic Banking (E-Banking), Onlinebanking, Internetbanking, Telefonbanking und SB-Banking, unterscheidet diese voneinander und verdeutlicht den Oberbegriff E-Banking und die häufige Verwendung des Begriffs in Fachabteilungen von Kreditinstituten.
3. Entstehung und Stand des Electronic Banking: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Electronic Banking, beschreibt verschiedene Einsatzbereiche, einschließlich Sicherheitsaspekte und analysiert am Beispiel einer niedersächsischen Sparkasse die Organisation und Aufgaben einer E-Banking-Fachabteilung. Es bietet somit einen umfassenden Einblick in den aktuellen Stand des E-Bankings.
4. Entwicklungstendenzen in ausgewählten Teilbereichen: Dieses Kapitel befasst sich mit zwei wichtigen Entwicklungstendenzen: SEPA (Single Euro Payments Area) im Bereich des Zahlungsverkehrs und EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) im Bereich der Kommunikationsverfahren. Es analysiert die Bedeutung und Auswirkungen dieser Entwicklungen auf das Electronic Banking.
Schlüsselwörter
Electronic Banking, Onlinebanking, Internetbanking, Telefonbanking, SB-Banking, SEPA, EBICS, Sicherheitsverfahren, Finanzdienstleistungen, Entwicklungstendenzen, Zahlungsverkehr, Kommunikationsverfahren, Sparkasse.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Dokument "Electronic Banking"
Was ist der Inhalt des Dokuments "Electronic Banking"?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Electronic Banking (E-Banking). Es beinhaltet eine Einleitung, begriffliche Abgrenzungen verschiedener E-Banking-Formen (Online-, Internet-, Telefon- und SB-Banking), die Entstehung und den aktuellen Stand des E-Bankings, seine Einsatzbereiche und Sicherheitsaspekte, einen Einblick in die Organisation einer E-Banking-Fachabteilung einer niedersächsischen Sparkasse sowie eine Analyse aktueller Entwicklungstendenzen im Zahlungsverkehr (SEPA) und in der Kommunikationstechnologie (EBICS).
Welche E-Banking-Formen werden im Dokument definiert und abgegrenzt?
Das Dokument definiert und grenzt die folgenden E-Banking-Formen voneinander ab: Electronic Banking (E-Banking) als Oberbegriff, Onlinebanking, Internetbanking, Telefonbanking und SB-Banking. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden detailliert erläutert.
Wie wird die Entstehung und Entwicklung des Electronic Banking dargestellt?
Das Dokument beleuchtet die historische Entwicklung des Electronic Banking von seinen Anfängen bis zum aktuellen Stand. Es beschreibt die wichtigsten Meilensteine und Einflussfaktoren dieser Entwicklung.
Welche Einsatzbereiche und Sicherheitsaspekte des Electronic Banking werden behandelt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Einsatzbereiche des E-Bankings und widmet sich ausführlich den damit verbundenen Sicherheitsverfahren und -maßnahmen, um die Sicherheit der Transaktionen zu gewährleisten.
Wie wird der organisatorische Aufbau einer E-Banking-Fachabteilung dargestellt?
Anhand des Beispiels einer niedersächsischen Sparkasse wird der organisatorische Aufbau und die Aufgaben einer E-Banking-Fachabteilung detailliert beschrieben, um einen praxisnahen Einblick in die interne Struktur zu geben.
Welche Entwicklungstendenzen im Zahlungsverkehr und in der Kommunikationstechnologie werden analysiert?
Das Dokument analysiert die Entwicklungstendenzen im Zahlungsverkehr im Kontext von SEPA (Single Euro Payments Area) und im Bereich der Kommunikationsverfahren mit Fokus auf EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). Die Bedeutung und Auswirkungen dieser Entwicklungen auf das Electronic Banking werden erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind mit dem Dokument "Electronic Banking" verbunden?
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Dokuments sind: Electronic Banking, Onlinebanking, Internetbanking, Telefonbanking, SB-Banking, SEPA, EBICS, Sicherheitsverfahren, Finanzdienstleistungen, Entwicklungstendenzen, Zahlungsverkehr, Kommunikationsverfahren, Sparkasse.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis des Dokuments?
Das Dokument enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, welches die einzelnen Kapitel und Unterkapitel übersichtlich auflistet. Dieses ermöglicht es dem Leser, sich schnell einen Überblick über den Aufbau und die Struktur des Dokuments zu verschaffen.
Für welche Zielgruppe ist das Dokument "Electronic Banking" gedacht?
Das Dokument richtet sich an eine akademische Zielgruppe, die sich mit dem Thema Electronic Banking auseinandersetzen möchte. Der Fokus liegt auf einer strukturierten und professionellen Analyse der Thematik.
- Quote paper
- Bachelor of Arts (B.A.) Volker Meyer (Author), 2007, Stand und Entwicklungstendenzen des Electronic-Banking, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117099