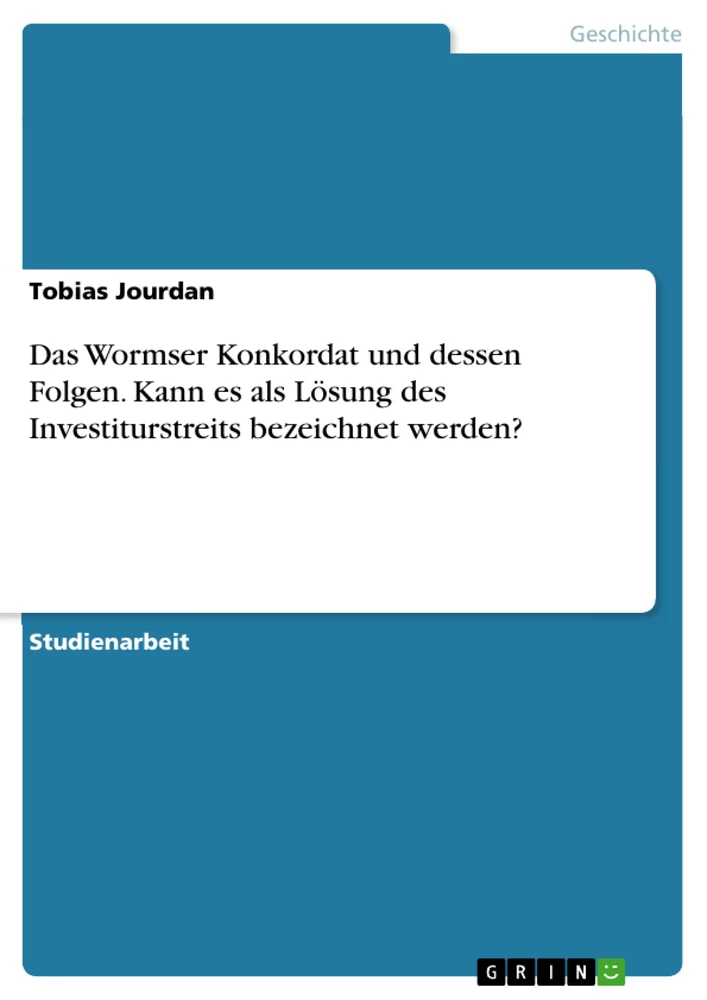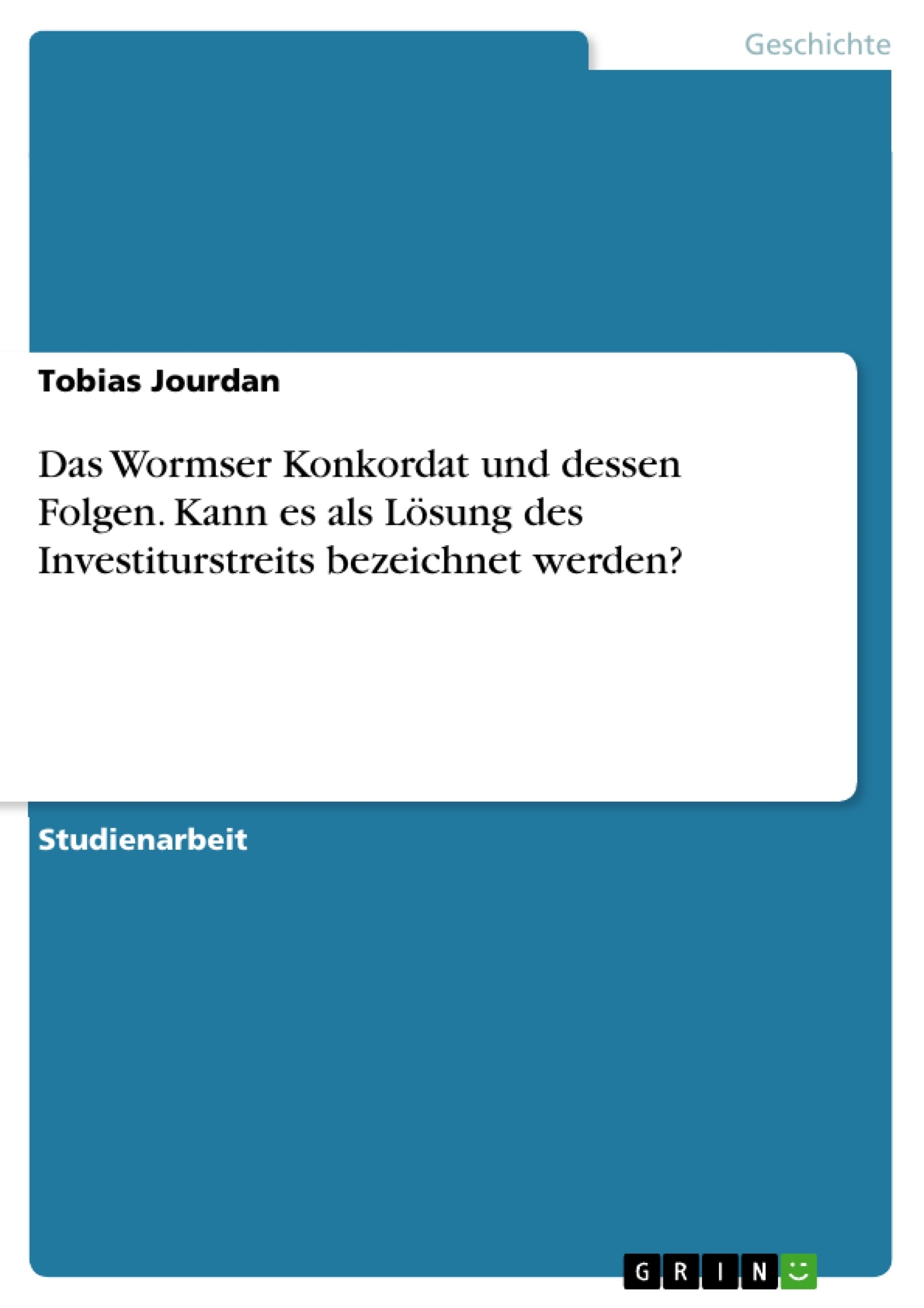In dieser Hausarbeit widme ich mich dem Wormser Konkordat von 1122 und werde mich mit den festgelegten Bestimmungen genauer auseinandersetzen. Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Wirksamkeit und den Einfluss des Wormser Konkordats, sowie dessen Beachtung durch die herrschenden Personen zu untersuchen und zu beurteilen, ob das Wormser Konkordat als Lösung des Investiturstreits gesehen werden kann.
Zuvor gehe ich auf die Ereignisse ein, die als Auslöser der Streitigkeiten zwischen Kaiser und Papst zu sehen sind. Des Weiteren werden die Folgen des Schriftstückes untersucht, im Speziellen welche Partei als Gewinner des Investiturstreits bezeichnet werden kann und wer von den Zugeständnissen der gegnerischen Seite weniger profitiert. Anschließend gehe ich auf unklare Formulierungen, wie "zum Durchbruch verhelfen" (Richterspruch), der Namensnennung und dem Problem der Simonie ein und versuche die Ausführung und Interpretation dieser Punkte klarzustellen. Zudem stelle ich den weiteren Einflussbereich der Reichsfürsten klar und werde deren Interessen auf politische Einflussnahme und Gestaltung hinterfragen. Fortführend wird das Verhältnis der nachfolgenden Amtsinhaber thematisiert und die Einhaltung der gegenseitigen Beistands- und Gehorsamsversprechen erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte zum Wormser Konkordat – Wie kam es dazu?
- Das Wormser Konkordat – Analyse und Auswirkungen auf Papst- und Kaisertum
- Inwieweit ist es im Interesse der Fürsten deren Machteinfluss auch nach Abschluss des Wormser Konkordates aufrechtzuerhalten und politische Entscheidungsprozesse mitzubestimmen?
- Die Wahl von Bischöfen und Äbten geschieht nach der Verabschiedung des Wormser Konkordats ohne Simonie.
- Nach dem Wormser Konkordat kommt es weiterhin zu Konflikten in der Rangordnung zwischen Papst und König/Kaiser, d.h. Kaiser und Könige haben keinen Beistand geleistet bzw. waren nicht gehorsam und aufständisch.
- Formulierungen im Wormser Konkordat, wie z.B. „zum Durchbruch verhelfen“ (Richterspruch), lösen Debatten aus und führen zu Streitigkeiten.
- Die Namensnennung hat Konfliktpotential in sich.
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert das Wormser Konkordat von 1122 und seine Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Papst und Kaiser. Zuerst wird die Vorgeschichte des Konkordats beleuchtet und die Ereignisse, die zum Investiturstreit führten, betrachtet. Im Anschluss werden die Folgen des Wormser Konkordats untersucht, insbesondere die Frage, welche Partei als Gewinner des Investiturstreits angesehen werden kann. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle der Reichsfürsten, die durch das Konkordat in ihrer Machtposition gestärkt wurden.
- Der Investiturstreit: Die Auseinandersetzung zwischen Papsttum und Kaisertum um die Ernennung von Bischöfen.
- Das Wormser Konkordat: Inhalt und Auswirkungen des Abkommens von 1122.
- Der Einfluss der Reichsfürsten: Ihre Rolle im Investiturstreit und ihre Interessen in der politischen Entscheidungsfindung.
- Die Folgen des Konkordats: Die Entwicklung der Machtverhältnisse zwischen Papsttum und Kaisertum.
- Die Rolle der Simonie: Die Problematik der käuflichen Ämtervergabe im Kontext des Investiturstreits.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den Fokus der Seminararbeit vor. Es wird auf die Themengebiete des Investiturstreits und des Wormser Konkordats hingewiesen.
- Vorgeschichte zum Wormser Konkordat – Wie kam es dazu?: Dieses Kapitel beschreibt die Ereignisse, die zum Investiturstreit geführt haben. Es werden die wichtigsten Akteure und ihre Positionen dargestellt, wie beispielsweise Gregor VII., Heinrich IV. und die Reichsfürsten.
- Das Wormser Konkordat – Analyse und Auswirkungen auf Papst- und Kaisertum: Das Kapitel untersucht den Inhalt des Wormser Konkordats und seine Auswirkungen auf die Machtverhältnisse zwischen Papst und Kaiser. Es werden die wesentlichen Punkte des Abkommens dargestellt und deren Bedeutung für beide Seiten erörtert.
- Inwieweit ist es im Interesse der Fürsten deren Machteinfluss auch nach Abschluss des Wormser Konkordates aufrechtzuerhalten und politische Entscheidungsprozesse mitzubestimmen?: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Reichsfürsten im Investiturstreit und ihre Interessen nach dem Abschluss des Wormser Konkordats. Es wird die Frage diskutiert, inwieweit das Konkordat ihre Machtposition stärkte oder schwächte.
- Die Wahl von Bischöfen und Äbten geschieht nach der Verabschiedung des Wormser Konkordats ohne Simonie.: Dieses Kapitel analysiert, inwieweit das Wormser Konkordat die Praxis der Simonie, der käuflichen Ämtervergabe, erfolgreich einschränkte oder gar abschaffte.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf den Investiturstreit, das Wormser Konkordat, die Machtverhältnisse zwischen Papsttum und Kaisertum, die Rolle der Reichsfürsten, die Praxis der Simonie und die Auswirkungen des Konkordats auf die politische und kirchliche Ordnung im Heiligen Römischen Reich. Der Fokus liegt auf der Analyse des Wormser Konkordats als möglicher Lösung des Investiturstreits und der Frage, ob dieses Abkommen nachhaltig die Machtbalance zwischen den verschiedenen Akteuren veränderte.
- Quote paper
- Tobias Jourdan (Author), 2021, Das Wormser Konkordat und dessen Folgen. Kann es als Lösung des Investiturstreits bezeichnet werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170988