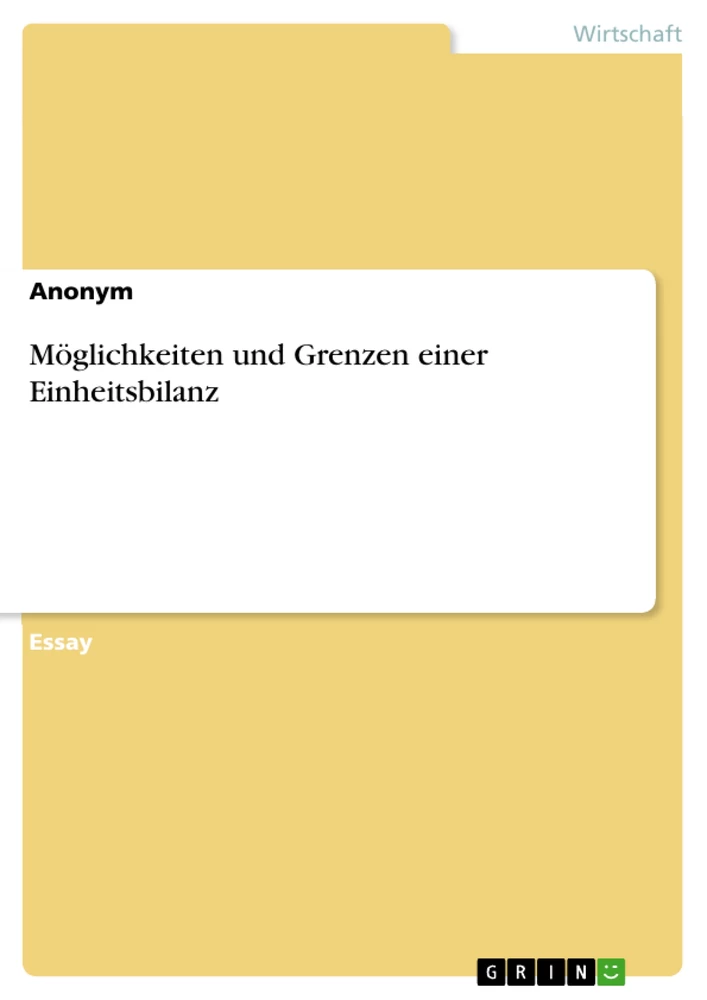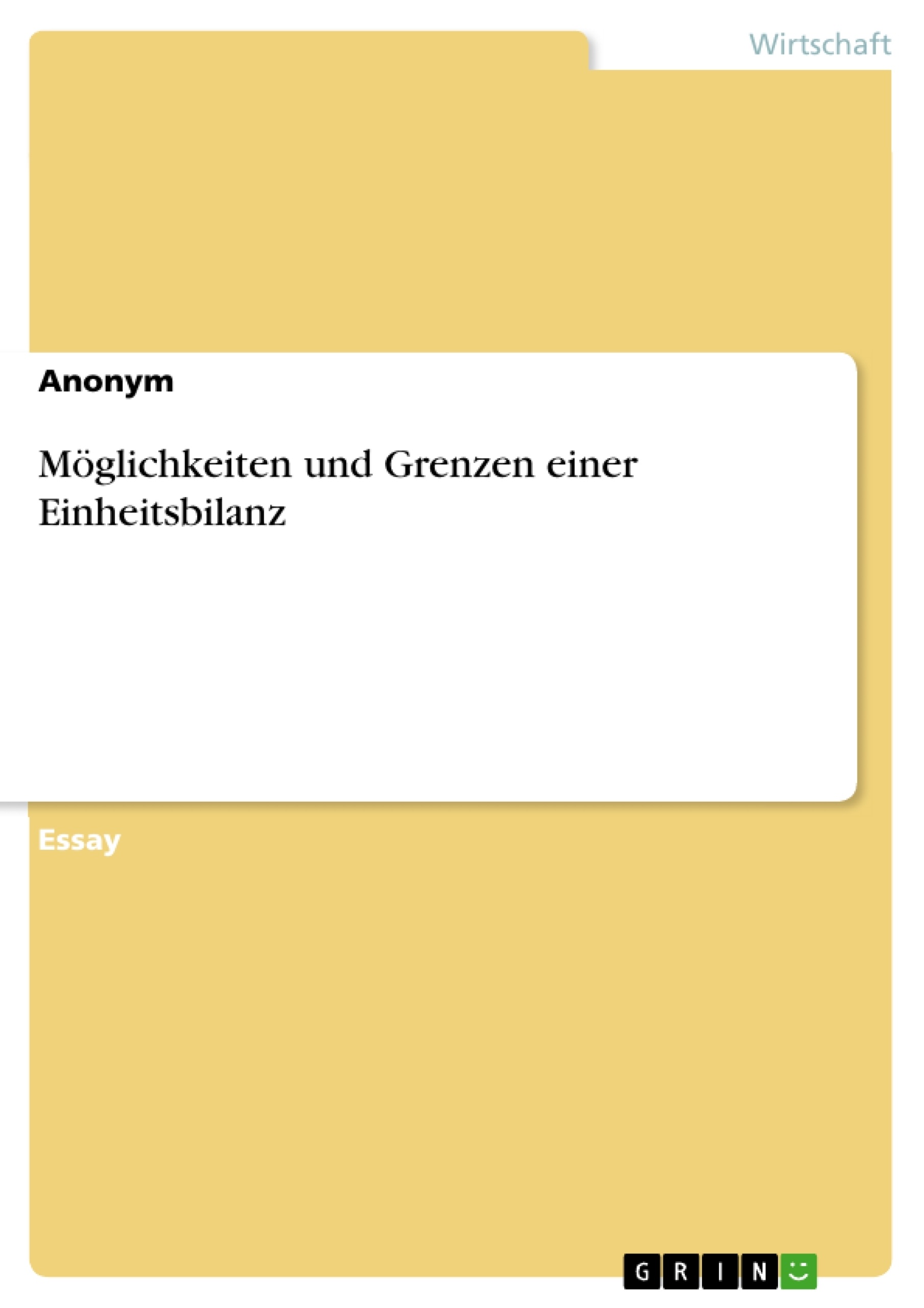Wie ist es nach Erlass des BilMoG noch möglich eine Einheitsbilanz aufzustellen?
In der Folgenden Arbeit werden die Möglichkeiten und Grenzen der Einheitsbilanz genauer durchleuchtet.
Zuerst wird in Kapitel zwei der Begriff „Einheitsbilanz“ definiert und auf ihren Ursprung eingegangen. Anschließend werden die Handels- und Steuerbilanz näher erläutert. In Kapitel drei wird das Maßgeblichkeitsprinzip vorgestellt und die verschiedenen Formen dieses Grundsatzes werden aufgezeigt. Die Auswirkungen des BilMoG auf die Einheitsbilanz, sowie Möglichkeiten und Grenzen der Erstellung, werden verdeutlicht. Zudem wird die Durchbrechung der Maßgeblichkeit thematisiert und die steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorbehalte vorgestellt. Die Vor- und Nachteile der Einheitsbilanz werden ausgearbeitet.
Im vierten und somit letzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und es wird auf die Forschungsfrage eingegangen.
Die Inhalte dieser Studienarbeit basieren auf einer Literaturrecherche. Literaturverweise wurden mittels Fußnoten kenntlich gemacht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Definition Einheitsbilanz
- 2.2 Die Handelsbilanz
- 2.3 Die Steuerbilanz
- 3. Das Maßgeblichkeitsprinzip
- 3.1 Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz
- 3.2 Auswirkungen des BilMoG auf die Einheitsbilanz
- 3.3 Durchbrechung der Maßgeblichkeit
- 3.4 Vor- und Nachteile der Einheitsbilanz
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Einheitsbilanz in Deutschland, insbesondere im Kontext des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Ziel ist es, die Frage zu beantworten, wie – und unter welchen Bedingungen – eine Einheitsbilanz nach dem Erlass des BilMoG noch aufgestellt werden kann.
- Definition und Ursprung der Einheitsbilanz
- Erklärung der Handels- und Steuerbilanz
- Das Maßgeblichkeitsprinzip und seine Auswirkungen
- Auswirkungen des BilMoG auf die Einheitsbilanz
- Vor- und Nachteile der Einheitsbilanz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Einheitsbilanz ein und beschreibt ihren historischen Kontext, insbesondere die Entwicklung seit dem späten 19. Jahrhundert. Sie hebt die Bedeutung des Maßgeblichkeitsprinzips (§ 5 Abs. 1 EStG) hervor und erklärt, wie das BilMoG (2009) die Erstellung einer Einheitsbilanz beeinflusst hat. Die Arbeit formuliert die Leitfrage, die im weiteren Verlauf beantwortet werden soll: Wie ist es nach Erlass des BilMoG noch möglich, eine Einheitsbilanz aufzustellen? Die Struktur der Arbeit wird skizziert, wobei die einzelnen Kapitel und ihre jeweiligen Schwerpunkte benannt werden.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Einheitsbilanz" als eine Bilanz, die sowohl handels- als auch steuerrechtliche Anforderungen erfüllt. Es werden die Handelsbilanz (§ 242 Abs. 1 HGB) und die Steuerbilanz (§ 60 Abs. 2 Satz 2 EStDV) detailliert erläutert, wobei ihre jeweiligen Vorschriften, Zwecke und Funktionen herausgestellt werden. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Bilanzarten und ihrer Bedeutung für die Erstellung einer Einheitsbilanz. Die Kapitel erläutert die Herausforderungen bei der Erstellung einer Einheitsbilanz, verdeutlicht den Unterschied zwischen der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Gewinnermittlung und betont die Bedeutung von § 5 Abs. 1 EStG und § 5 Abs. 6 EStG für die Einhaltung beider Rechtsvorschriften.
3. Das Maßgeblichkeitsprinzip: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Maßgeblichkeitsprinzip und seinen Auswirkungen auf die Einheitsbilanz. Es analysiert die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz und umgekehrt, sowie die Modifikationen durch das BilMoG. Die Durchbrechung des Maßgeblichkeitsprinzips wird thematisiert, inkl. der steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorbehalte. Die Vor- und Nachteile der Einheitsbilanz werden gegeneinander abgewogen, wobei die praktischen Implikationen für Unternehmen hervorgehoben werden. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Vorteile einer vereinheitlichten Bilanzierung im Vergleich zum Aufwand, der mit der Einhaltung unterschiedlicher Vorschriften verbunden ist.
Schlüsselwörter
Einheitsbilanz, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Maßgeblichkeitsprinzip, BilMoG, § 5 Abs. 1 EStG, § 5 Abs. 6 EStG, steuerliche Ansatz- und Bewertungsvorbehalte, Gewinnermittlung, handelsrechtliche Vorschriften, steuerrechtliche Vorschriften.
Einheitsbilanz: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Einheitsbilanz in Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen der Einheitsbilanz im Kontext des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG).
Was ist eine Einheitsbilanz?
Eine Einheitsbilanz ist eine Bilanz, die sowohl die handelsrechtlichen als auch die steuerrechtlichen Anforderungen erfüllt. Sie vereint somit die Handelsbilanz und die Steuerbilanz in einer einzigen Darstellung.
Welche Bilanzarten werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Handelsbilanz (§ 242 Abs. 1 HGB) und die Steuerbilanz (§ 60 Abs. 2 Satz 2 EStDV). Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Bilanzarten detailliert erläutert.
Welche Rolle spielt das Maßgeblichkeitsprinzip?
Das Maßgeblichkeitsprinzip (§ 5 Abs. 1 EStG) ist zentral für die Einheitsbilanz. Es beschreibt die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz. Das Dokument analysiert die Auswirkungen des BilMoG auf dieses Prinzip und die möglichen Durchbrechungen.
Wie wirkt sich das BilMoG auf die Einheitsbilanz aus?
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 2009 hat die Erstellung einer Einheitsbilanz maßgeblich beeinflusst. Das Dokument untersucht, wie – und unter welchen Bedingungen – eine Einheitsbilanz nach dem Erlass des BilMoG noch aufgestellt werden kann.
Welche Vor- und Nachteile hat eine Einheitsbilanz?
Das Dokument bewertet die Vor- und Nachteile einer Einheitsbilanz. Die Vorteile einer vereinheitlichten Bilanzierung werden den damit verbundenen Aufwänden gegenübergestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Einheitsbilanz, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Maßgeblichkeitsprinzip, BilMoG, § 5 Abs. 1 EStG, § 5 Abs. 6 EStG, steuerliche Ansatz- und Bewertungsvorbehalte, Gewinnermittlung, handelsrechtliche Vorschriften, steuerrechtliche Vorschriften.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlagen (Definition Einheitsbilanz, Handelsbilanz, Steuerbilanz), Das Maßgeblichkeitsprinzip (Auswirkungen des BilMoG, Durchbrechung der Maßgeblichkeit, Vor- und Nachteile) und Fazit.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Bilanzarten?
Die detaillierte Erläuterung der Handelsbilanz und der Steuerbilanz findet sich im Kapitel "Grundlagen".
Welche Leitfrage wird im Dokument beantwortet?
Die zentrale Leitfrage lautet: Wie ist es nach Erlass des BilMoG noch möglich, eine Einheitsbilanz aufzustellen?
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Möglichkeiten und Grenzen einer Einheitsbilanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170626