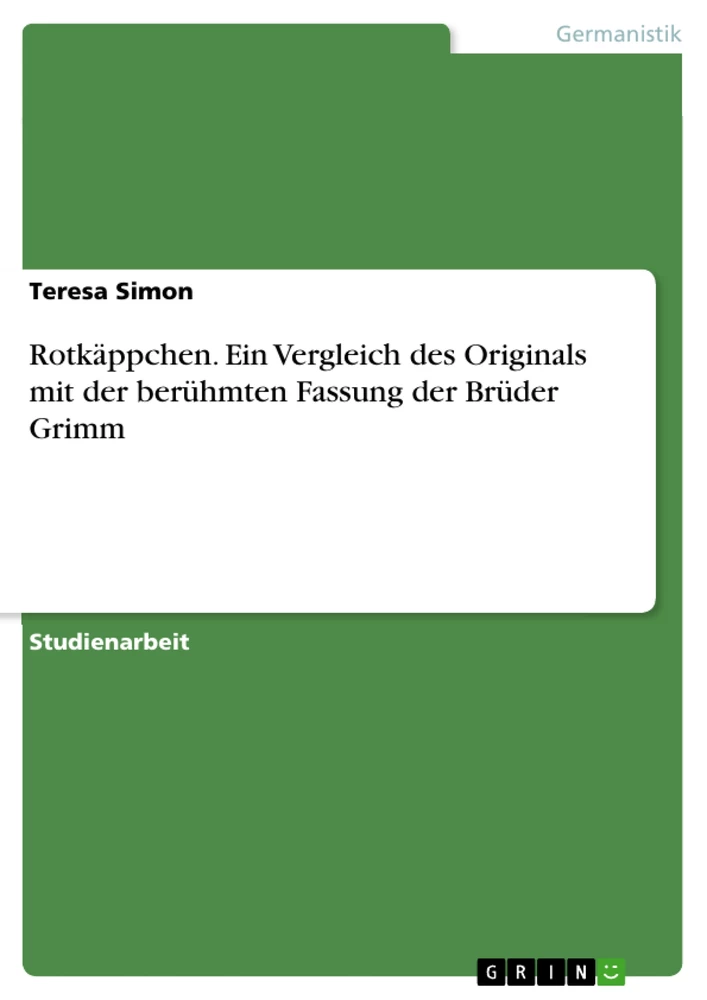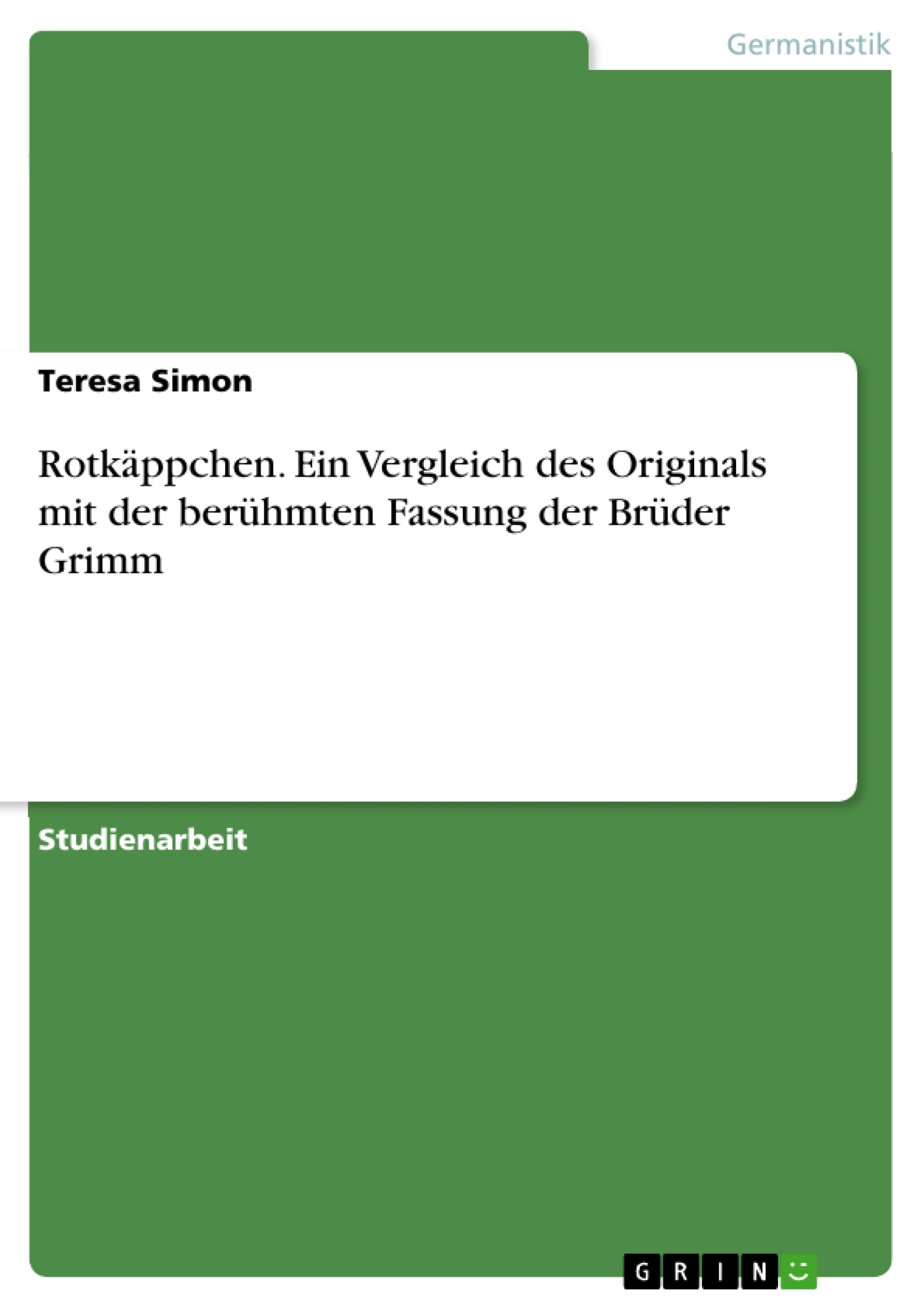Ziel dieser Arbeit ist, es das 26. Märchen der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm inhaltlich zu analysieren und durch direkten Vergleich mit seinem Vorgänger "Le petit chaperon rouge" von Charles Perrault gegebenenfalls feststellen zu können, ob es sich bei der Grimmschen Version um eine reine Übersetzung des Französischen handelt oder ob "Rotkäppchen" hinsichtlich seines Inhalts sowie der Bedeutung neu aufgegriffen wurde.
Jeder kennt sie, ob als Gutenachtgeschichte aus Kindheitstagen, vorgelesen von den Eltern, oder durch Reklame und Medien: Die Erzählung von dem Mädchen mit der roten Kopfbedeckung und dem bösen Wolf, der es fressen wollte. Tatsächlich ist "Rotkäppchen" nicht nur bereits seit vielen Jahrzehnten eines der beliebtesten Märchen weltweit, es gehört außerdem zu den am meisten ausgedeuteten Märchen. Als Märchen Nr. 26 in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm bekannt geworden, begeistert die Erzählung bis zum heutigen Tag Kinder sowie Erwachsene. Trotz des großen und entscheidenden Erfolgs, den das Märchen dank der schriftlichen Fixierung der Brüder Grimm erhielt, tritt Rotkäppchen immer wieder auf neuartig in Bild- und Tonmedien auf. Mal als Parodie (z.B. "Rotkäppchen auf Amtsdeutsch"), ein anderes Mal als spannender Fantasy-Thriller (z.B. "Red Riding Hood" 2011). Sogar in der Lebensmittelindustrie findet man Rotkäppchen als den Namen einer Getränkefirma oder Logo eines Käseprodukts wieder.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretisches
- 2.1 Der Märchenbegriff
- 2.1.1 Volksmärchen
- 2.1.2 Kunstmärchen
- 2.2 Entstehungsgeschichte der Kinder- und Hausmärchen
- 3. „Rotkäppchen“ – Kinder- und Hausmärchen Nr. 26
- 3.1 Hintergrund
- 3.2 Inhalt
- 3.3 Analyse
- 4. Vergleich mit Perraults „Le Petit Chaperon Rouge“
- 4.1 Charles Perrault
- 4.2 Vergleich des Inhalts
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das 26. Märchen der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, „Rotkäppchen“. Das Hauptziel ist es, den Inhalt des Märchens zu untersuchen und durch einen Vergleich mit Perraults „Le Petit Chaperon Rouge“ zu ermitteln, ob die Grimmsche Version eine reine Übersetzung darstellt oder ob „Rotkäppchen“ hinsichtlich seines Inhalts und seiner Bedeutung neu interpretiert wurde. Die Arbeit beinhaltet eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Märchenbegriff, insbesondere mit den Unterscheidungen zwischen Volks- und Kunstmärchen.
- Analyse von „Rotkäppchen“ der Brüder Grimm
- Vergleich mit Perraults „Le Petit Chaperon Rouge“
- Untersuchung des Märchenbegriffs (Volksmärchen vs. Kunstmärchen)
- Hintergrundinformationen zu den Brüdern Grimm und Charles Perrault
- Interpretation und Deutung der beiden Märchenfassungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Bedeutung und Popularität des Märchens „Rotkäppchen“ heraus. Sie hebt die verschiedenen Adaptionen des Märchens in unterschiedlichen Medien hervor und benennt das Ziel der Arbeit: die inhaltliche Analyse des Grimmschen „Rotkäppchens“ und dessen Vergleich mit der Version von Perrault. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und erläutert kurz die einzelnen Kapitel. Die zentrale Frage lautet, ob die Grimmsche Version eine bloße Übersetzung oder eine eigenständige Neuinterpretation darstellt.
2. Theoretisches: Dieses Kapitel beleuchtet den Märchenbegriff und stellt die Unterscheidung zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen dar, wobei die Definition Lüthis herangezogen wird. Es wird der historische Kontext der Entstehung der Grimmschen Märchen erläutert, um das Verständnis von „Rotkäppchen“ zu erleichtern. Die Unterscheidung zwischen Volksmärchen (wie das Grimmsche „Rotkäppchen“) als mündlich überlieferte und veränderte Erzählungen und Kunstmärchen (wie Perraults Version), die von einem Autor schriftlich fixiert wurden, wird detailliert behandelt und bildet die theoretische Grundlage für den anschließenden Vergleich.
3. „Rotkäppchen“ – Kinder- und Hausmärchen Nr. 26: Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Analyse des Grimmschen „Rotkäppchens“. Es beginnt mit Hintergrundinformationen aus den Originalanmerkungen der Brüder Grimm und liefert eine detaillierte Inhaltsangabe des Märchens. Die Analyse selbst, deren spezifischer Inhalt hier nicht vorweggenommen wird, wird tiefgehend sein und vermutlich verschiedene Aspekte der Erzählung, wie Charaktere, Handlungsstruktur und Symbolik, untersuchen. Die Verwendung der Originalanmerkungen der Brüder Grimm deutet auf eine besonders sorgfältige und fundierte Interpretation hin.
4. Vergleich mit Perraults „Le Petit Chaperon Rouge“: In diesem Kapitel wird Perraults „Le Petit Chaperon Rouge“ vorgestellt, einschließlich eines kurzen Überblicks über Perraults Leben und Werk. Der Inhalt von Perraults Märchen wird zusammengefasst und mit dem der Grimmschen Version verglichen. Dieser Vergleich wird sich voraussichtlich auf inhaltliche Unterschiede, stilistische Besonderheiten und unterschiedliche Interpretationen der Geschichte konzentrieren. Die Analyse wird verschiedene Deutungsansätze zu beiden Fassungen heranziehen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten.
Schlüsselwörter
Rotkäppchen, Brüder Grimm, Charles Perrault, Märchen, Volksmärchen, Kunstmärchen, Märchenanalyse, Vergleich, Inhaltsanalyse, Deutung, Kinder- und Hausmärchen, mündliche Tradition, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu „Rotkäppchen“-Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert das Märchen „Rotkäppchen“ der Brüder Grimm (Kinder- und Hausmärchen Nr. 26) und vergleicht es mit der Version von Charles Perrault („Le Petit Chaperon Rouge“). Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Grimmsche Version eine reine Übersetzung oder eine eigenständige Neuinterpretation darstellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Märchenbegriff (Volksmärchen vs. Kunstmärchen), eine detaillierte Inhaltsanalyse von Grimms „Rotkäppchen“, einen Vergleich mit Perraults Version, Hintergrundinformationen zu den Brüdern Grimm und Charles Perrault sowie eine Interpretation und Deutung beider Märchenfassungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, theoretische Grundlagen (Märchenbegriff, Entstehung der Kinder- und Hausmärchen), Analyse von Grimms „Rotkäppchen“, Vergleich mit Perraults „Le Petit Chaperon Rouge“ und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Aspekte von „Rotkäppchen“ werden analysiert?
Die Analyse von Grimms „Rotkäppchen“ umfasst Hintergrundinformationen aus den Originalanmerkungen der Brüder Grimm, eine detaillierte Inhaltsangabe und eine tiefgehende Untersuchung verschiedener Aspekte der Erzählung, wie Charaktere, Handlungsstruktur und Symbolik.
Wie wird der Vergleich mit Perraults Version durchgeführt?
Der Vergleich mit Perraults „Le Petit Chaperon Rouge“ beinhaltet einen Überblick über Perraults Leben und Werk, eine Zusammenfassung des Inhalts seines Märchens und einen Vergleich mit der Grimmschen Version hinsichtlich inhaltlicher Unterschiede, stilistischer Besonderheiten und unterschiedlicher Interpretationen. Die Analyse zieht verschiedene Deutungsansätze heran und beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rotkäppchen, Brüder Grimm, Charles Perrault, Märchen, Volksmärchen, Kunstmärchen, Märchenanalyse, Vergleich, Inhaltsanalyse, Deutung, Kinder- und Hausmärchen, mündliche Tradition, literarische Analyse.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die theoretischen Grundlagen umfassen die Definition des Märchenbegriffs, insbesondere die Unterscheidung zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. Die Arbeit bezieht sich dabei auf die Definition von Lüthi.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Untersuchung des Inhalts von Grimms „Rotkäppchen“ und der Vergleich mit Perraults Version, um zu klären, ob es sich bei der Grimmschen Fassung um eine reine Übersetzung oder eine eigenständige Neuinterpretation handelt.
- Quote paper
- Teresa Simon (Author), 2020, Rotkäppchen. Ein Vergleich des Originals mit der berühmten Fassung der Brüder Grimm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170526