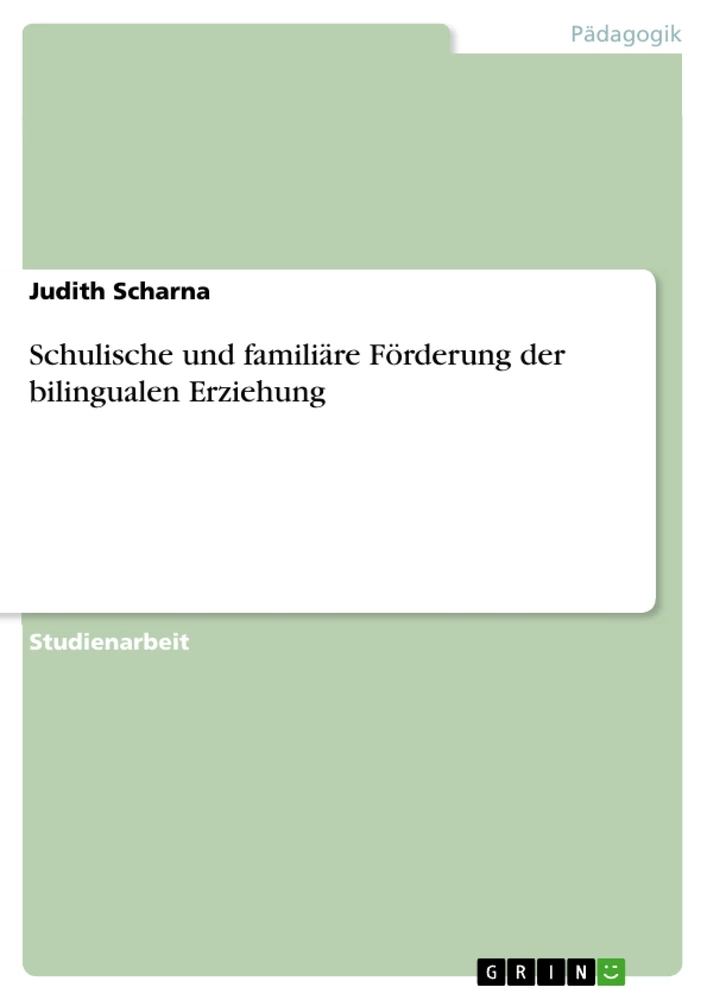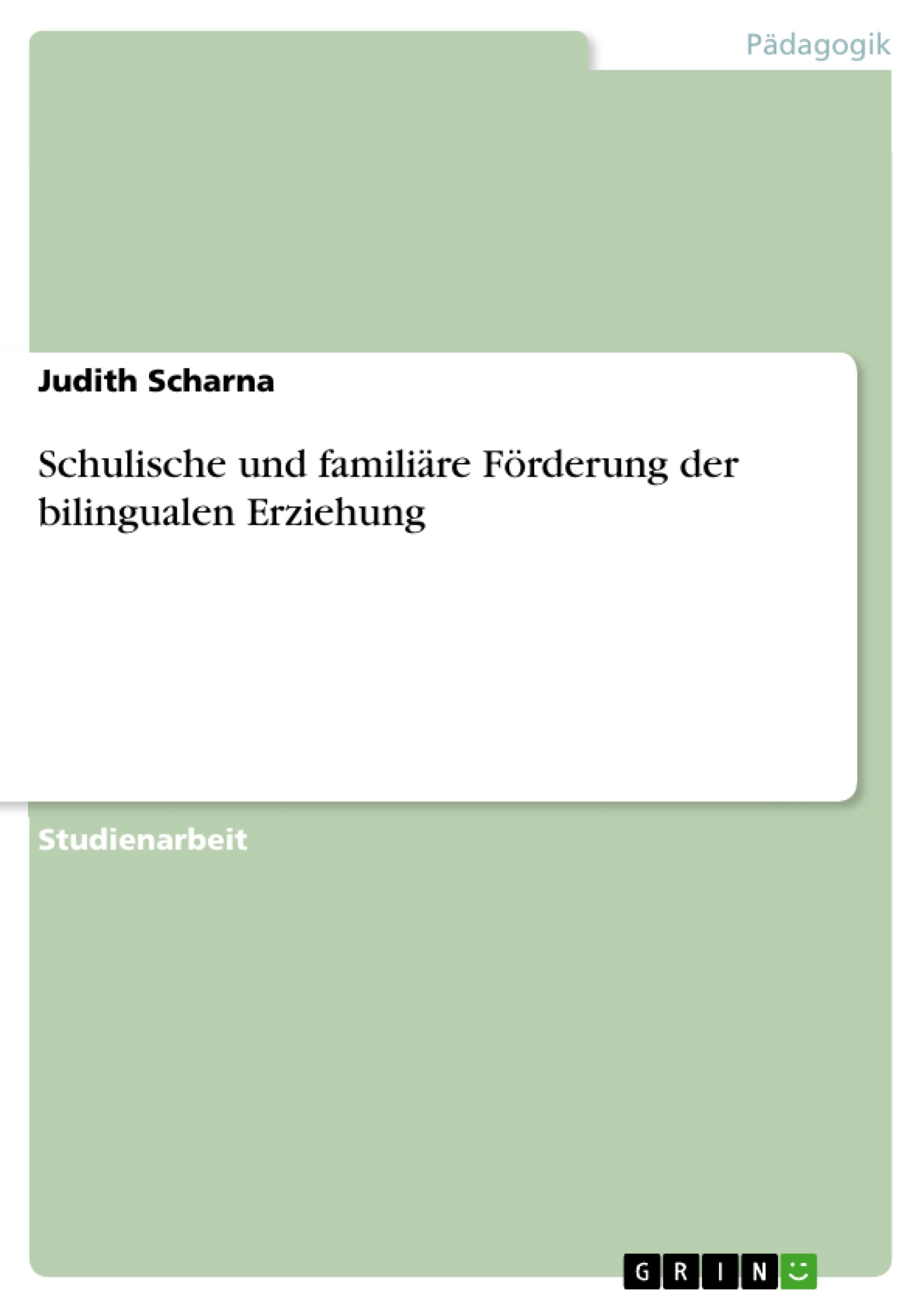Gegenstand dieser Hausarbeit wird die Frage sein, unter welchen Umständen man eine bilinguale Erziehung für die Zugewanderten ermöglichen kann. Dabei stehen vor allem die Teilbereiche der schulischen und der familiären bilingualen Erziehung im Vordergrund. Erläutert werden die Themen anhand von Fallbeispielen und verschiedenen Modellen. Außerdem werden Ansätze der Förderung für die einzelnen Teilbereiche vorgestellt.
Diese Fragestellung ist deshalb sonderpädagogisch relevant, weil laut dem KMK- Beschluss vom 26.06.1998, ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Sprache vorliegt, “wenn das Kind oder der Jugendliche aufgrund problematischer Entwicklungs- und Lernbedingungen dabei behindert wird, sprachliche Handlungskompetenzen zu erwerben.”
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Definition „bilinguale Erziehung“
- 2.1.1 Simultan bilinguale Kinder
- 2.1.2 Sukzessiv bilinguale Kinder
- 2.2 Einordnung ins Weltgeschehen
- 2.3 Was sind die Probleme?
- 2.4 Teilbereich schulisch
- 2.4.1 Fallbeispiele
- 2.4.2 Konsequenzen aus den Fallbeispielen
- 2.4.3 Modelle der schulischen einsprachigen Bildung
- 2.4.4 Modelle der schulischen zweisprachigen Bildung
- 2.4.5 Modelle der schulischen zweisprachigen Bildung in Deutschland
- 2.4.6 Ansätze der schulischen bilingualen Förderung
- 2.5 Teilbereich: familiär
- 2.5.1 Fallbeispiele
- 2.5.2 Das "one-person - one language" Prinzip (OPOL)
- 2.5.3 Probleme/Nachteile Deutsch innerhalb der Familie bei anderer Herkunftssprache
- 2.5.4 Ansätze der familiären bilingualen Förderung
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Möglichkeiten bilingualer Erziehung für Zugewanderte, mit besonderem Fokus auf die schulischen und familiären Aspekte. Sie beleuchtet Herausforderungen und präsentiert verschiedene Fördermodelle anhand von Fallbeispielen.
- Definition und Arten bilingualer Erziehung (simultan vs. sukzessiv)
- Herausforderungen bilingualer Erziehung im schulischen Kontext
- Fördermodelle für bilinguale Erziehung in Schule und Familie
- Die Rolle der Familie bei der bilingualen Erziehung
- Fallbeispiele zur Veranschaulichung der Herausforderungen und Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der bilingualen Erziehung im Kontext von Migration und Integration ein. Sie verweist auf die Bedeutung von Sprache für Integration und benennt die zentrale Forschungsfrage: Unter welchen Umständen ist eine bilinguale Erziehung für Zugewanderte möglich? Die Relevanz für die Sonderpädagogik wird anhand des KMK-Beschlusses von 1998 hinsichtlich sprachlicher Förderbedarfe erläutert. Die Arbeit kündigt die Betrachtung schulischer und familiärer Aspekte an.
2 Hauptteil: Dieser Kapitel behandelt umfassend die Definition von bilingualer Erziehung, differenziert zwischen simultaner und sukzessiver Bilingualität und ordnet das Thema in den gesellschaftlichen Kontext von Migration ein. Es werden Probleme und Herausforderungen im schulischen und familiären Bereich beleuchtet. Dabei werden verschiedene Modelle der schulischen (ein- und zweisprachigen) Bildung vorgestellt, ebenso wie Ansätze der Förderung im schulischen und familiären Kontext. Konkrete Fallbeispiele veranschaulichen die komplexen Situationen und die Notwendigkeit differenzierter Förderansätze. Das "one-person-one-language"-Prinzip wird als ein wichtiger Ansatz in der familiären bilingualen Förderung diskutiert.
Schlüsselwörter
Bilinguale Erziehung, Simultane Bilingualität, Sukzessive Bilingualität, Migration, Integration, Sprachförderung, Schulische Bildung, Familiäre Bildung, Fördermodelle, Fallbeispiele, "one-person-one-language"-Prinzip, Sonderpädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Bilinguale Erziehung bei Zugewanderten
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema der bilingualen Erziehung bei Zugewanderten. Sie beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil mit detaillierter Betrachtung schulischer und familiärer Aspekte, sowie ein Fazit. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und den verschiedenen Fördermodellen für bilinguale Erziehung, veranschaulicht anhand von Fallbeispielen.
Welche Arten bilingualer Erziehung werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen simultaner Bilingualität (gleichzeitige Erwerbung zweier Sprachen) und sukzessiver Bilingualität (aufeinanderfolgende Erwerbung zweier Sprachen).
Welche Aspekte der bilingualen Erziehung werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt sowohl den schulischen als auch den familiären Kontext der bilingualen Erziehung. Im schulischen Bereich werden verschiedene Modelle der ein- und zweisprachigen Bildung vorgestellt und analysiert. Im familiären Bereich wird insbesondere das "one-person-one-language"-Prinzip (OPOL) diskutiert.
Welche Herausforderungen werden in der Hausarbeit thematisiert?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der bilingualen Erziehung sowohl im schulischen als auch im familiären Bereich. Konkrete Fallbeispiele verdeutlichen die Komplexität der Situationen und die Notwendigkeit differenzierter Förderansätze.
Welche Fördermodelle werden vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert verschiedene Fördermodelle für die bilinguale Erziehung in Schule und Familie. Diese Modelle werden im Detail erläutert und anhand von Fallbeispielen illustriert.
Welche Rolle spielt die Familie bei der bilingualen Erziehung?
Die Rolle der Familie in der bilingualen Erziehung wird als essentiell betrachtet. Die Hausarbeit diskutiert die Bedeutung der familiären Unterstützung und beleuchtet Strategien wie das OPOL-Prinzip.
Was ist das "one-person-one-language"-Prinzip (OPOL)?
Das OPOL-Prinzip ist eine Strategie in der familiären bilingualen Erziehung, bei der jede Bezugsperson eine Sprache spricht, um den Kindern den Erwerb beider Sprachen zu erleichtern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Bilinguale Erziehung, Simultane Bilingualität, Sukzessive Bilingualität, Migration, Integration, Sprachförderung, Schulische Bildung, Familiäre Bildung, Fördermodelle, Fallbeispiele, "one-person-one-language"-Prinzip, Sonderpädagogik.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Unter welchen Umständen ist eine bilinguale Erziehung für Zugewanderte möglich?
Wie wird die Relevanz für die Sonderpädagogik begründet?
Die Relevanz für die Sonderpädagogik wird anhand des KMK-Beschlusses von 1998 hinsichtlich sprachlicher Förderbedarfe erläutert.
- Quote paper
- Judith Scharna (Author), 2021, Schulische und familiäre Förderung der bilingualen Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170242