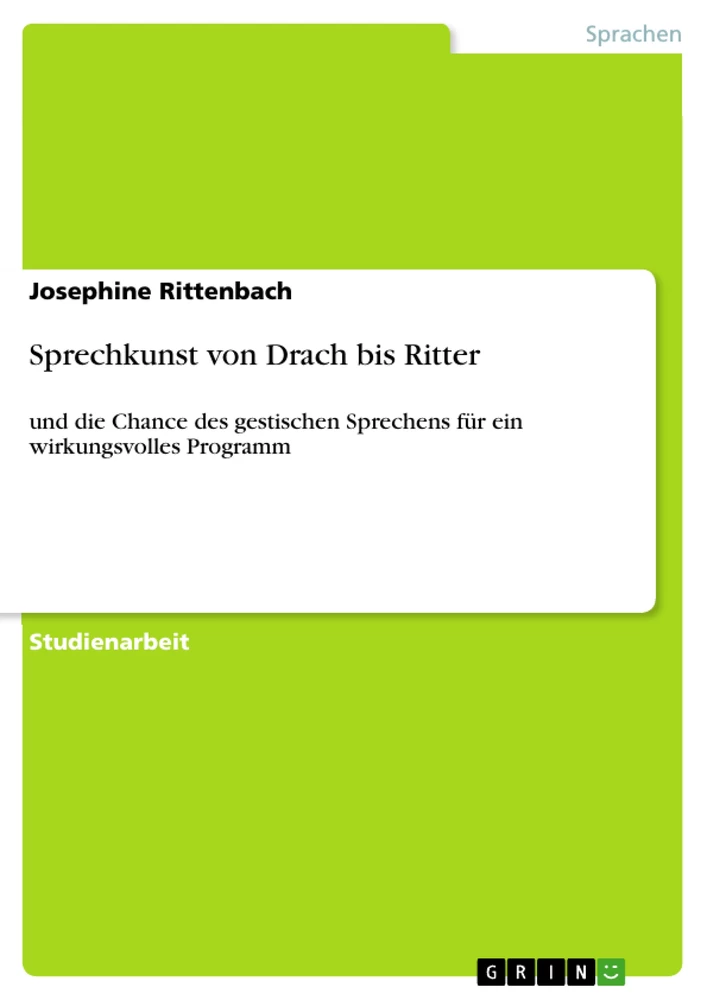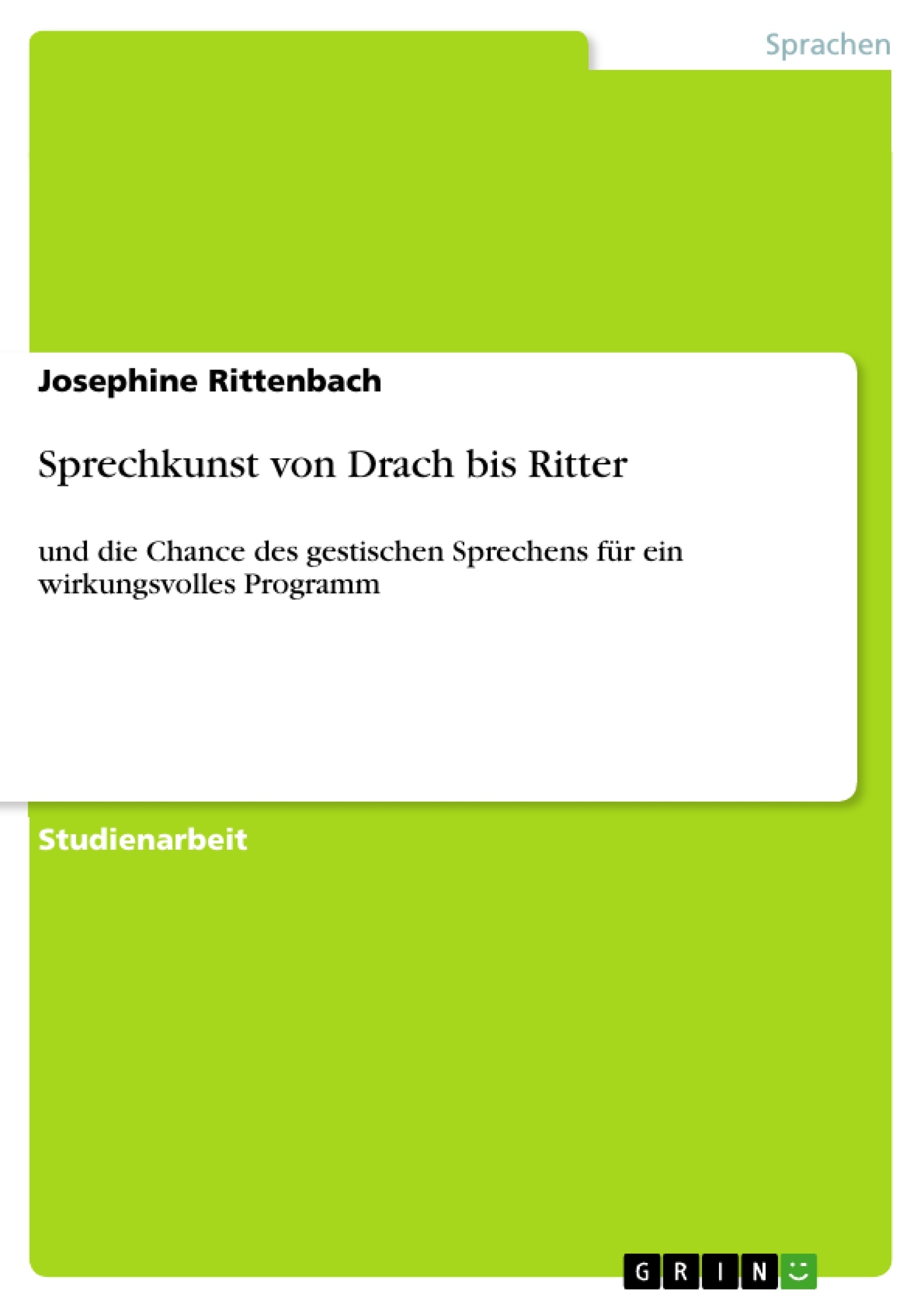Da mich das künstlerische Unterfangen Texte zu sprechen fasziniert, bin ich vor vier Jahren nach Jena gegangen um Sprechkunst - ein Bereich der Sprechwissenschaft - zu studieren. Die Faszination gibt aber auch den Impuls, mich theoretisch mit Fragen der Sprechkunst auseinander zu setzen. Deshalb möchte ich im ersten Teil dieser Arbeit klären, wie diese Kunstform in der Forschungsliteratur definiert wird, welche Auffassungen und Kernaussagen zu diesem Thema getroffen wurden und inwieweit sich diese aufeinander beziehen. Die frühesten Äußerungen zur sprecherischen Gestaltung finden sich bereits bei Martin Seydel, Ewald Geissler, Emil Milan und Richard Wittsack. Da es aber den Rahmen einer Hausarbeit sprengen würde und ich nur einen groben Überblick geben möchte, werde ich mich nicht auf alle, sondern auf einige ausgewählte sprechwissenschaftliche Äußerungen zur Sprechkunst konzentrieren, im Besonderen auf die von Erich Drach und Irmgard Weithase. Die anschließende Darstellung der Vortragskunst nach Eva-Maria Krech und der ästhetischen Kommunikation nach Hellmut Geißner, sowie die Äußerungen Gottfried Meinholds und Egon Aderholds sollen weiterhin helfen, den Begriff der Sprechkunst und ihr Anliegen einzugrenzen und verständlich zu machen. Von diesem Verständnis ausgehend werde ich dann im zweiten Teil der Arbeit auf das Experimentierfeld sprechkünstlerischer Arbeit – die Programmkunst – eingehen. Dabei möchte ich auf das von Margaret Bräunlich herausgestellte Anliegen künstlerischer Programme eingehen und prüfen, ob der aus dem Theater stammende Gestus-Begriff, wie ihn Martina Haase und Hans Martin Ritter vorstellen, ein zusätzliches Mittel für den Aneignungs- und Gestaltungsprozess literarischer Texte sein könnte.
Inhaltsverzeichnis
I. Teil
1. Einführung und Fragestellung zum Thema Sprechkunst
2. Kurzer Abriss über die Entwicklungsgeschichte der Sprechwissenschaft
3. Vertreter der Sprechkunst und ihre Auffassungen
3.1 Erich Drach
3.2 Irmgard Weithase
3.3 Eva-Maria Krech
3.4 Hellmut Geißner
3.5 Gottfried Meinhold
3.6 Egon Aderhold
4. Fazit zu Teil I
II. Teil
1. Einführung und Fragestellung zum Anliegen der Programmgestaltung
2. Forum sprechkünstlerischer Arbeit und der Gestus-Begriff
2.1 Programmgestaltung nach Margaret Bräunlich
2.2 Martina Haase und der Gestus-Begriff
2.3 Hans Martin Ritter und der Gestus-Begriff
3. Fazit zu Teil II
4. Literaturverzeichnis
Teil I
1. Einführung und Fragestellung zum Thema Sprechkunst
Da mich das künstlerische Unterfangen Texte zu sprechen fasziniert, bin ich vor vier Jahren nach Jena gegangen um Sprechkunst - ein Bereich der Sprechwissenschaft - zu studieren. Die Faszination gibt aber auch den Impuls, mich theoretisch mit Fragen der Sprechkunst auseinander zu setzen. Deshalb möchte ich im ersten Teil dieser Arbeit klären, wie diese Kunstform in der Forschungsliteratur definiert wird, welche Auffassungen und Kernaussagen zu diesem Thema getroffen wurden und inwieweit sich diese aufeinander beziehen. Die frühesten Äußerungen zur sprecherischen Gestaltung finden sich bereits bei Martin Seydel, Ewald Geissler, Emil Milan und Richard Wittsack. Da es aber den Rahmen einer Hausarbeit sprengen würde und ich nur einen groben Überblick geben möchte, werde ich mich nicht auf alle, sondern auf einige ausgewählte sprechwissenschaftliche Äußerungen zur Sprechkunst konzentrieren, im Besonderen auf die von Erich Drach und Irmgard Weithase. Die anschließende Darstellung der Vortragskunst nach Eva-Maria Krech und der ästhetischen Kommunikation nach Hellmut Geißner, sowie die Äußerungen Gottfried Meinholds und Egon Aderholds sollen weiterhin helfen, den Begriff der Sprechkunst und ihr Anliegen einzugrenzen und verständlich zu machen.
Von diesem Verständnis ausgehend werde ich dann im zweiten Teil der Arbeit auf das Experimentierfeld sprechkünstlerischer Arbeit – die Programmkunst – eingehen. Dabei möchte ich auf das von Margaret Bräunlich herausgestellte Anliegen künstlerischer Programme eingehen und prüfen, ob der aus dem Theater stammende Gestus-Begriff, wie ihn Martina Haase und Hans Martin Ritter vorstellen, ein zusätzliches Mittel für den Aneignungs- und Gestaltungsprozess literarischer Texte sein könnte.
2. Kurzer Abriss über die Entwicklungsgeschichte der Sprechwissenschaft
Da die Sprechkunst selbst ein Gebiet der Sprechwissenschaft darstellt, gehen auch die Äußerungen zur Sprechkunst mit der Entwicklungsgeschichte des Faches einher. An dieser Stelle möchte ich deshalb ganz kurz auf diese Entstehung eingehen, nicht zuletzt damit die später beschriebenen sprechwissenschaftlichen Äußerungen in einem engeren Bezug zum Fach stehen.
Die Herausbildung der Sprechwissenschaft zu einer eigenständigen und anerkannten Wissenschaft liegt in Deutschland zwar erst kurze Zeit zurück, aber genauer betrachtet, kann sie auf eine viel ältere Geschichte verweisen. "Die heutige Sprechkunde ist aus der antiken Rhetorik erwachsen"[1], schreibt Christian Winkler und Hellmut Geißner führt weiter aus: "denn die griechisch-römische Rhetorik begründete, wenn auch unter anderen politischen Voraussetzungen und folglich mit anderen Zielen, bereits eine Theorie `mündlicher Kommunikation´, die praktische Politik und Rechtslehre ebenso einschloss wie Vortragslehre und praktische Psychologie, wozu im Zeitalter der literarischen Rhetorik die Suasorien ebenso hinzukamen wie die Deklamatorien […].“[2]
Noch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts gab es Lehrstühle für Poetik und Rhetorik, die das tradierte Fachwissen der beiden redenden Künste vermittelten. Diese Tradition wurde jedoch durch verschiedene politische, gesellschaftliche, philosophische und wissenschaftsgeschichtliche Einflüsse fast gänzlich verdrängt. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts tritt die Mündlichkeit wieder ins Bewusstsein und wird z.B. von Professoren wie Martin Seydel (Stimmkunde), Emil Milan (Vortragskunst) und Ewald Geißler (Rhetorik) aufgegriffen. Zusammen mit der Aussprachelehre von Theodor Siebs (1898), diversen reformpädagogischen Bestrebungen und sprachtheoretischen Ansätzen wie die von Herder, Humboldt und Fichte sowie den Vorarbeiten von Ewald Geißler bildete sich die Sprecherziehung heraus.
Dieser Begriff der „Sprecherziehung“ ist dem gleichnamigen Buch von Erich Drach, das 1922 entstand, zu verdanken. Auch wenn die Bestimmung der genauen Geburtsstunde der Sprecherziehung schwierig ist, so besteht für Hellmut Geißner kein Zweifel an der Erkenntnis, dass die systematische Entwicklung der Sprechwissenschaft und damit auch der Sprechkunst in Deutschland mit Erich Drach begann und dabei auf Ewald Geissler basiert.[3]
3. Vertreter der Sprechkunst und ihre Auffassungen
3.1 Erich Drach (1885-1935)
Erich Drach, der wie bereits erwähnt als Begründer und Vater der Sprecherziehung gilt, war Lektor für Stimmkunde und Vortragskunst an der Universität Berlin. Er gründete 1920 die "Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich gebildeten Fachvertreter der Stimmkunde, Vortragslehre und Sprachkunst" und 1930 den "Deutschen Ausschuss für Sprechkunde und Sprecherziehung".
In seiner „Sprecherische[n] Gestaltungslehre“[4], die sich besonders an den Deutschunterricht richtet, beschreibt er, dass die Dichtung endlich kein „totes Schreibwerk“[5] mehr ist, sondern vielmehr die „klingende Rede eines sprechenden Menschen“.[6] Entschieden spricht er sich gegen Eduard Sievers Grundgedanken aus, dass nur der „Autorenleser“[7], der exakt die vom Text vorgegebene ursprüngliche Schallform nachbilden kann, den Eindruck des sinnvoll Richtigen erzeugen kann. Der „Selbstleser“[8] ruft Sievers zu Folge nur falsche Eindrücke hervor.
Drach bestätigt zwar, dass jede Dichtung ihre eigenen objektiven Schallform-Merkmale hat, aber er glaubt nicht daran, dass es nur eine objektiv richtige Fassung gibt, ein Gedicht zu sprechen. Denn selbst wenn ein Sprecher einige Merkmale der idealen Schallform treffen würde, bleibt die empirische Schallform immer seine spezifisch Eigene und Ich-Bedingte.
Die „ideale“ Konzeptionsbestimmung eines Dichters ist zudem nicht nur psychisch schwierig nachzuempfinden, sondern auch physisch schier unmöglich. Außerdem teilt Drach nicht die Meinung, dass es dem Hörer ausschließlich um eine reine Darstellung des Gedichts als objektives Kunstwerk geht und überhaupt nicht um den Erlebnisausdruck des Dichters oder Sprechers. Die Dichtung ist zwar beliebig oft sprechbar, aber in ihrer Ausführung nie völlig identisch. Und gerade die Erlebnisfähigkeit bzw. Auffassung des Sprechers ist es, durch die sich der Sinn der Dichtung dem Sprecher offenbart und dadurch wiederum auch für den Hörer verstehbar wird.
Deshalb vereint für Drach ein ansprechender empirischer Vortrag objektive Merkmale der nur vorgestellten idealen Schallform des Dichters mit subjektiven Merkmalen des Ausdruckswillens eines Sprechers. Außerdem, so resümiert Drach, wirkt starre Formtreue oftmals erschreckend langweilig und geht am eigentlichen Sinn des Vortrags völlig vorbei.[9] Denn der Zweck des Dichtungsvortrags liegt vor allem darin, dem Hörer ein künstlerisches Genusserlebnis zu bereiten:
Denn nur davon zieht die Sprechkunst Leben und Lebensberechtigung, dass sie ihren Hörern ein besonderes seelisch-geistiges Geschenk zu geben hat, Zugang zu Erlebniswelten, die ihnen ohne den Vortrag nicht oder nicht so reich zugänglich wären. […]. Der Zweck des Sprechens ist nur erfüllt, wenn in den Hörern erweckt wurde, was der Sprecher wecken wollte. Lebensnerv allen Sprechens ist die Sprechwirkung […] im Sinne von “in Mitleidenschaft gezogen werden.“[10]
Wenn Drach sich aber für das Anliegen und den Wirkungswillen der Sprechkunst interessiert, muss er natürlich auch den Sprecher selbst in den Fokus seiner Analyse stellen. Deshalb unterscheidet er drei Haupttypen von Sprechern, die er nach ihrer Einstellung und ihrer Motivation kategorisiert:
1. Der Virtuose. Unter dem Virtuosen versteht Drach den Schauspieler, der meist die „Erzählzwiesprache mit Zuhörern“[11] mit dem „Bühnenspiel vor Zuschauern“[12] verwechselt und seine Textwahl nach den besten „Reißern“[13] wild zusammenmischt. Zudem würde der Schauspieler oftmals verkennen, dass es beim Rezitieren nicht um das Vormachen eines Kunststückes geht und Theatralik hier völlig fehl am Platz ist.
2. Der Selbstinterpret zeigt sich am deutlichsten, wenn der Autor selbst aus seinen Werken liest, da es einzig um das Verständlichmachen der Dichtung geht. Dem Selbstinterpreten fehlt jedoch das Wissen um Technik und Ausdrucksstärke und somit ist auch die sprecherische Wirkung auf den Zuhörer eher gering.
3. Dem Rhapsoden geht es nur um die Sache selbst und die Wirkung auf den Zuhörer. Er sieht sich als Sprecher genau wie den Dichter als „Diener am Volk“[14] und nicht als „Diener am Wort“[15]. In erster Linie gilt es den Zuschauer emotional zu berühren und anzusprechen. Der Rhapsod ist auch der von Drach favorisierte Sprechertyp, da es ihm weder darum geht zu zeigen wie virtuos er ist, noch damit anzugeben, was sich alles in dem Gedicht herauslesen lässt.
3.2 Irmgard Weithase (1906-1982)
Irmgard Weithase war die Schülerin Geisslers und Lektorin für Sprechtechnik, Rede- und Vortragskunst an der Universität Jena. In ihrem „kleinen Vortragsbuch“[16] hebt sie die Bedeutung der Vortragskunst für die Dichtung hervor, wenn diese sich in all ihren Erscheinungsformen, vor allem in ihrem Rhythmus und Wohlklang, vollends entfalten soll. Dichtung bedarf also eines „vermittelnden, sie von ihrem toten Dasein auf dem Papier ins klingende Leben rufenden Künstlers“.[17]
Währenddessen Drach den Sprecher vor allem als „Diener am Volk“[18] sieht, ist der Dichtungssprecher nach Weithase einzig verpflichtet „Diener am Wort des Dichters“[19] und „Mittler zwischen der Welt des Dichters und der des Hörers“[20] zu sein. Das heißt, dass der Sprecher nicht wie der „Ich-Sprecher“[21] seine eigene Auffassung der Dichtung aufzwingen darf, sondern Stimmung, Gehalt und Rhythmus so einfangen und wiedergeben muss, wie es der Dichter in seinem Werk intendiert hat. Damit spricht sich Weithase ganz deutlich für den „Dichter-Sprecher“[22] aus.
Um der Eigenart der Dichtung gerecht zu werden, fordert sie von dem Sprecher einen angemessenen Sprechstil, der durch drei Faktoren bestimmt wird: Erstens durch den Stil der Dichtung und zweitens durch die Sprecherpersönlichkeit. Hier soll der Sprecher seine sprachlichen und menschlichen Eigenarten daraufhin prüfen, inwieweit diese der Dichtung und ihres Verfassers gerecht werden oder ob er eventuell zu einem darstellenden Vortrag, wie es dem Schauspieler zu Eigen ist, tendiert. Und drittens soll er dem Wesen seiner Zeit, in der die Dichtung vorgetragen wird, gerecht werden.
Der Sprecher muss sich also mit dem Sprechstil seiner Zeit, dem Stil seiner Sprecherpersönlichkeit und dem der vorzutragenden Dichtung auseinandersetzen. Sollten aber Diskrepanzen bestehen, so ist immer dem Stil der Dichtung Folge zu leisten.
Auf die Rezipientenwirkung geht Weithase nur beiläufig ein, indem sie darauf hinweist, dass die Wirkung der Vortragskunst auf den Hörer nicht allein davon abhängt, welche Textauswahl getroffen wurde, sondern vielmehr davon, ob der Sprechkünstler von der Dichtung und ihrem Wahrheitsgehalt überzeugt ist. Ist dies der Fall, ergibt sich die Wirkung ganz von selbst und die gesprochene Dichtung kann direkten Einfluss auf das Fühlen und Denken der Hörer nehmen.[23]
3.3 Eva-Maria Krech (geb. 1933)
Eva-Maria Krech war die Schülerin Hans Krechs und von 1990 bis 1998 Professorin für Sprechwissenschaft und Sprechkunst an der Universität Jena. In ihrer Abhandlung zur sprechkünstlerischen Gestaltung[24] definiert sie den Begriff „Vortragskunst“ folgendermaßen:
Vortragskunst ist die Kunst der sprechgestaltenden Dichtungsinterpretation. Die sprechkünstlerische Tätigkeit, in der sie zum Ausdruck kommt, heißt auch Rezitation oder einfach: Sprechen von Dichtungen. Das Produkt dieser Tätigkeit ist die sprechkünstlerisch interpretierte Dichtung, auch gesprochene Dichtung oder sprechkünstlerische Äußerung genannt.[25]
Aber Eva-Maria Krech geht in ihrer Analyse noch weiter und versteht unter Vortragskunst eine Kunstart, die sich erst im Prozess der „Sprechkünstlerischen Kommunikation“ realisiert.[26]
Das heißt, dass sich in diesem Prozess eine Begegnung des Hörers mit dem Kunstwerk vollzieht und die sprechkünstlerische Äußerung des Sprechers sinnlich erfahrbar wird. Basierend auf diesem Prozess kann das angeeignete Sprechkunstwerk überhaupt erst seine Wirkung entfalten. Unter Kommunikation ist in diesem Kontext ein „absichtsvolles, hörerbezogenes Gestalten und Darbieten von Kunst, dem auf der Rezipientenseite Erwartungen und Intentionen entsprechen, die ebenfalls auf Begegnungen und Erlebnisse mit Kunst zielen“[27] gemeint. Grundlage für das Zustandekommen der Kommunikation ist, dass Autor, Sprecher und Hörer über einen gemeinsamen Zeichenvorrat ebenso wie über einen zumindest ähnlichen Erkenntnis- und Erfahrungsvorrat verfügen.
Von einer gelungenen und erfolgreichen Kommunikation kann dann die Rede sein, wenn der Hörer im Prozess der ästhetischen Aneignung zu einem ganzheitlichen Erleben gelangt, in dem emotionale, kognitive und motivationale Aspekte wirksam sind und dies zu ästhetischem Genuss führt. Mit diesem Modell schafft Krech es nicht nur die Vortragskunst als kommunikativen Prozess an sich darzustellen und die kommunikativen Handlungen des Sprechers und Hörers zu beschreiben, sondern bekommt auch die Wirkung sprechkünstlerischer Interpretationen in den Blick. Auf diese Weise bezieht sie sich auf Erich Drach, dem es vor allem um das künstlerische Erlebnis für den Hörer ging, das Vortragskunst auslösen kann. Des Weiteren betont sie die Bedeutung der Sprechkunst für die Dichtungsaneignung, da sie ein „umfassenderes Rezeptionsangebot“[28] darstellt als der schriftlich fixierte Text.[29]
Hiermit stimmt sie mit der Auffassung von Irmgard Weithase überein, die in ihrer Analyse darlegt, dass erst die Rezitation die Dichtung vollkommen macht.
3.4 Hellmut Geißner (geb. 1926)
Während Eva-Maria Krech unter Vortragskunst einen Prozess der sprechkünstlerischen Kommunikation verkörpert sieht, prägte Geißner den Begriff der „ästhetischen Kommunikation“[30], den er von der ästhetischen, rhetorischen, phatischen und therapeutischen Kommunikation abgrenzt.
Da Sprecher, Werk und Hörer auch als Komponenten eines Kommunikationsprozesses gesehen werden können, nämlich als Kommunikator, Kommunikant und Kommunikanten, bezieht Geißner den kommunikationswissenschaftlichen Ansatz auf sprechkünstlerische Prozesse.
Ästhetische Kommunikation, die er als einen Teilbereich der Sprechwissenschaft beschreibt, definiert er als „Theorie des interpretierenden Textsprechens“ oder auch als „nachgestaltendes Sprechen von Dichtung“[31] und führt an anderer Stelle aus: „Dabei geht es um das unmittelbare, bzw. medienvermittelte reproduzierende Sprechdenken vorliegender Texte durch einen oder mehrere Sprecher.“[32]
Außerdem geht er geht davon aus, dass es keine objektiv richtige Schallform geben kann, genauso wie es keine objektive Rezeption gibt. Denn zwischen der Produktion und (sprecherischen) Reproduktion von Texten liegt immer eine unüberwindbare „historische Differenz“[33]. Geißner fordert deshalb eine „`wissende´ Subjektivität – eine kritisch durchreflektierte-, die gebunden ist durch Sinn und Struktur des durch Sprechen zu interpretierenden Textes.“[34] Das heißt einfach, dass sich der Sprecher um eine zeit- und hörerbezogene, werkadäquate sprechkünstlerische Interpretation bemühen sollte um das Ziel einer gemeinsamen Sinnkonstitution zu erreichen.
[...]
[1] Winkler, Christian: Sprechkunde und Sprecherziehung. Düsseldorf 1969. S. 74.
[2] Geißner, Hellmut: Sprechwissenschaft. Theorie der mündlichen Kommunikation. Königstein 1981.
S. 7.
[3] Vgl. Geißner, H.: Sprechwissenschaft. S. 7-9.
[4] Drach, Erich: Sprecherische Gestaltungslehre. In: Sprecherziehung. Rede. Vortragskunst. Hrsg. von Hans Lebede. Berlin 1930.
[5] Ebd. S. 24.
[6] Ebd.
[7] Ebd. S. 30.
[8] Ebd. S. 31.
[9] Vgl. Drach, E.: Sprecherische Gestaltungslehre. S. 24-42.
[10] Ebd. S. 32.
[11] Ebd. S. 42.
[12] Ebd.
[13] Ebd.
[14] Ebd. S. 43.
[15] Ebd.
[16] Weithase, Irmgard: Kleines Vortragsbuch. Weimar 1950.
[17] Ebd. S. 9.
[18] Drach, E.: Sprecherische Gestaltungslehre. S. 43.
[19] Weithase, I.: Kleines Vortragsbuch. S. 10.
[20] Ebd.
[21] Ebd. S. 11.
[22] Ebd.
[23] Vgl. Weithase, I.: Kleines Vortragsbuch. S. 37.
[24] Krech, E.-M.: Vortragskunst. Grundlagen der sprechkünstlerischen Gestaltung von Dichtung. Leipzig 1987.
[25] Ebd. S. 13.
[26] Krech, E.-M.: Warum Sprechkünstlerische Kommunikation? In: Anders, L. C./U. Hirschfeld: Sprechsprachliche Kommunikation. Probleme, Konflikte, Störungen. Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik. Frankfurt a. M. 2003. S. 183-192.
[27] Ebd. S. 185.
[28] Krech, E.-M.: Wirkungen und Wirkungsbedingungen sprechkünstlerischer Äußerungen. In: Sprechwirkung. Grundfragen, Methoden und Ergebnisse ihrer Erforschung. Hrsg. von Eva-Maria Krech, Günther Richter, Eberhard Stock, Jutta Suttner. Berlin 1991. S.196.
[29] Vgl. Krech, E.-M.: Wirkungen und Wirkungsbedingungen sprechkünstlerischer Äußerungen. S. 196.
[30] Geißner, Hellmut: Sprechwissenschaft. Theorie der mündlichen Kommunikation. Königstein 1988. S. 174.
[31] Ebd. S. 175.
[32] Geißner, Hellmut: Sprecherziehung. Didaktik und Methodik der mündlichen Kommunikation. Frankfurt a. M. 1986. S. 161.
[33] Geißner, H.: Sprechwissenschaft. S. 178.
[34] Ebd. S. 180.
- Quote paper
- Josephine Rittenbach (Author), 2006, Sprechkunst von Drach bis Ritter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117007