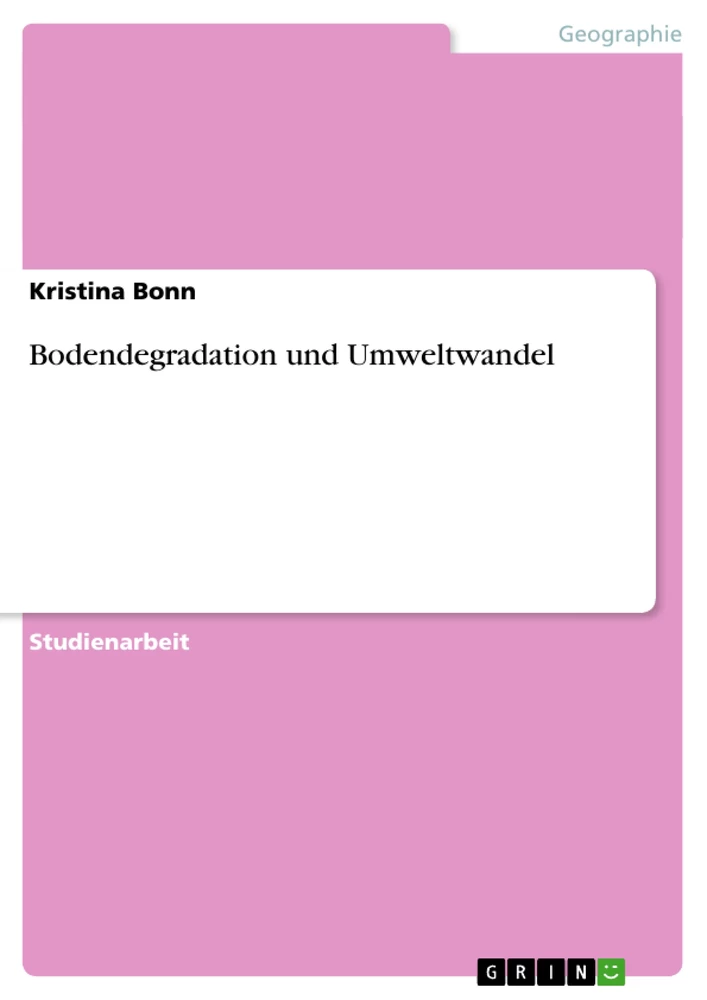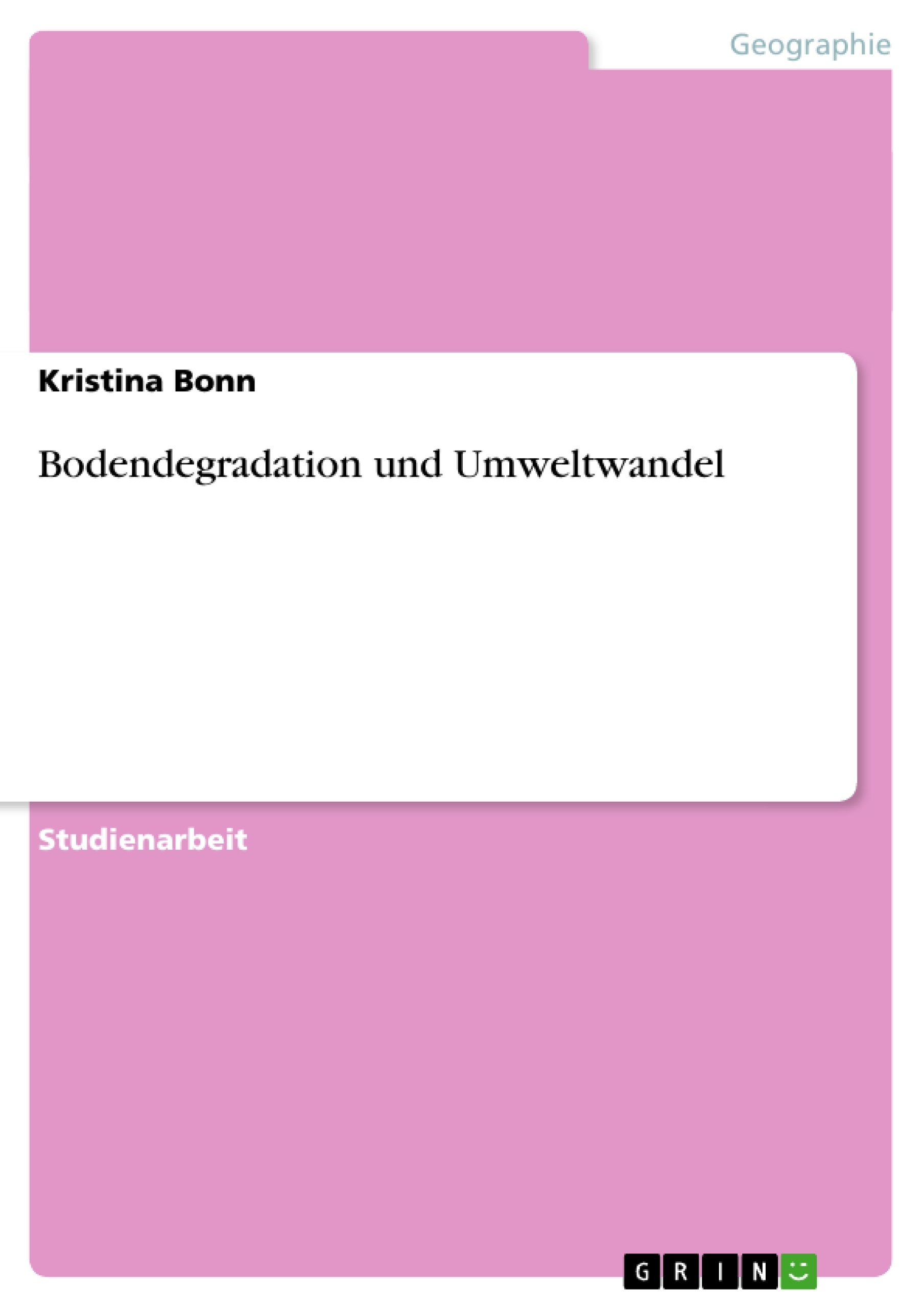[...] Die Entwicklung des Ackerbaus und verschiedener Landnutzungsformen waren bedeutende Schritte in der Evolution der Menschheit: Der Mensch wurde sesshaft und konnte sich permanent ernähren. Ein ertragreicher Boden war durch die Funktion der Produktion von Biomasse ein entscheidendes Kriterium für die Errichtung von Siedlungen, für die Sicherung der menschlichen Nahrungsversorgung und somit auch für die Arterhaltung des Menschen. Mit der Sesshaftwerdung des Menschen wuchs die Bevölkerung an und stellte gleichzeitig höhere Ansprüche an ihre Umwelt. Der Mensch weitete die landwirtschaftlichen Nutzflächen aus und intensivierte die Landwirtschaft zunächst durch verschiedene Bewirtschaftungsformen, dann durch Mechanisierung und schließlich auch durch Bodendüngung. Durch diese Eingriffe in die Umwelt und durch die dauerhafte, intensive Bodennutzung wurde und wird auch heute noch einerseits die Fertilität der Böden reduziert und andererseits der erosive Transport durch Wind und Wasser verstärkt und ein flächenhafter Abtrag des Bodens beschleunigt. Der Mensch, der sich größtenteils (zu 70%) von pflanzlichen Erzeugnissen ernährt, zerstört sich seinen wichtigsten Produktionsfaktor, den Boden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Problemstellung
- 3 Creeping Disaster – Bodendegradation
- 3.1 Definition 'Boden'
- 3.2 Funktionen des Bodens
- 3.3 Definition 'Degradation'
- 3.4 Ursachen von Bodendegradation
- 3.4.1.1 Physische Ursachen der Bodendegradation
- 3.4.1.2 Anthropogene Ursachen der Bodendegradation
- 3.4.1.3 Ursachenkomplex
- 3.5 Prozesse der Bodendegradation
- 3.5.1 Erosionsprozesse
- 3.5.1.1 Wassererosion
- 3.5.1.2 Winderosion
- 3.5.2 Prozesse der physikalischen Bodendegradation
- 3.5.2.1 Versiegeln - sealing
- 3.5.2.2 Hardsetzen - hardsetting
- 3.5.2.3 Verdichten - compaction
- 3.5.2.4 Verkrusten - crusting
- 3.5.3 Prozesse der chemischen Bodendegradation
- 3.5.3.1 Nährstoffverlust
- 3.5.3.2 Humusabbau
- 3.5.3.3 Versauerung
- 3.5.3.4 Versalzung
- 3.5.3.5 Kontamination
- 3.5.1 Erosionsprozesse
- 3.6 Folgenkomplex der Bodendegradation
- 3.6.1 Folgen für Natur und Klima
- 3.6.1.1 Verstärkung des Treibhauseffekts
- 3.6.1.2 Belastung von Grundwasser und Flüssen mit Schwermetallen
- 3.6.1.3 Biodiversitätsverlust, Artenverlust und Verlust von genetischem Material
- 3.6.2 Folgen für den Menschen
- 3.6.2.1 Gefährdung der Nahrungsmittelversorgung
- 3.6.2.2 Armutsaufschaukelung
- 3.6.2.3 Verdrängung indigener Bevölkerung und Migration
- 3.6.1 Folgen für Natur und Klima
- 3.7 Fazit: Bodendegradation als Ursachen-Prozess-Aggregat-Folgen-Komplex
- 3.8 Globales Ausmaß und Regionen der Bodendegradation
- 4 Bodendegradation und Menschliche Sicherheit
- 4.1 Menschliche Sicherheit
- 4.2 Menschliche Vulnerabilität
- 4.3 Fazit: Regions at Risk: Degradation als Bedrohung menschlicher Sicherheit
- 5 Fallbeispiel Mali
- 5.1 Allgemeine Informationen
- 5.2 Umweltkatastrophe Desertifikation
- 5.3 Physische Verwundbarkeitsdeterminanten
- 5.3.1 Klimatische Verwundbarkeitsdeterminanten
- 5.3.2 Verwundbarkeitsdeterminanten der Vegetation
- 5.3.3 Geomorphologische und bodenkundliche Verwundbarkeitsdeterminanten
- 5.4 Anthropogene Verwundbarkeitsdeterminanten
- 5.4.1 Demographische Verwundbarkeitsdeterminanten
- 5.4.2 Wirtschaftliche Verwundbarkeitsdeterminanten
- 5.4.3 Politische Verwundbarkeitsdeterminanten
- 5.4.4 Medizinische, gesundheitliche Verwundbarkeitsdeterminanten
- 5.5 Konflikte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bodendegradation als „schleichende Katastrophe“ (creeping disaster) und deren Auswirkungen auf die menschliche Sicherheit. Die Analyse verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse über die physischen Prozesse der Bodendegradation mit sozialgeographischen Aspekten der Vulnerabilität. Im Fokus steht die Verknüpfung von Umweltzerstörung und menschlichen Konflikten, anhand des Fallbeispiels Mali.
- Definition und Prozesse der Bodendegradation
- Ursachen der Bodendegradation (physisch und anthropogen)
- Folgen der Bodendegradation für Natur, Klima und Mensch
- Konzept der menschlichen Sicherheit und Vulnerabilität
- Fallstudie Mali: Desertifikation, Konflikte und menschliche Sicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert zwei gegensätzliche Perspektiven auf das Problem der Bodendegradation: die wissenschaftliche Warnung vor den Auswirkungen und die Erfahrung einer betroffenen Bevölkerung. Die Arbeit verspricht eine Analyse der physischen Prozesse und ihrer Folgen sowie eine Betrachtung der Problematik im Kontext menschlicher Sicherheit am Beispiel Malis.
2 Problemstellung: Dieses Kapitel beschreibt den Ackerbau als bedeutenden Schritt in der menschlichen Evolution und hebt die Abhängigkeit des Menschen vom Boden hervor. Es zeigt, wie die intensive Bodennutzung und der Klimawandel die Bodendegradation verstärken und eine „schleichende Naturgefahr“ für die Menschheit darstellen.
3 Creeping Disaster – Bodendegradation: Der Begriff „creeping disaster“ wird definiert und eingeordnet. Das Kapitel legt den Fokus auf die Definition von Boden und seinen Funktionen. Es beschreibt Bodendegradation als einen komplexen Prozess, der sowohl physische als auch anthropogene Ursachen hat und zu verschiedenen Prozessen (Erosion, physikalische und chemische Degradation) führt. Die weitreichenden Folgen für Natur, Klima und den Menschen, insbesondere die Gefährdung der Nahrungsmittelversorgung und die Auslösung von Migration, werden detailliert dargestellt.
4 Bodendegradation und Menschliche Sicherheit: Dieses Kapitel untersucht die Zusammenhänge zwischen Bodendegradation und menschlicher Sicherheit, definiert menschliche Sicherheit und analysiert das Konzept der menschlichen Vulnerabilität. Es betont den Zusammenhang zwischen Umweltgefahren und Konflikten.
5 Fallbeispiel Mali: Dieser Abschnitt liefert einen detaillierten Einblick in die Situation Malis, einschließlich der geografischen Gegebenheiten, der klimatischen Bedingungen, der Vegetation, und der Bodenbeschaffenheit. Er beschreibt die Desertifikation als fortgeschrittenes Stadium der Bodendegradation und analysiert die verschiedenen Faktoren, die zur menschlichen Vulnerabilität in Mali beitragen, wie z.B. demografische, wirtschaftliche, politische und medizinische Aspekte. Der Tuareg-Konflikt wird als Beispiel für die Folgen der Bodendegradation auf die menschliche Sicherheit in Mali dargelegt.
Schlüsselwörter
Bodendegradation, Desertifikation, menschliche Sicherheit, Vulnerabilität, Klimawandel, Erosion, Mali, anthropogene Ursachen, physische Ursachen, Nahrungsmittelsicherheit, Migration, Konflikte, Sahelzone.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Creeping Disaster – Bodendegradation und Menschliche Sicherheit in Mali
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bodendegradation als „schleichende Katastrophe“ (creeping disaster) und deren Auswirkungen auf die menschliche Sicherheit. Sie verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse über die physischen Prozesse der Bodendegradation mit sozialgeographischen Aspekten der Vulnerabilität und fokussiert die Verknüpfung von Umweltzerstörung und menschlichen Konflikten am Beispiel Mali.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Prozesse der Bodendegradation, ihre physischen und anthropogenen Ursachen, die Folgen für Natur, Klima und den Menschen. Weiterhin werden das Konzept der menschlichen Sicherheit und Vulnerabilität erläutert und eine Fallstudie zu Mali präsentiert, die Desertifikation, Konflikte und menschliche Sicherheit verbindet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Problemstellung, Bodendegradation (inkl. detaillierter Beschreibung der Prozesse und Folgen), Bodendegradation und Menschliche Sicherheit, sowie ein Fallbeispiel Mali. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung im Dokument.
Was versteht man unter „creeping disaster“ im Kontext der Arbeit?
„Creeping disaster“ beschreibt die schleichende, langsame und oft unbemerkte Natur der Bodendegradation. Im Gegensatz zu plötzlichen Katastrophen, wie Erdbeben, entwickelt sich die Bodendegradation allmählich, mit langfristigen und schwerwiegenden Folgen für Mensch und Umwelt.
Welche Ursachen für Bodendegradation werden genannt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen physischen Ursachen (z.B. Klimawandel, Erosion) und anthropogenen Ursachen (z.B. intensive Landwirtschaft, Überweidung). Ein komplexes Zusammenspiel beider Ursachen wird betont.
Welche Folgen hat Bodendegradation?
Die Folgen sind weitreichend und betreffen Natur und Klima (z.B. Verstärkung des Treibhauseffekts, Biodiversitätsverlust) sowie den Menschen (z.B. Gefährdung der Nahrungsmittelversorgung, Armut, Migration, Konflikte).
Was ist das Fallbeispiel Mali?
Mali dient als Fallbeispiel, um die Zusammenhänge zwischen Bodendegradation, Desertifikation, und menschlicher Sicherheit zu verdeutlichen. Die Analyse betrachtet klimatische, vegetationsbezogene, geomorphologische, demografische, wirtschaftliche, politische und medizinische Faktoren, die die Vulnerabilität der Bevölkerung verstärken und zu Konflikten beitragen.
Wie wird menschliche Sicherheit definiert?
Die Arbeit definiert menschliche Sicherheit im Kontext von Bedrohungen, die das Leben und die Lebensgrundlagen der Menschen gefährden. Bodendegradation wird als ein wichtiger Faktor für die Gefährdung der menschlichen Sicherheit angesehen.
Welche Rolle spielt die Vulnerabilität?
Vulnerabilität beschreibt die Anfälligkeit von Menschen und Gesellschaften gegenüber den negativen Folgen der Bodendegradation. Die Arbeit analysiert verschiedene Faktoren, die die Vulnerabilität erhöhen, wie z.B. Armut, politische Instabilität und mangelnde Ressourcen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bodendegradation, Desertifikation, menschliche Sicherheit, Vulnerabilität, Klimawandel, Erosion, Mali, anthropogene Ursachen, physische Ursachen, Nahrungsmittelsicherheit, Migration, Konflikte, Sahelzone.
- Quote paper
- Dr. phil. Kristina Bonn (Author), 2003, Bodendegradation und Umweltwandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116982