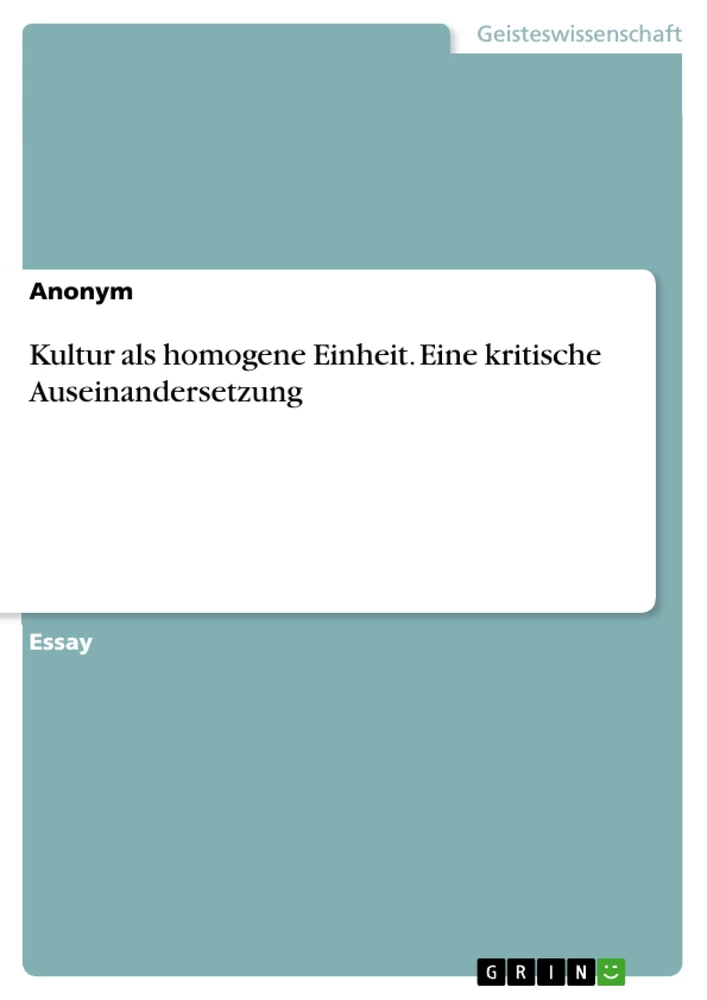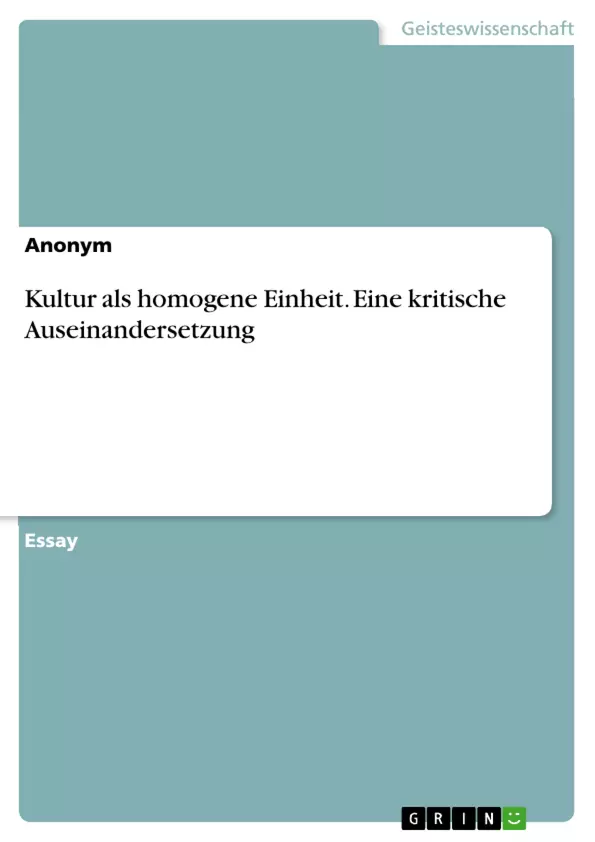Das Verständnis von Kultur als homogene Einheit ist bereits im 18. Jahrhundert aufgekommen, doch es ist bis heute Teil unserer Vorstellung von Kultur und beliebt im öffentlichen Diskurs. Der Ursprung des Verständnisses von Kultur als Einheit findet sich bei Samuel von Pufendorf, der Kultur erstmals als Generalbegriff verwendet und bei dem sie sich nicht mehr nur auf spezifische Tätigkeitsfelder bezieht.
Herder erkennt also, dass es verschiedene Kulturen gibt, die sich unterschiedlich entwickeln. Er kritisiert den Kolonialismus und das gewaltsame Eingreifen in die Entwicklung einer Kultur, da seiner Auffassung nach jede Kultur das Recht auf ihre eigene, freie Entwicklung hat. Dementsprechend könnte man Herder als Vordenker des Kulturrelativismus sehen. Für ihn ist die Vielfalt der Kulturen keineswegs negativ, weshalb er sich gegen eine Angleichung dieser ausspricht (Berlin 2009: 31). In dieser Hinsicht sind seine Ansätze äußerst progressiv, allerdings übersieht der Kulturbegriff nach Herder auch einige kulturelle Aspekte, auf die ich im Folgenden eingehen möchte. Die Fragestellung, die ich zu beantworten versuche, ist, welche zentralen Merkmale des klassischen Kulturbegriffes problematisch für die Vorstellung von Kultur sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wesen der Kultur
- Die „drei Momente“
- Die „ethnische Fundierung“
- Die,,soziale Homogenisierung“
- Die „interkulturelle Abgrenzung“
- Das Eigene und das Fremde
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text setzt sich kritisch mit der Vorstellung von Kultur als homogener Einheit auseinander, die sich im 18. Jahrhundert entwickelt hat und bis heute im öffentlichen Diskurs präsent ist. Die Arbeit analysiert die problematischen Aspekte dieses klassischen Kulturbegriffs, indem sie die zentralen Merkmale und ihre Auswirkungen beleuchtet.
- Der Volksgeist als Kern einer Kultur: Der Text untersucht die Vorstellung vom Volksgeist, der als unveränderliches Wesensmerkmal einer Kultur angesehen wird und die Entwicklung und den Wandel der Kultur nicht erklären kann.
- Die „drei Momente“ der kulturellen Homogenisierung: Die Arbeit analysiert die „ethnische Fundierung“, „soziale Homogenisierung“ und „interkulturelle Abgrenzung“ als zentrale Elemente des klassischen Kulturbegriffs, die zur Vereinheitlichung und Abgrenzung von Kulturen führen.
- Die Konstruktion des Fremden: Die Arbeit hinterfragt die Vorstellung einer klaren Unterscheidung von Eigenem und Fremden, die durch die Annahme einer homogenen Kultur entsteht und zu einer künstlichen Abgrenzung führt.
- Imaginierte Gemeinschaften: Die Arbeit beleuchtet die Konstruktion von Nationalstaaten und Traditionen, die auf der Vorstellung einer homogenen Kultur basieren und die Grenzen zwischen „Eigenem“ und „Fremden“ verschwimmen lassen.
- Kulturelle Diversität und Wandel: Der Text hebt die Bedeutung von kultureller Diversität und Wandel hervor, die im klassischen Kulturbegriff vernachlässigt werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik des klassischen Kulturbegriffs als homogener Einheit dar, der seine Wurzeln im 18. Jahrhundert hat. Der Text zeigt, wie dieser Kulturbegriff bis heute die öffentliche Diskussion beeinflusst und durch seine statische und homogenisierende Sichtweise den Wandel und die Vielfalt von Kulturen ignoriert.
Das Wesen der Kultur
Dieses Kapitel untersucht den Gedanken des Volksgeistes, der als Kern einer Kultur angesehen wird und sie von anderen unterscheidet. Der Text kritisiert die statische Auffassung des Volksgeistes, die den kulturellen Wandel nicht erklären kann und die Rolle des individuellen Handelns und der subkulturellen Vielfalt vernachlässigt.
Die „drei Momente“
Dieses Kapitel beschreibt die drei „Momente“ des klassischen Kulturbegriffs: „ethnische Fundierung“, „soziale Homogenisierung“ und „interkulturelle Abgrenzung“. Der Text zeigt, wie diese Momente zur Homogenisierung von Kulturen beitragen und die Vielfalt innerhalb und zwischen Kulturen ignorieren. Die Arbeit analysiert die problematische Vorstellung einer ethnisch homogenen Kultur, die durch den Begriff der „Reinheit“ gekennzeichnet ist und zur Legitimation rassistischer Ideologien verwendet wird.
Das Eigene und das Fremde
Dieses Kapitel untersucht die künstliche Trennung von „Eigenem“ und „Fremden“, die aus der Annahme einer homogenen Kultur entsteht. Der Text argumentiert, dass die Grenzen zwischen Innen und Außen, zwischen eigen und fremd, nicht eindeutig definierbar sind und dass das Fremde bereits innerhalb einer Kultur vorhanden ist. Der Text befasst sich mit verschiedenen Ansätzen, die die Konstruktion des Fremden aufzeigen, wie etwa Zygmunt Baumans „Making and Unmaking of Strangers“ und Benedict Andersons „Imagined Communities“.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit zentralen Begriffen und Konzepten wie Kultur, Volksgeist, Homogenisierung, Abgrenzung, Diversität, Fremdheit, Tradition, Nationalstaat, Kulturrelativismus, rassistische Ideologien, und Imaginierte Gemeinschaften.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Kultur als homogene Einheit. Eine kritische Auseinandersetzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169276