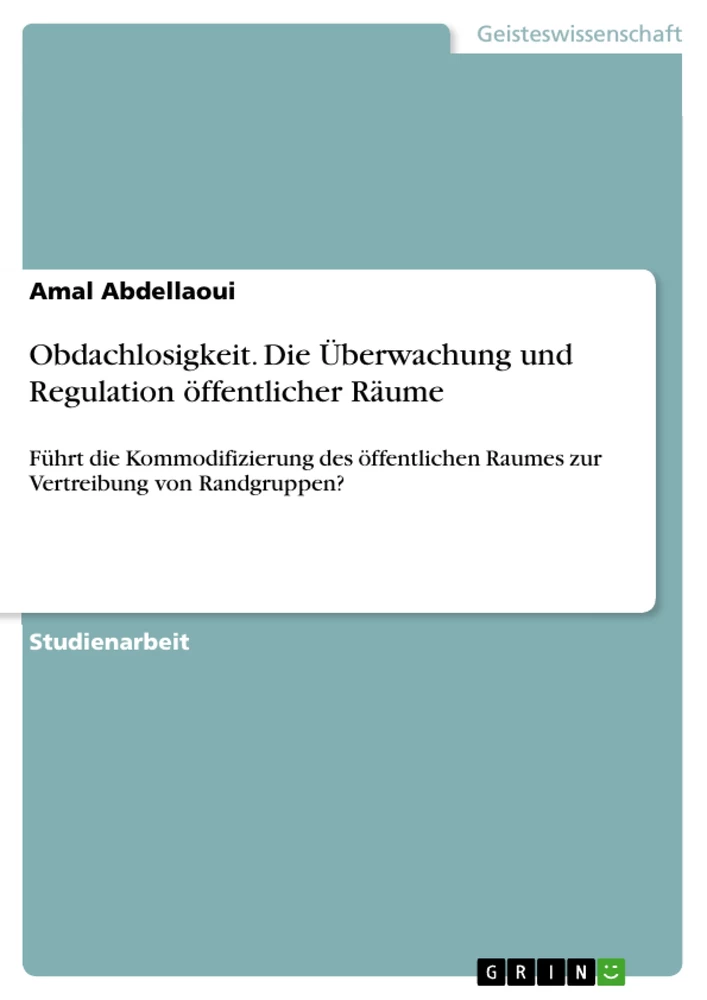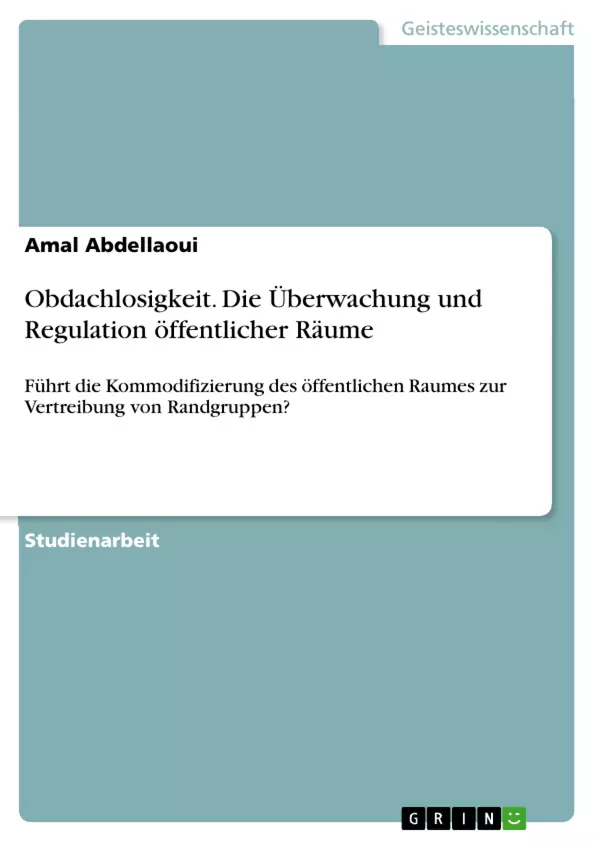Diese Arbeit wird sich mit der Kommodifizierung öffentlicher Räume und die daraus resultierende Verdrängung der Randgruppen beschäftigen. Des Weiteren wird mit Hilfe von J. Wehrheims Buch „Die überwachte Stadt: Sicherheit, Segregation und Ausgrenzung“ die Forschungsfrage beantwortet, inwiefern die Kommodifizierung des öffentlichen Raumes, zur Vertreibung von Obdachlosen/ Randgruppen führt und welche Maßnahmen und Umstrukturierungen dazu verwendet werden?
Allein im Jahr 2016 gab es in Deutschland, 458.000 Obdachlose und davon 436.000 Flüchtlinge. Diese Zahlen sind erschreckend. Betrachtet man dann, dass diese Menschen so gut wie keinen Zufluchtsort haben, wird das zu einem ernüchternden Gedanken. Dadurch, dass Obdachlose über keinen privaten Rückzugsort verfügen, sind sie deshalb auf die Straße und die dortige Infrastruktur angewiesen. Leider wird selbst das für sie zum Hindernis gemacht. Selbst aus gewohnten öffentlichen Räumen, in denen sie sich niederlassen und aufhalten konnten, werden Gebiete, in denen sie nicht mehr gerne gesehen werden oder gar vertrieben werden. Was die Frage aufwirft wie dies denn möglich sein kann? Sind öffentliche Räume nicht für jeden und können sich dort nicht alle aufhalten? Eine Umstrukturierung der öffentlichen Räume, die im Zuge der Globalisierung immer populärer wird, bedeutet oftmals für Randgruppen eine Ausgrenzung, da sie nicht in das Image, welches durch die Umstrukturierung vermittelt werden möchte, passen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinition
- 2.1. Obdachlosigkeit
- 2.2. Der öffentliche Raum
- 3. Kommodifizierung des öffentlichen Raumes
- 3.1. Ebenen der Kommodifizierung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Kommodifizierung öffentlicher Räume und der daraus resultierenden Verdrängung von Randgruppen. Unter Verwendung von J. Wehrheims Buch "Die überwachte Stadt: Sicherheit, Segregation und Ausgrenzung" wird die Forschungsfrage beantwortet, inwiefern die Kommodifizierung des öffentlichen Raumes zur Vertreibung von Obdachlosen/Randgruppen führt und welche Maßnahmen und Umstrukturierungen dazu verwendet werden.
- Kommodifizierung des öffentlichen Raumes
- Verdrängung von Randgruppen
- Obdachlosigkeit und öffentlicher Raum
- Überwachungsmaßnahmen und Segregation
- Ausgrenzung und die "unternehmerische Stadt"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Obdachlosigkeit und die Problematik der Verdrängung aus öffentlichen Räumen ein. Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Situation von Obdachlosen in Deutschland und stellt die Frage, wie es dazu kommt, dass ihnen der Zugang zu öffentlichen Räumen verwehrt wird.
2. Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Obdachlosigkeit und öffentlicher Raum. Es wird auf die Unterschiede zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit eingegangen und die Bedeutung des öffentlichen Raumes für Obdachlose hervorgehoben.
3. Kommodifizierung des öffentlichen Raumes: Dieses Kapitel analysiert die Kommodifizierung öffentlicher Räume und ihre Auswirkungen auf Randgruppen. Die Arbeit zeigt auf, wie die Ökonomisierung öffentlicher Räume zur Verdrängung von Obdachlosen und anderen Randgruppen führt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Obdachlosigkeit, öffentlicher Raum, Kommodifizierung, Verdrängung, Überwachung, Segregation, Ausgrenzung, "unternehmerische Stadt", Sicherheit und Randgruppen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Kommodifizierung öffentlicher Räume?
Unter Kommodifizierung versteht man die Ökonomisierung und Privatisierung öffentlicher Räume, die dazu führt, dass diese nach wirtschaftlichen Kriterien umgestaltet werden, was oft zur Verdrängung von Randgruppen führt.
Welche Rolle spielt J. Wehrheims Buch in dieser Arbeit?
Das Buch „Die überwachte Stadt: Sicherheit, Segregation und Ausgrenzung“ dient als Grundlage, um zu untersuchen, wie Überwachung und Umstrukturierung zur Vertreibung von Obdachlosen beitragen.
Warum sind Obdachlose besonders von der Umgestaltung öffentlicher Räume betroffen?
Da Obdachlose über keinen privaten Rückzugsort verfügen, sind sie auf die Straße und die öffentliche Infrastruktur angewiesen. Jede Einschränkung dieses Raumes entzieht ihnen lebensnotwendige Aufenthaltsorte.
Was ist das Ziel der "unternehmerischen Stadt" in Bezug auf das Stadtimage?
Die unternehmerische Stadt strebt ein sauberes und attraktives Image für Investoren und Touristen an, in das Randgruppen wie Obdachlose oft nicht passen und daher ausgegrenzt werden.
Wie viele Obdachlose gab es laut der Arbeit im Jahr 2016 in Deutschland?
Im Jahr 2016 gab es in Deutschland etwa 458.000 Obdachlose, wovon ein großer Teil (436.000) Flüchtlinge waren.
Was ist der Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit?
Die Arbeit definiert diese Begriffe im zweiten Kapitel genauer, wobei Obdachlosigkeit oft das Fehlen jeglicher fester Unterkunft beschreibt, während Wohnungslosigkeit auch das Fehlen eines eigenen Mietvertrags umfassen kann.
- Quote paper
- Amal Abdellaoui (Author), 2020, Obdachlosigkeit. Die Überwachung und Regulation öffentlicher Räume, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1168959