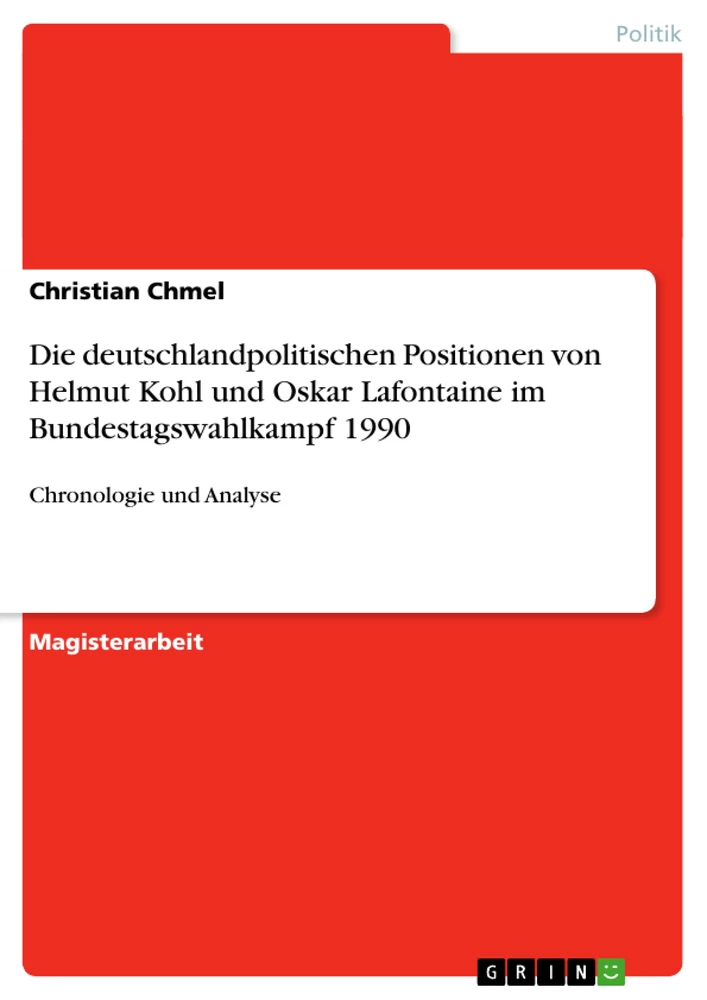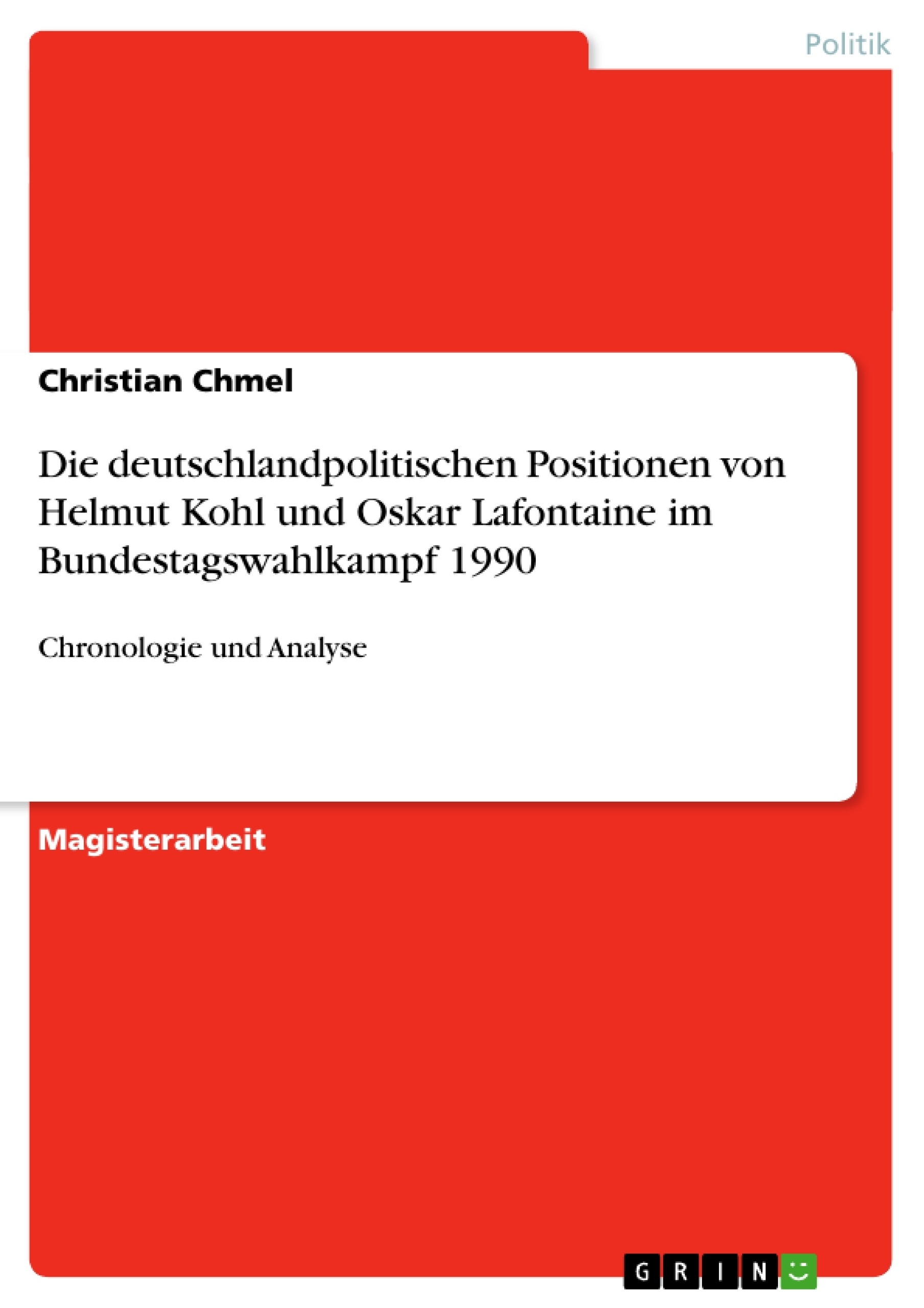Der Bundestagswahlkampf 1990 stand im Zeichen der politischen Wende in Mittel- und Osteuropa und des daraus resultierenden deutschen Vereinigungsprozesses. Deutschlandpolitik rangierte spätestens mit dem Mauerfall am 9. November 1989 ganz oben auf der politischen Agenda der Bundesrepublik. Die Kanzlerkandidaten im „Einheitswahlkampf“, Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und Herausforderer Oskar Lafontaine (SPD), hatten sich angesichts dessen mit – gesamtdeutschen – Fragen auseinanderzusetzen, für deren Beantwortung keine Patentrezepte existierten: die Bewältigung des Übersiedlerstroms aus der DDR, das Verhältnis zu den politischen Gruppierungen in Ostdeutschland, die Einführung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, die staatsrechtliche Gestaltung der Einheit (Artikel 23 oder 146?), die Bündniszugehörigkeit eines wiedervereinigten Deutschlands, und auch die endgültige Anerkennung der polnischen Westgrenze wurde wieder diskutiert – dabei immer auch begleitet von taktischen Überlegungen hinsichtlich des für die Kontrahenten jeweils günstigeren Termins für die – bereits gesamtdeutschen – Bundestagswahlen. Ganz eindeutig wurde die politische Debatte in Parteien, Publizistik und innerhalb der Bevölkerung im Jahr 1990 dominiert von Vorschlägen und Planungen im Kontext der Vereinigung beider deutscher Staaten.
Dementsprechend wurden die deutschlandpolitischen Positionen (und Grundüberzeugungen) der Kandidaten Kohl und Lafontaine zum Leitmotiv ihrer Wahlkampfstrategien und entscheidenden Faktor für den Ausgang der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990. In der „Chronologie und Analyse“ des Einheitswahlkampfs stehen daher folgende Fragen im Vordergrund: Waren die Positionen der Kanzlerkandidaten in der jeweils eigenen Partei konsensfähig oder Auslöser für Kontroversen? Hatten die DDR-Volkskammerwahl sowie die diversen Landtagswahlen in alten und neuen Bundesländern im Verlauf des Jahres 1990 bereits den Charakter von Abstimmungen über die deutschlandpolitischen Alternativen auf Bundesebene? Wie wurden die Wahlkampfstrategien von Kohl und Lafontaine in den publizistischen Leitmedien beurteilt? Und schließlich: Wie haben sich die Zustimmungswerte zu den Kandidaten und ihren Positionen in den Umfragen maßgeblicher Meinungsforschungsinstitute entwickelt?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Chronologie und Analyse
- 1. Kohl und die Frage der polnischen Westgrenze
- 2. Lafontaines Kanzlerkandidatur und die Deutschlandpolitik I
- 3. Kohl, Gorbatschow und die deutsche Einigung I
- 4. Lafontaines Kanzlerkandidatur und die Deutschlandpolitik II
- 5. Volkskammerwahl in der DDR
- 6. Medienurteile und Demoskopie im Einheitswahlkampf I
- 7. Kohl, Lafontaine und die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
- 8. Lafontaines Kanzlerkandidatur und die Deutschlandpolitik III
- 9. Medienurteile und Demoskopie im Einheitswahlkampf II
- 10. Kohl, Gorbatschow und die deutsche Einigung II
- 11. Beitritt der DDR
- 12. Der 2+4-Vertrag
- 13. Lafontaine und der Vereinigungsparteitag der Sozialdemokratie
- 14. Medienurteile und Demoskopie im Einheitswahlkampf III
- 15. Wiedervereinigung Deutschlands
- 16. Landtagswahlen in den fünf neuen Bundesländern
- 17. Einheitskanzler Kohl im Wahlkampf
- 18. Einheitsskeptiker Lafontaine im Wahlkampf
- 19. Medienurteile und Demoskopie im Einheitswahlkampf IV
- 20. Bundestagswahlen im wiedervereinigten Deutschland
- III. Schlußbetrachtung
- IV. Literatur & Quellen (-sammlungen)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert die deutschlandpolitischen Positionen von Helmut Kohl und Oskar Lafontaine im Bundestagswahlkampf 1990. Sie untersucht, wie ihre Positionen die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl beeinflussten, und beleuchtet die Resonanz ihrer Ansätze in der Presse und in Meinungsumfragen.
- Die Rolle der deutschlandpolitischen Positionen von Kohl und Lafontaine im Bundestagswahlkampf 1990.
- Die Auswirkungen der Volkskammerwahl in der DDR und der Landtagswahlen in Ost- und Westdeutschland auf die deutschlandpolitische Strategie der Kandidaten.
- Die mediale Berichterstattung und die öffentliche Meinung im Einheitswahlkampf.
- Die Entwicklung der Zustimmungswerte für die Kandidaten und ihre Positionen in Meinungsumfragen.
- Die Frage der Konsensfähigkeit der deutschlandpolitischen Positionen innerhalb der jeweiligen Parteien.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Analyse der Positionen von Helmut Kohl zur polnischen Westgrenze. Es wird gezeigt, wie er sich mit der Frage der Vertriebenenforderungen auseinandersetzen musste und wie er versuchte, das nationalkonservative Wählerpotential zu binden, ohne dabei die Realität der deutschen Einheit zu ignorieren.
Anschließend werden die deutschlandpolitischen Positionen von Oskar Lafontaine im Bundestagswahlkampf 1990 beleuchtet. Die Analyse konzentriert sich auf die Herausforderungen, die sich aus der deutschen Einheit für die Sozialdemokratie ergaben, und auf Lafontaines Rolle als Kanzlerkandidat.
Die Arbeit untersucht auch die Rolle von Gorbatschow im Einigungsprozess und die Reaktion der Medien und der öffentlichen Meinung auf die politischen Entscheidungen und Positionen von Kohl und Lafontaine. Die Analyse umfasst die Einführung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, die Volkskammerwahl in der DDR und die Landtagswahlen in den neuen Bundesländern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Deutschlandpolitik, deutsche Einheit, Bundestagswahlkampf 1990, Helmut Kohl, Oskar Lafontaine, Medienberichterstattung, Meinungsumfragen, Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, Vertriebenenfrage, polnische Westgrenze, Gorbatschow.
- Quote paper
- Christian Chmel (Author), 2000, Die deutschlandpolitischen Positionen von Helmut Kohl und Oskar Lafontaine im Bundestagswahlkampf 1990, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116842