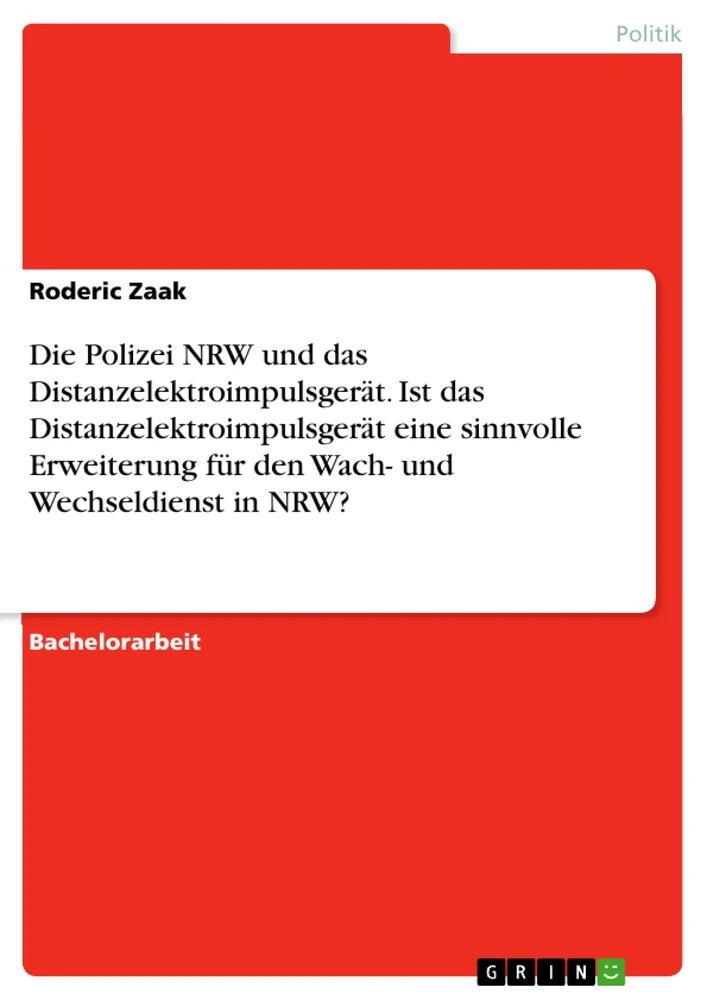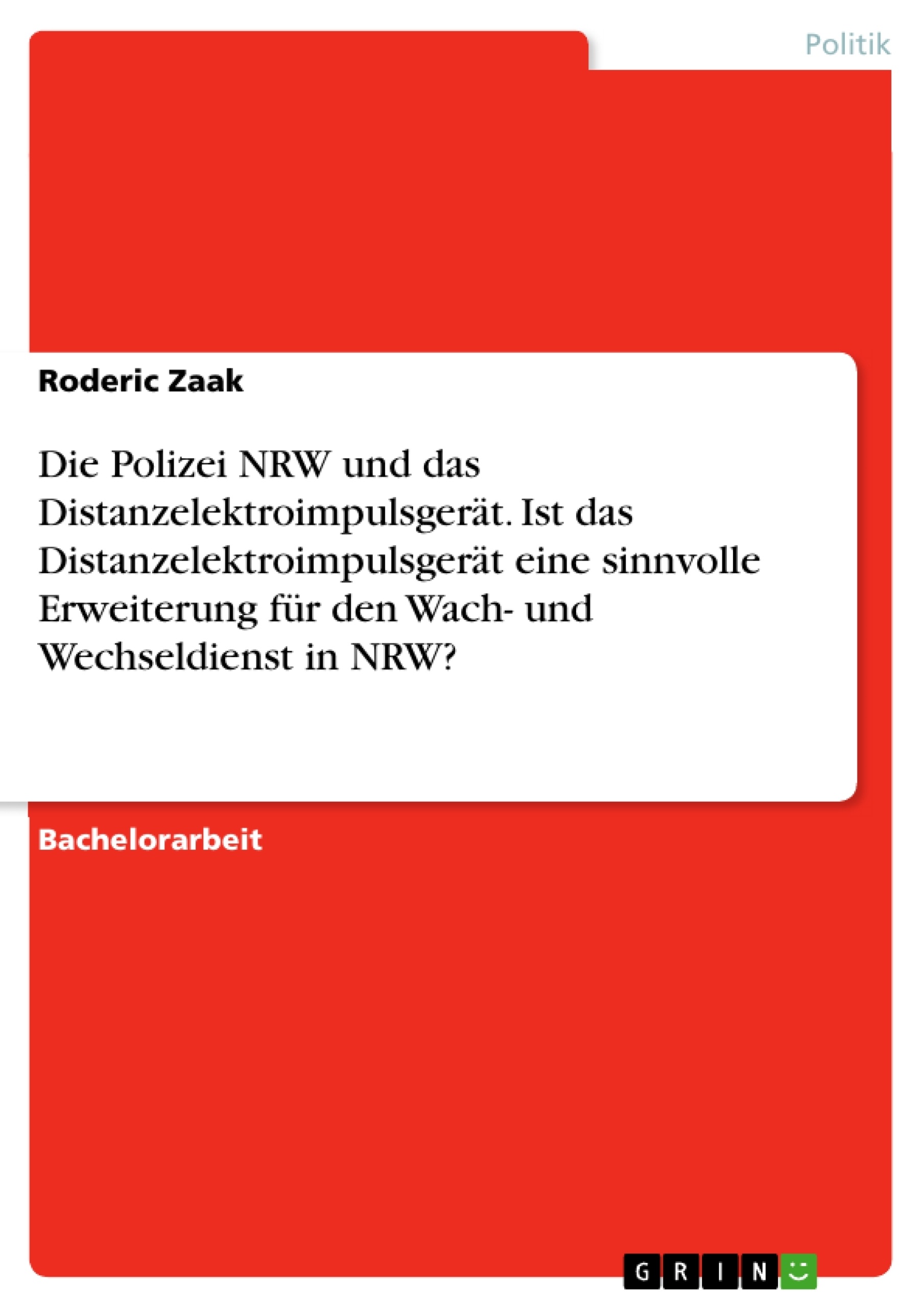Einer der grundlegenden Polizeidienste ist der Wach- und Wechseldienst (W.u.Wd.); er wird auch oft als "Streifendienst" bezeichnet. Der W.u.Wd. ist in vielen Situationen der erste Ansprechpartner für Bürger vor Ort und startet meistens auch die ersten Maßnahmen bei Einsätzen. Die Kernaufgaben liegen darin, Gefahren abzuwehren und Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen.
Zur Bewältigung dieser Aufgaben stehen den Beamten verschiedene Führungs- und Einsatzmittel zur Verfügung (FEM). Bereits in den letzten Jahren hat die Polizei NRW die FEM für den W.u.Wd. aufgebessert. Unter anderem wurde der viel zu klein empfundene Streifenwagen BMW 318 Touring durch den Ford S-Max und Mercedes Vito ersetzt. Es wurde aber auch in Sachen Einsatzausstattung aufgebessert. So wurden Außentrage-hüllen für die Schutzweste, Diensthandys, Zielfernrohre für die Maschinenpistole und Bodycams angeschafft. Derzeit überlegt das Land NRW aber auch Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG), welche auch "Taser" genannt werden, für den W.u.Wd. einzuführen. Mit der Einführung von DEIG erhofft man sich, eine vorhandene Lücke zwischen körperlicher Gewalt und dem Schusswaffengebrauch im W.u.Wd. zu schließen.
Es ergibt sich die Frage, ob das Distanzelektroimpulsgerät eine für den Wach- und Wechseldienst in NRW eine sinnvolle Erweiterung darstellen würde. Im Zuge der Ausarbeitung soll offengelegt wer-den, inwieweit sich das DEIG als für die Praxis anwendbare Waffe darstellt und das Potenzial birgt, Einsatzabläufe zu verbessern und sicherer zu gestalten. Hierbei soll folgende Hypothese als Leitfaden für die Arbeit dienen: "Der Einsatz des DEIG steigert die Sicherheit und Qualität von Einsatzabläufen des Wach- und Wechseldienstes."
Methodologisch werden sekundär empirische Daten aus fachbezogenen Quellen herangezogen. Das methodische Vorgehen umfasst zunächst eine Bedarfsanalyse, eine rechtliche Beurteilung und Vergleiche mit den derzeitigen FEM. Im Anschluss werden zudem Erfahrungsberichte ausgewertet und Argumente von Kritikern beziehungsweise Befürwortern aufgeführt. Zum Abschluss der Arbeit wird ein Bezug zur aufgestellten Hypothese hergestellt, welche in diesem Zuge
verifiziert beziehungsweise falsifiziert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die alltägliche Gefahr im Wach- und Wechseldienst
- 2.1 Der Fall „Neptunbrunnen“
- 3 Definition und Funktionsweise eines DEIG
- 3.1 Aufbau und Funktion „Taser 7“
- 3.2 Distanz- und Kontaktmodus
- 4 Waffenrechtliche Einordnung des Taser 7
- 4.1 Gutachterliche Prüfung des Zwangsmittels DEIG
- 4.1.1 Rechtmäßigkeit der Grundmaßnahme
- 4.1.2 Ermächtigungsgrundlage
- 4.1.3 Förmliche Rechtmäßigkeit
- 4.1.4 Materielle Rechtmäßigkeit
- 4.1.5 Zwangsmittel
- 4.1.6 Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
- 4.1.7 Verhältnismäßigkeit
- 4.1.8 Ergebnis der Prüfung
- 4.1 Gutachterliche Prüfung des Zwangsmittels DEIG
- 6 Der Praxiseinsatz
- 6.1 Die USA
- 6.2 Das Beispiel Rheinland-Pfalz
- 6.3 Das Pilotprojekt NRW
- 7 Die „Alternativen“ im Vergleich
- 7.1 Körperliche Gewalt
- 7.2 Reizstoffsprühgerät (RSG)
- 7.3 Einsatzmehrzweckstock (EMS-A)
- 7.4 Schusswaffe (P99)
- 8 Argumente der Kritiker
- 8.1 Das Gesundheitsrisiko
- 8.2 Missbrauch durch Polizeibeamte
- 8.3 Das „Fallen“
- 9 Argumente der Befürworter
- 9.1 Gefährdung der Polizeibeamten im Einsatz wird vermindert
- 9.2 Erweiterung des Auswahlspektrums
- 9.3 Positive Erfahrungen des Nachbarlandes und des SEK
- 10 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis untersucht die Sinnhaftigkeit des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) als Erweiterung der Ausrüstung im Wach- und Wechseldienst der Polizei NRW. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, den Praxiseinsatz in anderen Ländern und Pilotprojekten sowie die Argumente von Befürwortern und Kritikern.
- Rechtliche Einordnung des DEIG
- Vergleich des DEIG mit anderen Zwangsmitteln
- Auswertung von Praxiserfahrungen im In- und Ausland
- Bewertung der Risiken und Vorteile des DEIG-Einsatzes
- Abschätzung der Auswirkungen auf die Sicherheit von Polizeibeamten und Bürgern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Bachelorthesis ein und stellt die Forschungsfrage nach der Sinnhaftigkeit des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) im Wach- und Wechseldienst der Polizei NRW. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit und die methodische Vorgehensweise.
2 Die alltägliche Gefahr im Wach- und Wechseldienst: Dieses Kapitel beschreibt die alltäglichen Gefahren, denen Polizeibeamte im Wach- und Wechseldienst ausgesetzt sind. Es wird der „Fall Neptunbrunnen“ als Beispiel für eine gefährliche Situation herangezogen, um die Notwendigkeit von effektiven und verhältnismäßigen Zwangsmitteln zu verdeutlichen. Die Schilderung dieser Ereignisse dient als Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung des DEIG.
3 Definition und Funktionsweise eines DEIG: Dieses Kapitel definiert das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) und beschreibt detailliert dessen Funktionsweise, insbesondere am Beispiel des „Taser 7“. Es werden Aufbau und Funktion des Geräts erklärt, der Unterschied zwischen Distanz- und Kontaktmodus erläutert und die technischen Aspekte des Einsatzes dargestellt. Diese detaillierte Beschreibung bildet die Grundlage für das Verständnis der weiteren Kapitel.
4 Waffenrechtliche Einordnung des Taser 7: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der rechtlichen Einordnung des Taser 7 als Zwangsmittel. Eine gutachterliche Prüfung beleuchtet die Rechtmäßigkeit der Grundmaßnahme, die Ermächtigungsgrundlage, die formelle und materielle Rechtmäßigkeit, die Verhältnismäßigkeit und weitere relevante Aspekte. Die Ergebnisse dieser Prüfung sind zentral für die Bewertung der Sinnhaftigkeit des DEIG-Einsatzes.
6 Der Praxiseinsatz: Dieses Kapitel analysiert den Praxiseinsatz des DEIG, unterteilt in Erfahrungen aus den USA, Rheinland-Pfalz und dem Pilotprojekt in NRW. Es werden unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven in Bezug auf den Einsatz, die Effektivität und die Risiken des DEIGs dargestellt. Die verschiedenen nationalen und regionalen Erfahrungen bieten einen umfassenden Einblick in die praktische Anwendung und die damit verbundenen Herausforderungen.
7 Die „Alternativen“ im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht das DEIG mit anderen im Wach- und Wechseldienst verfügbaren Zwangsmitteln, wie körperlicher Gewalt, Reizstoffsprühgeräten, Einsatzmehrzweckstöcken und Schusswaffen. Der Vergleich dient dazu, die Vor- und Nachteile des DEIGs im Kontext anderer Möglichkeiten der Deeskalation und Gewaltanwendung zu beleuchten und seine Position im Spektrum der Zwangsmittel zu bestimmen.
8 Argumente der Kritiker: Dieses Kapitel präsentiert die Argumente der Kritiker des DEIG-Einsatzes. Es werden Bedenken hinsichtlich des Gesundheitsrisikos, des Missbrauchs durch Polizeibeamte und der Gefahr des „Fallens“ detailliert erläutert und diskutiert. Die kritischen Punkte liefern wichtige Aspekte für eine umfassende Bewertung der Sinnhaftigkeit des DEIG.
9 Argumente der Befürworter: Dieses Kapitel stellt die Argumente der Befürworter des DEIG-Einsatzes dar. Es werden positive Auswirkungen auf die Sicherheit der Polizeibeamten, die Erweiterung des Auswahlspektrums an Zwangsmitteln und die positiven Erfahrungen in anderen Ländern und beim SEK hervorgehoben. Die Gegenüberstellung der Argumente von Befürwortern und Kritikern ermöglicht eine differenzierte Betrachtung des Themas.
Schlüsselwörter
Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), Taser 7, Wach- und Wechseldienst, Polizei NRW, Zwangsmittel, Waffenrecht, Verhältnismäßigkeit, Deeskalation, Gesundheitsrisiko, Missbrauch, Praxiseinsatz, Pilotprojekt, Alternativen, Sicherheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorthesis: Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) im Wach- und Wechseldienst der Polizei NRW
Was ist das Thema der Bachelorthesis?
Die Bachelorthesis untersucht die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG), insbesondere des Tasers 7, im Wach- und Wechseldienst der Polizei in Nordrhein-Westfalen (NRW).
Welche Aspekte werden in der Thesis behandelt?
Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von DEIGs, vergleicht sie mit anderen Zwangsmitteln, bewertet die Risiken und Vorteile, untersucht Praxiserfahrungen im In- und Ausland (USA, Rheinland-Pfalz, Pilotprojekt NRW) und berücksichtigt die Argumente von Befürwortern und Kritikern.
Wie ist die Thesis aufgebaut?
Die Thesis umfasst Kapitel zur Einleitung, den alltäglichen Gefahren im Wach- und Wechseldienst (am Beispiel des „Falls Neptunbrunnen“), der Definition und Funktionsweise von DEIGs (fokussiert auf den Taser 7), der waffenrechtlichen Einordnung des Tasers 7 (inklusive einer gutachterlichen Prüfung), dem Praxiseinsatz in verschiedenen Regionen, dem Vergleich mit alternativen Zwangsmitteln (körperliche Gewalt, Reizstoffsprühgerät, Einsatzmehrzweckstock, Schusswaffe), den Argumenten der Kritiker (Gesundheitsrisiko, Missbrauch, „Fallen“) und den Argumenten der Befürworter (verminderte Gefährdung von Beamten, erweitertes Auswahlspektrum, positive Erfahrungen im Ausland und beim SEK), sowie einem abschließenden Fazit.
Welche rechtlichen Aspekte werden untersucht?
Die rechtliche Einordnung des Taser 7 als Zwangsmittel wird detailliert geprüft. Die Analyse umfasst die Rechtmäßigkeit der Grundmaßnahme, die Ermächtigungsgrundlage, die formelle und materielle Rechtmäßigkeit, die Verhältnismäßigkeit und besondere Form- und Verfahrensvorschriften.
Welche Alternativen zum DEIG werden betrachtet?
Die Thesis vergleicht den Taser 7 mit körperlicher Gewalt, Reizstoffsprühgeräten, Einsatzmehrzweckstöcken und Schusswaffen, um die Vor- und Nachteile im Kontext anderer Deeskalations- und Gewaltanwendungsmöglichkeiten zu beleuchten.
Welche Argumente bringen Kritiker des DEIG-Einsatzes vor?
Kritiker äußern Bedenken hinsichtlich des Gesundheitsrisikos, des potenziellen Missbrauchs durch Polizeibeamte und der Gefahr des „Fallens“ (des Opfers).
Welche Argumente bringen Befürworter des DEIG-Einsatzes vor?
Befürworter betonen die verbesserte Sicherheit für Polizeibeamte, die Erweiterung des Auswahlspektrums an Zwangsmitteln und positive Erfahrungen aus dem Ausland und dem SEK.
Wo wurden Praxiserfahrungen untersucht?
Die Thesis analysiert Praxiserfahrungen aus den USA, Rheinland-Pfalz und dem Pilotprojekt in NRW.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Thesis?
Schlüsselwörter sind: Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), Taser 7, Wach- und Wechseldienst, Polizei NRW, Zwangsmittel, Waffenrecht, Verhältnismäßigkeit, Deeskalation, Gesundheitsrisiko, Missbrauch, Praxiseinsatz, Pilotprojekt, Alternativen, Sicherheit.
Welche Forschungsfrage wird in der Thesis beantwortet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ist der Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG) eine sinnvolle Erweiterung der Ausrüstung im Wach- und Wechseldienst der Polizei NRW?
- Quote paper
- Roderic Zaak (Author), 2021, Die Polizei NRW und das Distanzelektroimpulsgerät. Ist das Distanzelektroimpulsgerät eine sinnvolle Erweiterung für den Wach- und Wechseldienst in NRW?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1168411