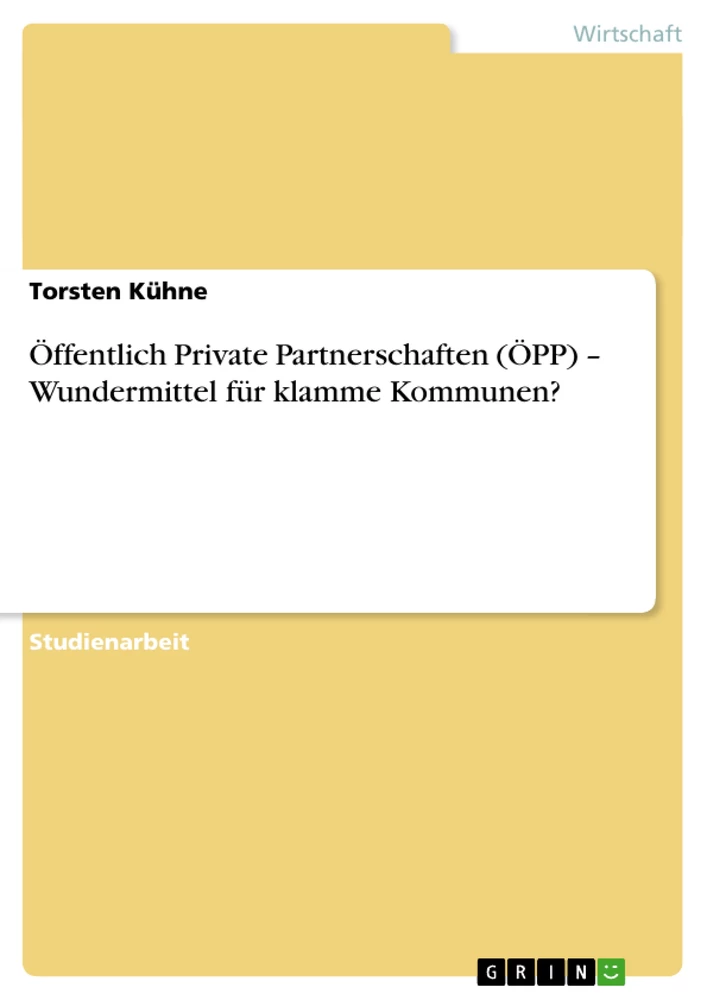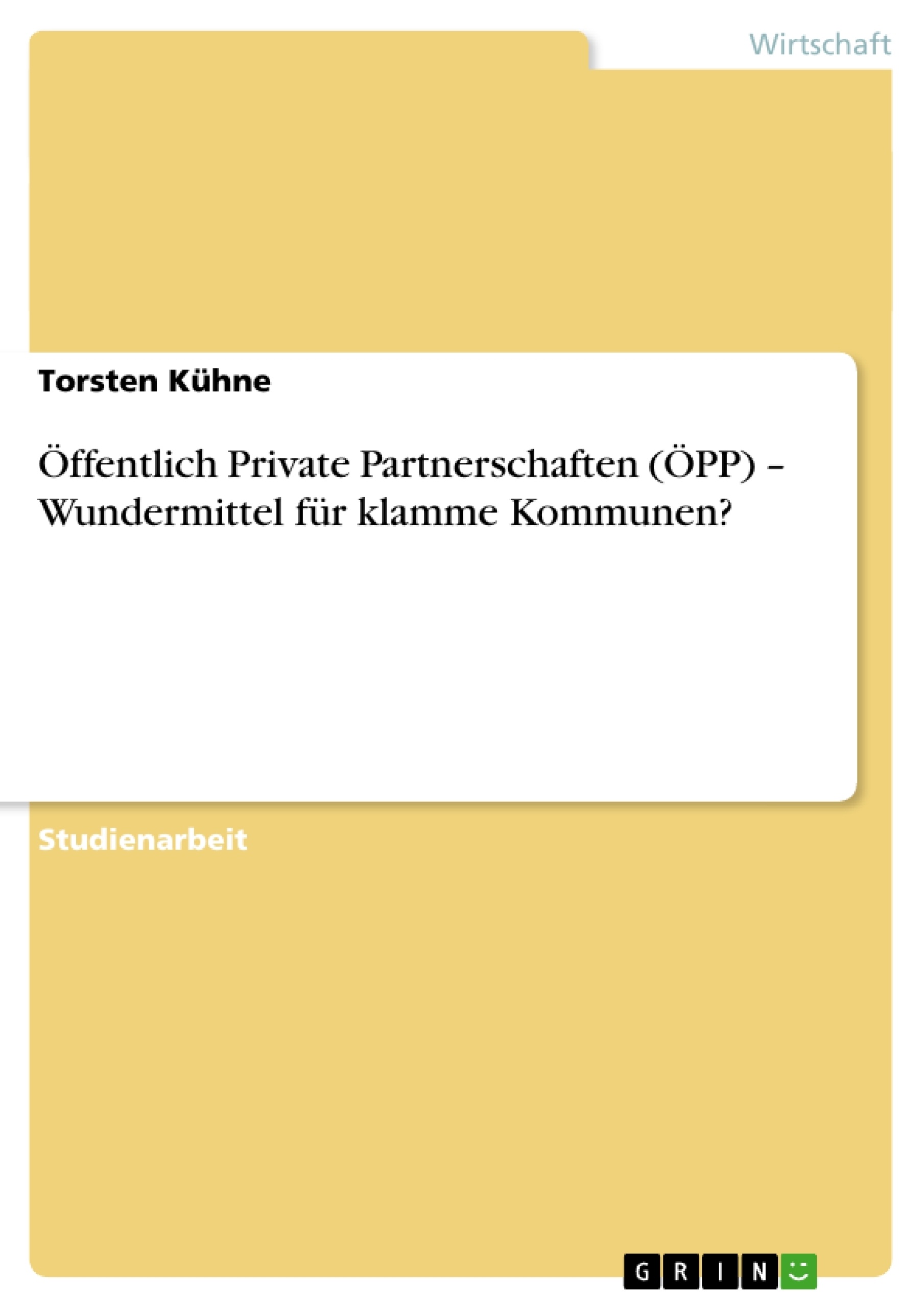Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Öffentlich Privaten Partnerschaften, mit dem Ziel Informationen aus verschiedener Perspektive zusammen zutragen, um eine Übersicht über das Thema zu erhalten und die Frage zu beantworten, ob Öffentlich Private Partnerschaften die Rettung für finanzschwache Kommunen sind, wenn es darum geht, die öffentlichen Aufgaben trotz leerer Kassen wahr zu nehmen.
Dafür werden Texte aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachrichtungen sowie graue Literatur ausgewertet und die angeführten Argumente einander gegenübergestellt. Der Aufbau der Arbeit möchte auch dem mit der Materie nicht vertrauten Leser einen guten Einstieg in das Thema ermöglichen. Deshalb wird im ersten Teil des Textes eine Begriffsklärung vorgenommen, um Klarzustellen um was es sich bei einer Öffentlich Privaten Partnerschaft handelt, welche Konstellationen sich hinter dem Begriff verbergen und wer die dabei handelnden Akteure sind. Zudem werden die verschiedenen Modelle, die als „tool box“ für eine Privat Public Partnership zur Verfügung stehen, mit ihren Unterschieden vorgestellt und graphisch veranschaulicht.
Die Faktoren, die eine Öffentlich Private Partnerschaft begünstigen, und zu einem Anwachsen derselben in der Bundesrepublik geführt haben sowie die positivern Effekte einer solchen Partnerschaft werden in Kapitel 4 dargelegt. Darauf aufbauend werden im Abschnitt „Chancen und Risiken“ die Chancen, welche eine Öffentlich Private Partnerschaft für die Beteiligten bietet, den Risiken und Gefahren für eine Kommune beim Abschluss einer solchen Kooperation entgegen gestellt. Hierbei werden die Probleme, die im Vorfeld, während der Projektphase, sowie nach Ende der Vertragslaufzeit auftreten können, näher spezifiziert. Anhand der betrachteten Argumente wird im Teil 6 auf die eingangsgestellte Frage eingegangen, welche Chancen Öffentlich Private Partnerschaften den Kommunen zur Auflösung des Investitionsstaus geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. ÖPP, was ist das?
- 3. ÖPP Modelle
- 3.1 Erwerbermodell
- 3.2 Inhabermodell
- 3.3 Leasingmodell
- 3.4 Mietmodell
- 3.5 Contractingmodell
- 3.6 Konzessionsmodell
- 3.7 Gesellschaftsmodell
- 4. Warum ÖPP?
- 4.1 Finanzielle Aspekte
- 4.2 Betriebswirtschaftliche Aspekte
- 5. Chancen und Risiken von ÖPP
- 5.1 Chancen
- 5.2 Risiken
- 5.2.1 Wirtschaftlichkeits- und Risikoanalyse
- 5.2.2 Kommunaler Handlungsspielraum und Intergenerationengerechtigkeit
- 5.2.3 Finanzierung
- 5.2.4 Handlung am Kapitalmarkt
- 6. Wundermittel für klamme Kommunen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) und deren Eignung als Lösung für die finanziellen Probleme von Kommunen. Sie analysiert verschiedene ÖPP-Modelle und bewertet die damit verbundenen Chancen und Risiken. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis von ÖPP zu vermitteln und die Frage zu beantworten, ob ÖPP tatsächlich ein Wundermittel für finanzschwache Kommunen darstellen.
- Definition und verschiedene Modelle von ÖPP
- Finanzielle und betriebswirtschaftliche Aspekte von ÖPP
- Chancen und Risiken von ÖPP für Kommunen
- Wirtschaftlichkeitsanalyse und Risikobewertung von ÖPP
- Der Einfluss von ÖPP auf den kommunalen Handlungsspielraum
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) ein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Eignung von ÖPP als Lösung für die finanziellen Probleme von Kommunen. Es wird die Methodik erläutert, die auf der Auswertung wissenschaftlicher Literatur und "grauer Literatur" basiert, um ein umfassendes Bild des Themas zu erhalten. Der Aufbau der Arbeit wird vorgestellt, mit dem Ziel, auch Lesern ohne Vorwissen einen guten Einstieg zu ermöglichen. Die Einleitung betont die Notwendigkeit einer Begriffsklärung und die Vorstellung verschiedener ÖPP-Modelle.
2. ÖPP, was ist das?: Dieses Kapitel klärt den Begriff "Öffentlich-Private Partnerschaft" (ÖPP) und seine verschiedenen Ausprägungen. Es wird deutlich gemacht, dass es in Deutschland keine gesetzliche Definition von ÖPP gibt, was zu Kritik hinsichtlich der Unschärfe und Beliebigkeit des Begriffs führt. Trotzdem beschreibt das Kapitel die grundlegende Idee von ÖPP: die Beteiligung privater Unternehmen an der Finanzierung und Verwaltung öffentlicher Infrastruktur und Leistungen. Die Motivation hierfür wird in knappen öffentlichen Kassen und dem erwarteten Nutzen durch die Kombination von öffentlichem und privatem Know-how und Kapital gesehen. Das Kapitel verdeutlicht, dass ÖPP seit den 1990er Jahren in verschiedenen Bereichen wie Energieversorgung, Abfallwirtschaft und öffentlichem Nahverkehr eingesetzt werden.
3. ÖPP Modelle: Kapitel 3 stellt verschiedene Modelle von Öffentlich-Privaten Partnerschaften vor und veranschaulicht sie graphisch. Es analysiert die Unterschiede und Besonderheiten der einzelnen Modelle, um ein breites Spektrum an Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren aufzuzeigen. Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Modelle (Erwerbermodell, Inhabermodell, Leasingmodell, Mietmodell, Contractingmodell, Konzessionsmodell, Gesellschaftsmodell) ermöglicht ein tiefes Verständnis der verschiedenen Kooperationsformen und ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile.
4. Warum ÖPP?: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründe für den zunehmenden Einsatz von ÖPP. Es untersucht die finanziellen und betriebswirtschaftlichen Aspekte, die ÖPP attraktiv machen. Die Analyse fokussiert auf die Vorteile, die sowohl für die öffentliche Hand als auch für private Unternehmen entstehen. Es werden Argumente präsentiert, die die Effizienzsteigerung und Kostenreduktion durch die Zusammenarbeit hervorheben. Der Fokus liegt auf der Erläuterung, warum ÖPP als eine Lösung für Herausforderungen des öffentlichen Sektors angesehen werden.
5. Chancen und Risiken von ÖPP: Kapitel 5 stellt die Chancen und Risiken von ÖPP gegenüber. Es werden die positiven Effekte einer ÖPP-Kooperation für alle Beteiligten ausführlich erläutert und gleichzeitig die potenziellen Gefahren und Probleme, die im Vorfeld, während der Projektphase und nach dem Vertragsende auftreten können, detailliert analysiert. Die Kapitel unterteilt sich in eine Chancen- und Risikobetrachtung, wobei letztere Aspekte wie Wirtschaftlichkeits- und Risikoanalyse, kommunaler Handlungsspielraum, Finanzierung und die Handlung am Kapitalmarkt näher beleuchtet.
Schlüsselwörter
Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP), Public Private Partnerships (PPP), Kommunalfinanzen, Infrastrukturfinanzierung, Risikomanagement, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Modelltypen, Chancen, Risiken, Intergenerationengerechtigkeit, Investitionsstau.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) - Eine umfassende Analyse
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Eignung von ÖPP als Lösung für die finanziellen Probleme von Kommunen.
Welche ÖPP-Modelle werden behandelt?
Das Dokument beschreibt verschiedene ÖPP-Modelle detailliert: Erwerbermodell, Inhabermodell, Leasingmodell, Mietmodell, Contractingmodell, Konzessionsmodell und Gesellschaftsmodell. Die Beschreibungen umfassen die jeweiligen Besonderheiten und Vor- und Nachteile.
Welche Aspekte der ÖPP werden analysiert?
Die Analyse umfasst finanzielle und betriebswirtschaftliche Aspekte von ÖPP, Chancen und Risiken für Kommunen, Wirtschaftlichkeitsanalysen und Risikobewertungen, sowie den Einfluss von ÖPP auf den kommunalen Handlungsspielraum und die Intergenerationengerechtigkeit.
Warum werden ÖPP eingesetzt?
Der zunehmende Einsatz von ÖPP wird durch finanzielle Engpässe der Kommunen und das erwartete Plus an Effizienz und Kostenreduktion durch die Kombination von öffentlichem und privatem Know-how und Kapital begründet. Das Dokument beleuchtet die Vorteile für öffentliche Hand und private Unternehmen.
Welche Chancen und Risiken bergen ÖPP?
Das Dokument beschreibt ausführlich sowohl die positiven Effekte von ÖPP-Kooperationen als auch die potenziellen Gefahren und Probleme in allen Projektphasen. Die Risikobetrachtung umfasst Aspekte wie Wirtschaftlichkeits- und Risikoanalyse, kommunalen Handlungsspielraum, Finanzierungsfragen und die Handlung am Kapitalmarkt.
Gibt es eine Definition von ÖPP im deutschen Recht?
Nein, das Dokument betont, dass es in Deutschland keine gesetzliche Definition von ÖPP gibt, was zu Unschärfe und Kritik führt. Trotzdem wird die grundlegende Idee von ÖPP – die Beteiligung privater Unternehmen an der Finanzierung und Verwaltung öffentlicher Infrastruktur und Leistungen – erläutert.
Ist ÖPP ein Wundermittel für klamme Kommunen?
Das Dokument untersucht kritisch, ob ÖPP tatsächlich ein "Wundermittel" für finanzschwache Kommunen darstellen. Es analysiert die Vor- und Nachteile, um eine fundierte Antwort auf diese Frage zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP), Public Private Partnerships (PPP), Kommunalfinanzen, Infrastrukturfinanzierung, Risikomanagement, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Modelltypen, Chancen, Risiken, Intergenerationengerechtigkeit, Investitionsstau.
Wie ist der Aufbau des Dokuments?
Das Dokument ist strukturiert in Einleitung, Erklärung des Begriffs ÖPP, Beschreibung verschiedener ÖPP-Modelle, Analyse der Gründe für den Einsatz von ÖPP, Bewertung von Chancen und Risiken und eine abschließende Diskussion der Frage, ob ÖPP ein Wundermittel für Kommunen sind. Es bietet eine klare Struktur für ein umfassendes Verständnis des Themas.
- Quote paper
- Torsten Kühne (Author), 2008, Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) – Wundermittel für klamme Kommunen? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116623