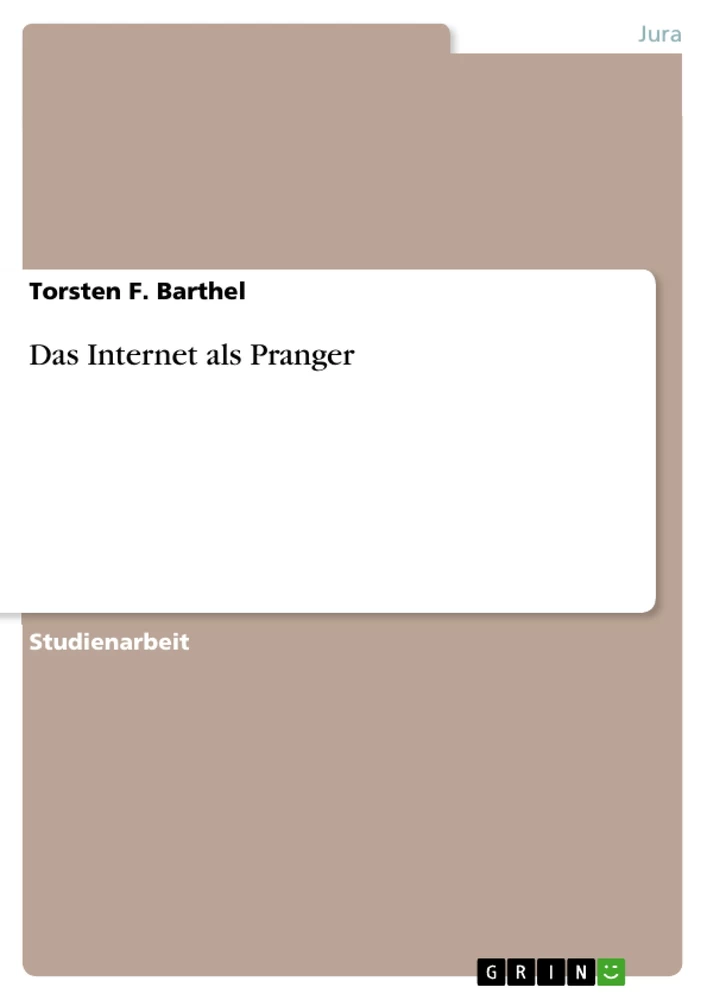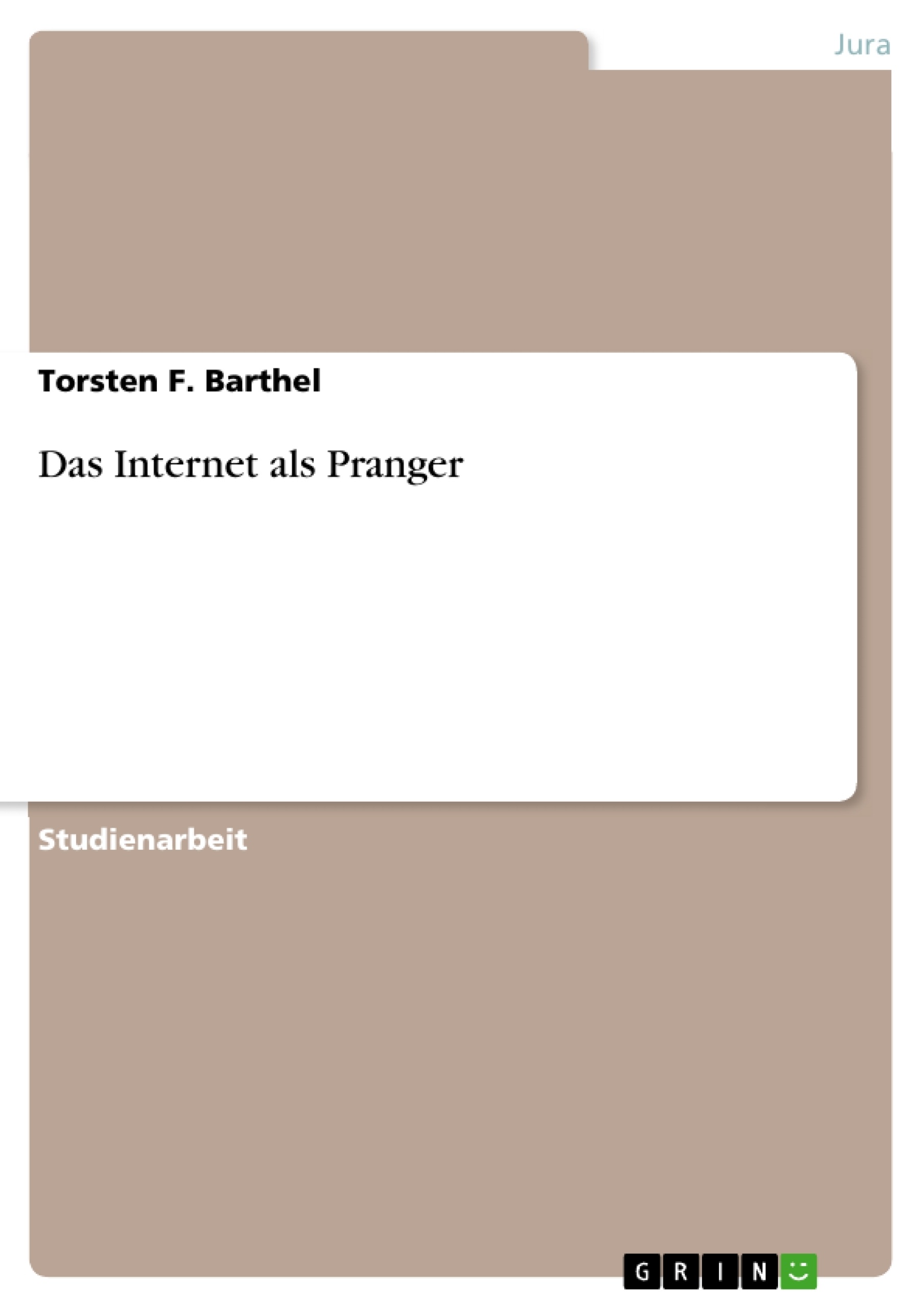Der hier zu behandelnden Thematik des „Internet als Pranger“ fußt auf folgender tatsächlicher Situation: In vielen Fällen sind Gläubiger in zivilrechtlichen Rechtsverhältnissen unzufrieden mit den Möglichkeiten des zivilgerichtlichen Rechtsschutzes, dies insbesondere in Bezug auf die Vollstreckung titulierter Ansprüche. Sie suchen daher nach individuellen Mitteln und Wegen, um ausstehende Leistungen einzutreiben , und zwar nicht erst in jüngerer Zeit . Dabei wird häufig auf eine breite Öffentlichkeitswirkung abgestellt, wie etwa durch auffällige „Schwarze Männer“ oder „Schwarze Schatten“, die hartnäckige Schuldner im Gläubigerauftrag so lange verfolgen, bis die Schulden beglichen sind . Von 1992-1999 bedienten sich Gläubiger u. u. auch eines RTL-„Mahn-Man“, dessen Bemühungen um die Schuldbeitreibung im Fernsehen gezeigt wurden . In Anbetracht dieser Entwicklungen erscheint es konsequent, dass seit geraumer Zeit auch das Internet als öffentlichkeitswirksames Druckmittel gegen zahlungsunwillige Schuldner eingesetzt wird . Auf verschiedenen, häufig nicht sehr lange vorgehaltenen Internetseiten bieten kommerzielle Unternehmen Plattformen für Schuldnerverzeichnisse und „schwarze Listen“ an. (...) Nach lfd. Nr. 1 Satz 2 der AGB der Betreiberin diente die Veröffentlichung der Schuldnerdaten dazu, „die Märkte transparenter zu machen und dadurch im Interesse aller Marktteilnehmer Fehlentwicklungen und Missbräuchen entgegen zu wirken“ . Die Veröffentlichungen sollten kostenpflichtig sein.
Eine gegen das Urteil des OLG Rostock erhobene Verfassungsbeschwerde ist vom BVerfG wegen fehlender Rechtswegerschöpfung als unzulässig zurückgewiesen worden . Seit Sommer 2001 wird die Internetseite nicht mehr betrieben; die Domain steht zum Verkauf .
Die zu analysierende Entscheidung hat grundsätzlichen Charakter, weil sich das Gericht mit den und Spezifika des Mediums Internet hinsichtlich der Zulässigkeit von Selbsthilfemaßnahmen gegen säumige Schuldner auseinandersetzen musste. Diese liegen insbesondere in der intensiven medialen Prangerwirkung des Internet begründet . Im Folgenden setzt sich diese Seminararbeit mit den rechtlichen Rahmenbedingungen dergestaltiger „anprangernder“ Publikationen auseinander. Die anstehenden Fragen sind nicht ganz neu , gewinnen indes stetig an Relevanz.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriff und Wirkung von Anprangerung
- III. Erscheinungsformen der Prangerwirkung durch das Internet
- IV. Unterlassungsansprüche des Schuldners
- 1. Unterlassungsanspruch des Schuldners aus §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb
- 2. Unterlassungsanspruch des Schuldners aus §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gemäß Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG
- V. Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit das Internet als Pranger missbraucht werden kann und welche zivilrechtlichen Ansprüche dem „Geprangerten“ zustehen.
- Begriff und Wirkung von Anprangerung
- Erscheinungsformen der Prangerwirkung durch das Internet
- Unterlassungsansprüche des Schuldners aus §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb
- Unterlassungsansprüche des Schuldners aus §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gemäß Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG
- Relevanz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im Kontext der Prangerwirkung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Prangerwirkung im Internet ein und skizziert die Relevanz der Thematik im Kontext der digitalen Gesellschaft.
- Begriff und Wirkung von Anprangerung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Anprangerung und analysiert die damit verbundenen Auswirkungen auf den Betroffenen.
- Erscheinungsformen der Prangerwirkung durch das Internet: Dieser Abschnitt untersucht verschiedene Formen der Prangerwirkung im Internet, wie z.B. die Veröffentlichung von Schuldnerlisten oder die Verbreitung negativer Bewertungen.
- Unterlassungsansprüche des Schuldners: Das Kapitel beleuchtet die zivilrechtlichen Ansprüche des „Geprangerten“, insbesondere den Unterlassungsanspruch aus §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB. Es werden sowohl Ansprüche wegen Verletzung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als auch wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts untersucht.
Schlüsselwörter
Internet, Prangerwirkung, Anprangerung, Schuldner, Unterlassungsanspruch, Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit, Datenschutz, digitale Gesellschaft.
- Citar trabajo
- Torsten F. Barthel (Autor), 2008, Das Internet als Pranger, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116533