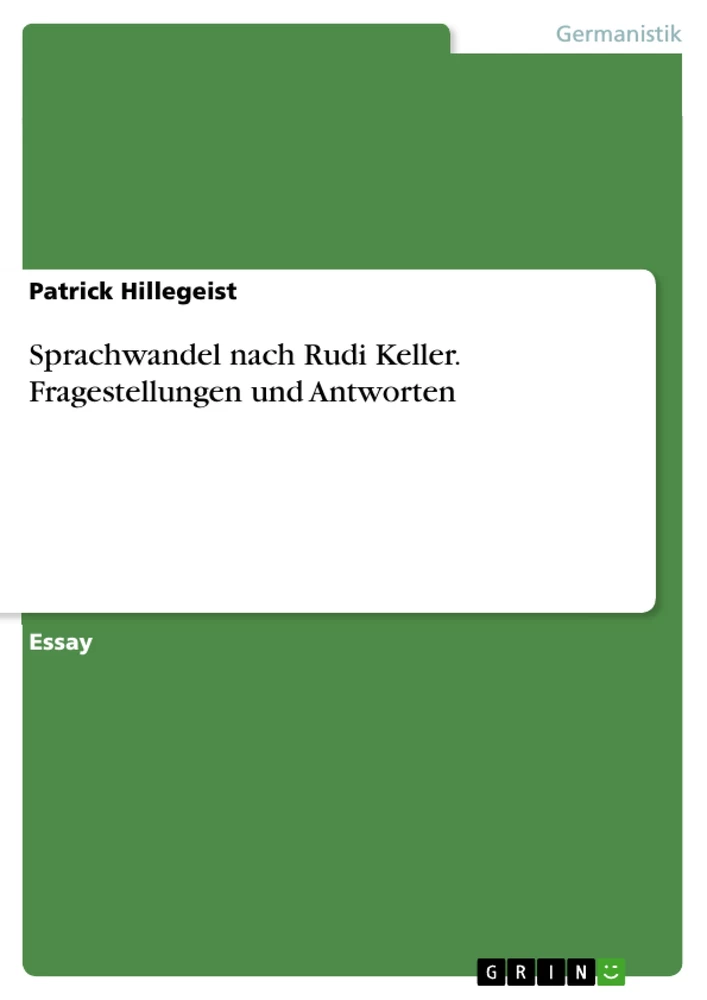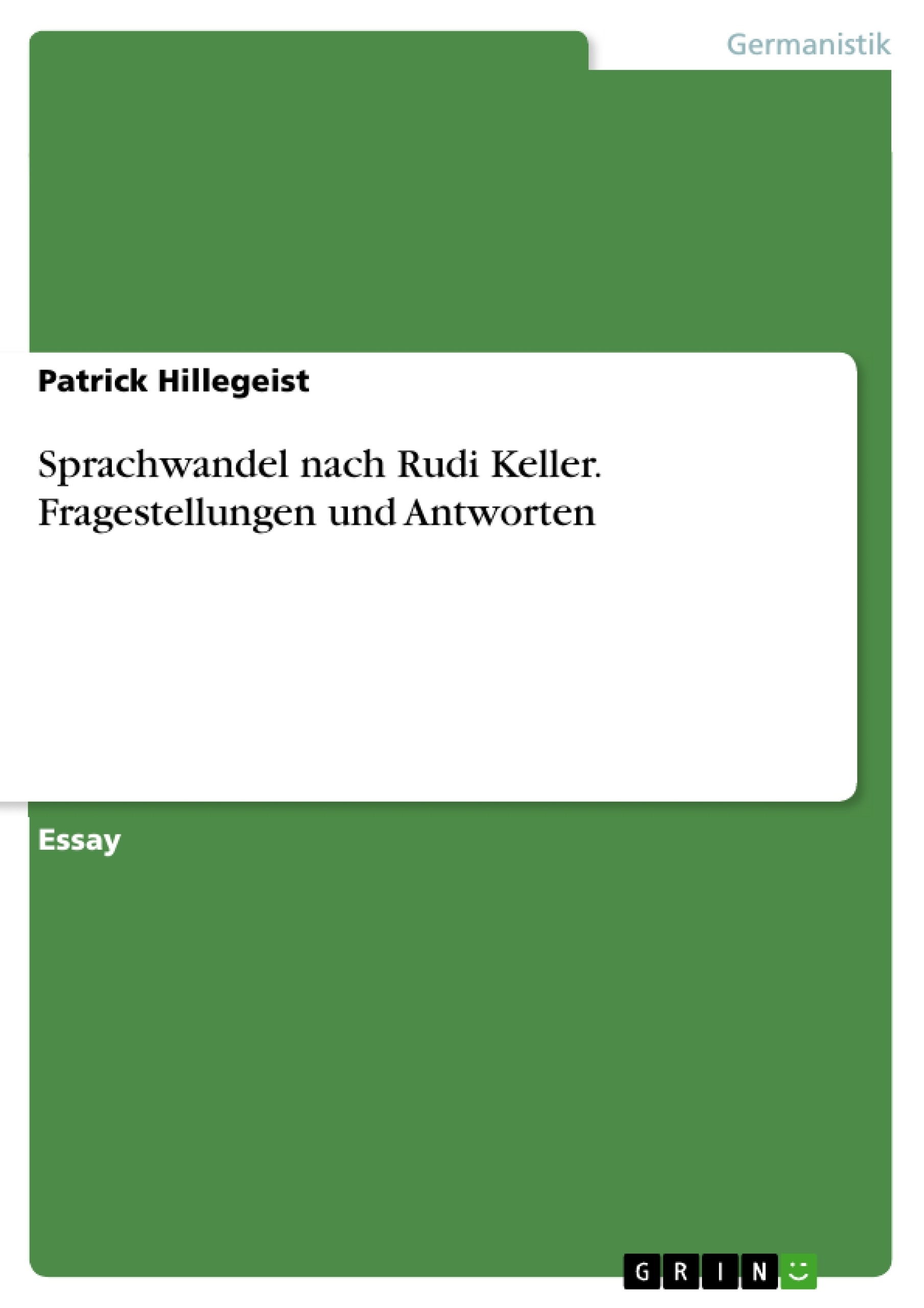In einem wissenschaftlichen Streitgespräch über den (vermeintlichen oder tatsächlichen) Sprachverfall vertritt der Sprachwissenschaftler Rudi Keller die Ansicht, die deutsche Sprache sei nicht heute, sondern „im 16. und 17. Jahrhundert“ bedroht gewesen: „Damals sprachen der Adel Französisch, die Gelehrten Latein und nur die Bauern Deutsch. Es gab zu der Zeit sogar den ernst gemeinten Vorschlag, in Deutschland das Französische als allgemeine Umgangssprache einzuführen, anstatt mühsam zu versuchen, die deutsche Sprache zu kultivieren. Heute sehe ich dagegen keine Bedrohung; die deutsche Sprache ist gut in Schuss. Was wir als Sprachverfall wahrnehmen, ist nichts anderes als der allgegenwärtige Sprachwandel. Und den hat es immer schon gegeben.“ Nehmen sie zu dieser Einschätzung Stellung, indem Sie a.) einleitend kurz und prägnant (auch unter Bezugnahme auf weitere Ansätze) den Terminus des Sprachwandels klären und b.) Kellers Ansicht unter Bezugnahme auf seine Theorie der unsichtbaren Hand deuten. Reflektieren Sie abschließend c.) die Rolle und Bedeutung, die dem einzelnen Sprecher in diesem Entwurf zukommt. 2.) Begreift man Sprache als ein komplexes System konventioneller Regeln, verdient die Übertretung dieser Konventionen durch den Einzelnen in der Erklärung von Sprachwandelprozessen besondere Beachtung. Begründen Sie diese Einschätzung, indem Sie auf die von Hermann Paul vertretene Auffassung eines solchen Wandels zurückgreifen. 3.) Folgt man der sprachwissenschaftlichen Überzeugung von der Erklärbarkeit sprachlichen Wandels, müssen die Gründe für die Abweichung vom Sprachusus, die am Beginn des Prozesses stehen, aufzeigbar sein. Skizzieren Sie für die folgenden Fälle jeweils eine in sich konsistente Erklärung für den sich abzeichnenden Wandel. Gegeben seien drei Beispiele: a.) ein Deklinationsproblem: Im Herbst diesen Jahres sehen wir uns wieder (statt des korrekten im Herbst dieses Jahres) – Wieso wählen selbst gebildete Sprecher diese Form, während sie niemals die Hosen diesen Kindes oder der Motor diesen Autos sagen würden? b.) ein syntaktisch-semantisches Problem: Ich muss jetzt gehen, weil die Geschäfte machen gleich zu. Welcher Prozess ist hier im Gang?; c.) eine lexikalische Neuerung: son, in seiner femininen Form sone, z.B. Son Ding/Sone Maschine hab ich nich nie gesehen bzw. im Dativ som/sone, z.B. Mit som Ding/soner Maschine geht das wunderbar. Um welche Wortkreation handelt es sich hierbei und was leistet sie?
Inhaltsverzeichnis
- 1.) In einem wissenschaftlichen Streitgespräch über den (vermeintlichen oder
tatsächlichen) Sprachverfall vertritt der Sprachwissenschaftler Rudi Keller die
Ansicht, die deutsche Sprache sei nicht heute, sondern „im 16. und 17.\nJahrhundert\" bedroht gewesen: „Damals sprachen der Adel Französisch, die
Gelehrten Latein und nur die Bauern Deutsch. Es gab zu der Zeit sogar den ernst\ngemeinten Vorschlag, in Deutschland das Französische als allgemeine\nUmgangssprache einzuführen, anstatt mühsam zu versuchen, die deutsche\nSprache zu kultivieren. Heute sehe ich dagegen keine Bedrohung; die deutsche\nSprache ist gut in Schuss. Was wir als Sprachverfall wahrnehmen, ist nichts\nanderes als der allgegenwärtige Sprachwandel. Und den hat es immer schon\ngegeben.“ Nehmen sie zu dieser Einschätzung Stellung, indem Sie
- a.) einleitend kurz und prägnant (auch unter Bezugnahme auf weitere Ansätze)\nden Terminus des Sprachwandels klären und
- b.) Kellers Ansicht unter Bezugnahme auf seine Theorie der unsichtbaren Hand\ndeuten. Reflektieren Sie abschließend
- c.) die Rolle und Bedeutung, die dem einzelnen Sprecher in diesem Entwurf\nzukommt.
- 2.) Begreift man Sprache als ein komplexes System konventioneller Regeln,\nverdient die Übertretung dieser Konventionen durch den Einzelnen in der\nErklärung von Sprachwandelprozessen besondere Beachtung. Begründen Sie\ndiese Einschätzung, indem Sie auf die von Hermann Paul vertretene Auffassung\neines solchen Wandels zurückgreifen.
- 3.) Folgt man der sprachwissenschaftlichen Überzeugung von der Erklärbarkeit\nsprachlichen Wandels, müssen die Gründe für die Abweichung vom Sprachusus,\ndie am Beginn des Prozesses stehen, aufzeigbar sein. Skizzieren Sie für die\nfolgenden Fälle jeweils eine in sich konsistente Erklärung für den sich\nabzeichnenden Wandel. Gegeben seien drei Beispiele:
- a.) ein Deklinationsproblem: Im Herbst diesen Jahres sehen wir uns wieder (statt\ndes korrekten im Herbst dieses Jahres) - Wieso wählen selbst gebildete\nSprecher diese Form, während sie niemals die Hosen diesen Kindes oder der\nMotor diesen Autos sagen würden?
- b.) ein syntaktisch-semantisches Problem: Ich muss jetzt gehen, weil die\nGeschäfte machen gleich zu. Welcher Prozess ist hier im Gang?;
- c.) eine lexikalische Neuerung: son, in seiner femininen Form sone, z.B. Son\nDing/Sone Maschine hab ich nich nie gesehen bzw. im Dativ som/sone, z.B. Mit\nsom Ding/soner Maschine geht das wunderbar. Um welche Wortkreation handelt\nes sich hierbei und was leistet sie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit dem Phänomen des Sprachwandels und beleuchtet verschiedene Theorien zur Erklärung dieses Prozesses. Im Zentrum steht dabei die Frage, welche Rolle der einzelne Sprecher im Sprachwandel spielt.
- Der Essay analysiert die Theorie des Sprachwandels von Rudi Keller und dessen "Invisible-hand-Theorie".
- Es wird die Bedeutung von Konventionen und deren Übertretung in Bezug auf Sprachwandel anhand der Ansätze von Hermann Paul diskutiert.
- Der Essay untersucht verschiedene Fälle von Sprachwandel, darunter Deklinationsprobleme, syntaktisch-semantische Veränderungen und lexikalische Neuerungen.
- Es wird die Frage beleuchtet, inwiefern der einzelne Sprecher als Impulsgeber und Indikator von Sprachwandel fungiert.
- Der Essay untersucht die Frage, ob und wie der Sprachwandel durch den Einzelnen beeinflusst und gesteuert werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Theorie des Sprachwandels von Rudi Keller. Keller argumentiert, dass Sprachwandel ein natürlicher Prozess ist, der sich durch die unsichtbare Hand des Sprachgebrauchs vollzieht. Er betont die Bedeutung des einzelnen Sprechers als Impulsgeber für den Sprachwandel.
Das zweite Kapitel widmet sich der Theorie von Hermann Paul, der den Sprachwandel als Ergebnis der Übertretung von Konventionen durch den Einzelnen versteht. Paul vergleicht diesen Prozess mit der Evolutionstheorie von Darwin.
Das dritte Kapitel untersucht verschiedene Beispiele für Sprachwandel, darunter Deklinationsprobleme, syntaktisch-semantische Veränderungen und lexikalische Neuerungen. Es werden mögliche Erklärungen für diese Veränderungen und die Rolle des einzelnen Sprechers in diesem Prozess beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sprachwandel, Sprachverfall, Invisible-hand-Theorie, Konventionen, Sprachgebrauch, Sprecher, Sprachusus, Deklination, Syntax, Semantik, Lexik, Wortkreation, Evolutionstheorie.
- Quote paper
- Patrick Hillegeist (Author), 2008, Sprachwandel nach Rudi Keller. Fragestellungen und Antworten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116523