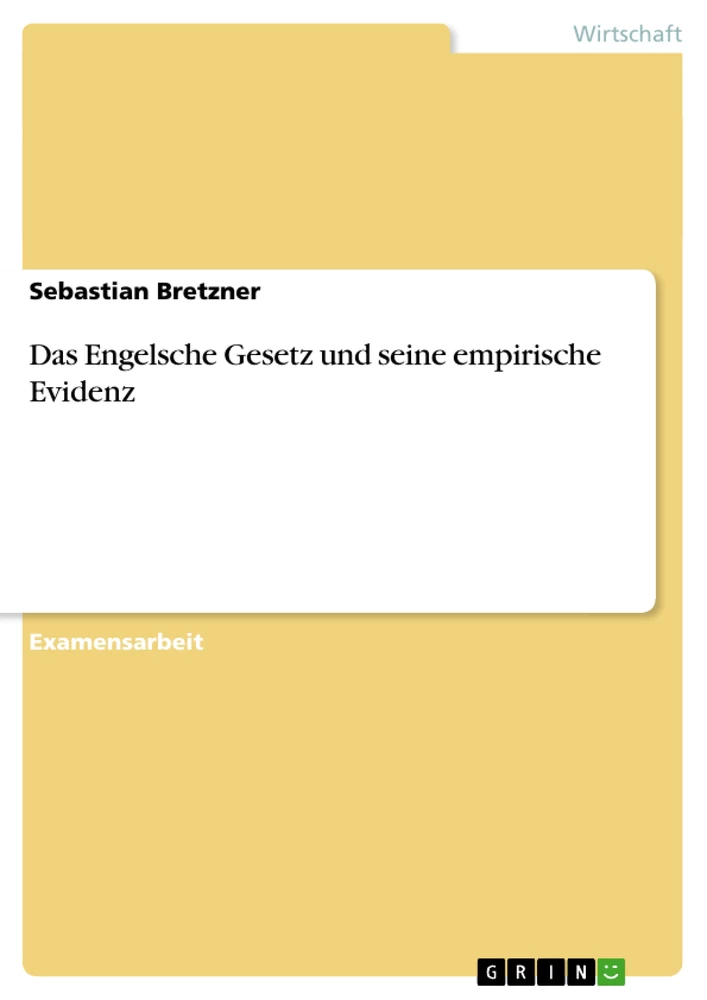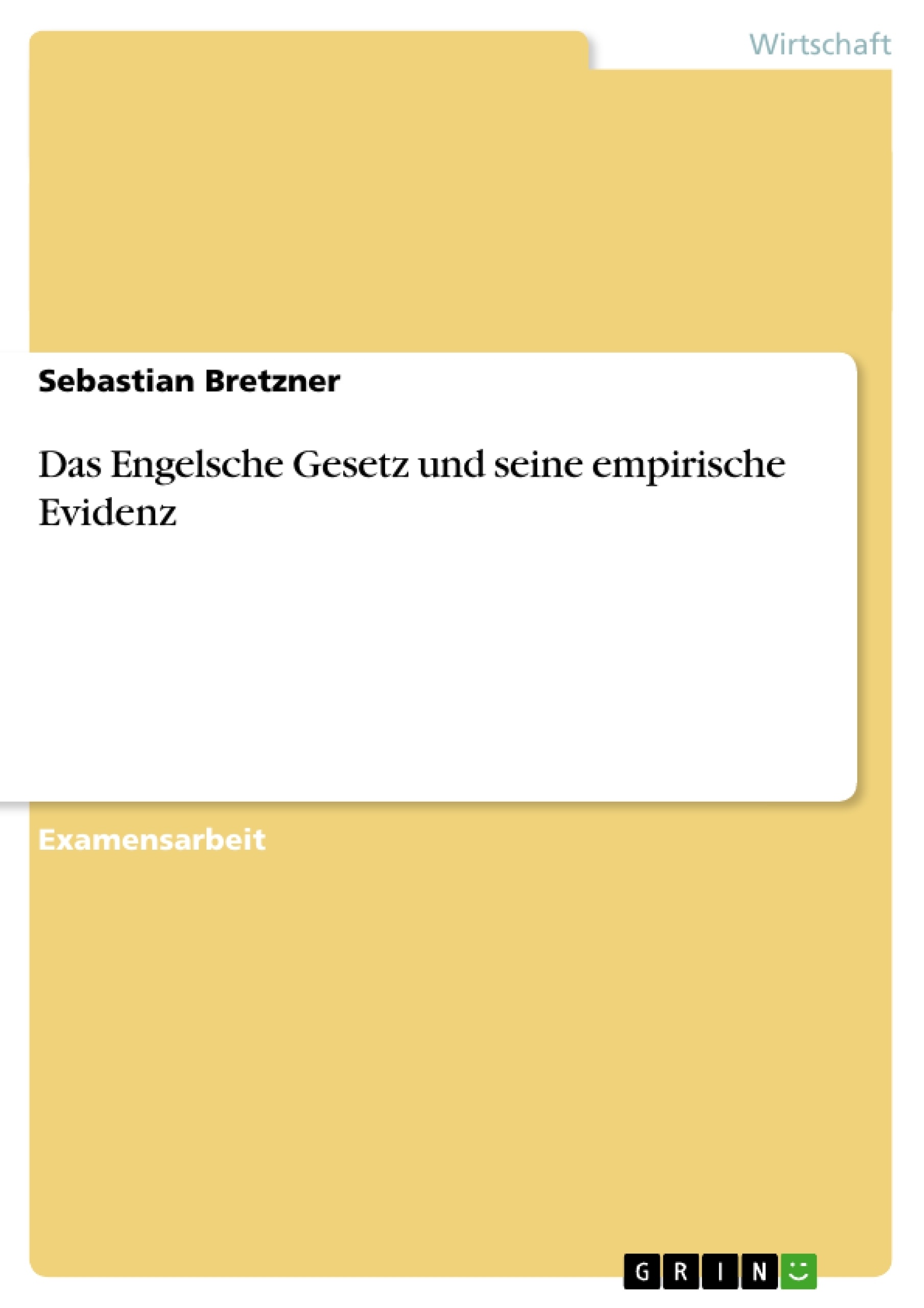Der Zusammenhang zwischen dem Einkommen eines Privathaushaltes und seinen
Konsumausgaben, insbesonders für Nahrung, beschäftigt schon seit Jahrhunderten die Wirtschaftsstatistik. Ernst Engel hat 1857 zum ersten Mal schriftlich festgehalten, dass je höher das Einkommen einer Person oder Familie ist, desto kleiner ist der Anteil der Ausgaben, den sie für Ernährung ausgeben müssen. Ebenso gilt in diesem Fall die Umkehrung, das heißt also, je höher die prozentualen Ausgaben eines Haushaltes für Ernährung sind, desto kleiner ist das gesamte Einkommen dieses Privathaushaltes. Das Gesetz, das sich daraus entwickelt hat, steht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Aber nicht nur Engel hat sich Gedanken zu dem Zusammenhang Einkommen – Konsumausgaben gemacht, sondern zum Beispiel auch John Maynard Keynes, allerdings mehr für makroökonomie Zwecke. In seiner “General Theory of Employment, Interest and
Money” von 1936 schreibt er: "The amount that the community spends on consumption obviously depends
(i) partly on the amount of its income,
(ii) partly on the other objective attendant circumstances, and
(iii) partly on the subjective needs and the psychological propensities and habits of the individuals composing it and the principles on which the income is divided between them (...).
Da Keynes annimmt, dass sich die unter (iii) genannten Neigungen und Gewohnheiten kurzfristig nicht ändern, ebenso wie erwartete Umstände bei (ii), geht er davon aus, dass kurzfristige Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten hauptsächlich durch Einkommensveränderungen hervorgerufen werden. Jedoch sind die Ausmaße der Veränderungen nicht äquivalent, da er vermutet, dass durch höheres Einkommen auch die Sparquote ansteigt. Keynes bezeichnet diese Erkenntnis als „Fundamental Psychologisches Gesetz“: „We take it as a fundamental psychological rule of any modern community that, when its real income is increased, it will not increase its consumption by an equal absolute
amount (...). The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income."
Damit hat auch Keynes festgestellt, dass bei einer Steigerung des Einkommens die
Konsumausgaben nicht im gleichen Umfang zunehmen, wie im weiteren Verlauf der Arbeit noch gezeigt werden wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken und Hinführung zum Thema
- Das Leben und Schaffen Ernst Engels
- Biographischer Abriss seines Lebens
- Ernst Engel und die Statistik
- Der Weg zum Engelschen Gesetz
- Folgerungen Engels aus den Statistiken von Ducpétiaux
- Folgerungen Engels aus den Statistiken von Le Play
- Engels Darstellung der Gesetzmäßigkeit
- Darstellung des Engelschen Gesetzes
- Engelkurven
- Einkommenselastizitäten und ihre Unterschiede
- Die Statistiken des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Konsum
- Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Die laufenden Wirtschaftrechnungen
- Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
- Allgemeines zur Durchführung des EVS
- Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003
- Vergleich und kritische Analyse der Möglichkeiten
- Empirische Überprüfung des Engelschen Gesetzes
- Zeitreihenanalysen
- Weitere Ergebnisse aus empirischen Daten
- Ergebnisse für Europa
- Ergebnisse für die USA
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Engelsche Gesetz, seine Entstehung und seine empirische Gültigkeit. Sie beleuchtet den historischen Kontext seiner Formulierung durch Ernst Engel und analysiert verschiedene statistische Daten zur Überprüfung seiner Aussagekraft.
- Biografischer Kontext von Ernst Engel und seine statistischen Arbeiten
- Entwicklung und Formulierung des Engelschen Gesetzes
- Analyse verschiedener statistischer Daten zur Überprüfung des Gesetzes
- Untersuchung von Engelkurven und Einkommenselastizitäten
- Vergleich der Ergebnisse verschiedener Datensätze und Regionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Gedanken und Hinführung zum Thema: Diese Einleitung führt in die Thematik des Engelschen Gesetzes ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung und stellt die Forschungsfrage nach der empirischen Evidenz des Gesetzes in den Mittelpunkt. Die Einleitung liefert einen Überblick über die folgenden Kapitel und die Methodik der Arbeit.
Das Leben und Schaffen Ernst Engels: Dieses Kapitel beleuchtet die Biografie Ernst Engels und seinen Werdegang als Statistiker. Es wird sein Leben skizziert, um seinen Einfluss auf die Entwicklung des Gesetzes nachvollziehen zu können. Der Fokus liegt auf Engels' Engagement in der Statistik und seinen Methoden, die er bei der Erforschung der Konsummuster verwendete. Es wird der Zusammenhang zwischen seiner sozialen Einstellung und seinen statistischen Analysen dargestellt.
Der Weg zum Engelschen Gesetz: Hier wird die Entstehung des Engelschen Gesetzes detailliert nachgezeichnet. Es werden die statistischen Analysen von Ducpétiaux und Le Play vorgestellt, auf denen Engel seine Schlussfolgerungen aufbaute. Die Methodik Engels und seine Interpretation der Daten werden kritisch beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Gesetzmäßigkeit aus den empirischen Befunden.
Darstellung des Engelschen Gesetzes: In diesem Kapitel wird das Engelsche Gesetz selbst ausführlich erläutert. Der Begriff der Engelkurve wird definiert und verschiedene Formen von Engelkurven werden vorgestellt. Die Bedeutung der Einkommenselastizität im Kontext des Gesetzes wird erläutert und deren unterschiedliche Ausprägungen für verschiedene Gütergruppen werden diskutiert. Das Kapitel dient als Grundlage für die empirische Überprüfung.
Die Statistiken des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Konsum: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene statistische Datenquellen, die zur Überprüfung des Engelschen Gesetzes herangezogen werden. Es beschreibt die Methodik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die laufenden Wirtschaftrechnungen und insbesondere die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Daten und ihrer Eignung für die empirische Überprüfung.
Empirische Überprüfung des Engelschen Gesetzes: Dieser zentrale Teil der Arbeit präsentiert die Ergebnisse der empirischen Überprüfung des Engelschen Gesetzes. Es werden Zeitreihenanalysen vorgestellt und die Ergebnisse aus empirischen Daten für Europa und die USA diskutiert. Die Ergebnisse werden kritisch bewertet und mögliche Limitationen der verwendeten Daten und Methoden werden angesprochen.
Schlüsselwörter
Engelsches Gesetz, Engelkurve, Einkommenselastizität, Konsumverhalten, Statistik, empirische Evidenz, Zeitreihenanalyse, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), Ducpétiaux, Le Play, Ernst Engel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Das Engelsche Gesetz - Eine empirische Untersuchung
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Engelsche Gesetz, seine Entstehung und seine empirische Gültigkeit. Sie beleuchtet den historischen Kontext seiner Formulierung durch Ernst Engel und analysiert verschiedene statistische Daten zur Überprüfung seiner Aussagekraft.
Wer war Ernst Engel und welche Rolle spielt er in dieser Arbeit?
Ernst Engel war ein Statistiker, dessen Leben und Werk in dieser Arbeit detailliert beschrieben werden. Seine statistischen Analysen und seine Schlussfolgerungen bilden die Grundlage des Engelschen Gesetzes. Die Arbeit untersucht seinen biografischen Kontext und seine Methoden.
Was ist das Engelsche Gesetz?
Das Engelsche Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Einkommen und Konsum. Es besagt, dass mit steigendem Einkommen der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel am Gesamteinkommen sinkt. Die Arbeit erläutert das Gesetz detailliert und definiert den Begriff der Engelkurve sowie die Bedeutung der Einkommenselastizität.
Welche Daten werden in dieser Arbeit verwendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene statistische Datenquellen, darunter die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, laufende Wirtschaftrechnungen und insbesondere die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Die Methodik der Datenerhebung und -aufbereitung wird beschrieben und deren Eignung für die Überprüfung des Engelschen Gesetzes bewertet.
Wie wird das Engelsche Gesetz empirisch überprüft?
Die empirische Überprüfung erfolgt mittels Zeitreihenanalysen und durch die Auswertung von Daten aus Europa und den USA. Die Ergebnisse werden kritisch bewertet, und mögliche Limitationen der verwendeten Daten und Methoden werden diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu einleitenden Gedanken, dem Leben und Schaffen Ernst Engels, dem Weg zum Engelschen Gesetz, der Darstellung des Gesetzes selbst, den verwendeten Statistiken, der empirischen Überprüfung und abschließend einem Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind Engelsches Gesetz, Engelkurve, Einkommenselastizität, Konsumverhalten, Statistik, empirische Evidenz, Zeitreihenanalyse, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), Ducpétiaux, Le Play und Ernst Engel.
Welche Quellen wurden für die Entwicklung des Engelschen Gesetzes verwendet?
Die statistischen Analysen von Ducpétiaux und Le Play bildeten die Grundlage für Engels Schlussfolgerungen und die Entwicklung des Gesetzes. Die Arbeit analysiert die Methodik und Interpretation dieser Daten durch Engel kritisch.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Überprüfung des Engelschen Gesetzes?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Zeitreihenanalysen und der empirischen Daten aus Europa und den USA. Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse und deren kritische Bewertung findet sich im Kapitel zur empirischen Überprüfung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit und der Ausblick fassen die Ergebnisse zusammen und diskutieren die Bedeutung der Ergebnisse für die Wirtschaftswissenschaft. Mögliche zukünftige Forschungsfragen werden ebenfalls angesprochen.
- Quote paper
- Sebastian Bretzner (Author), 2008, Das Engelsche Gesetz und seine empirische Evidenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116500