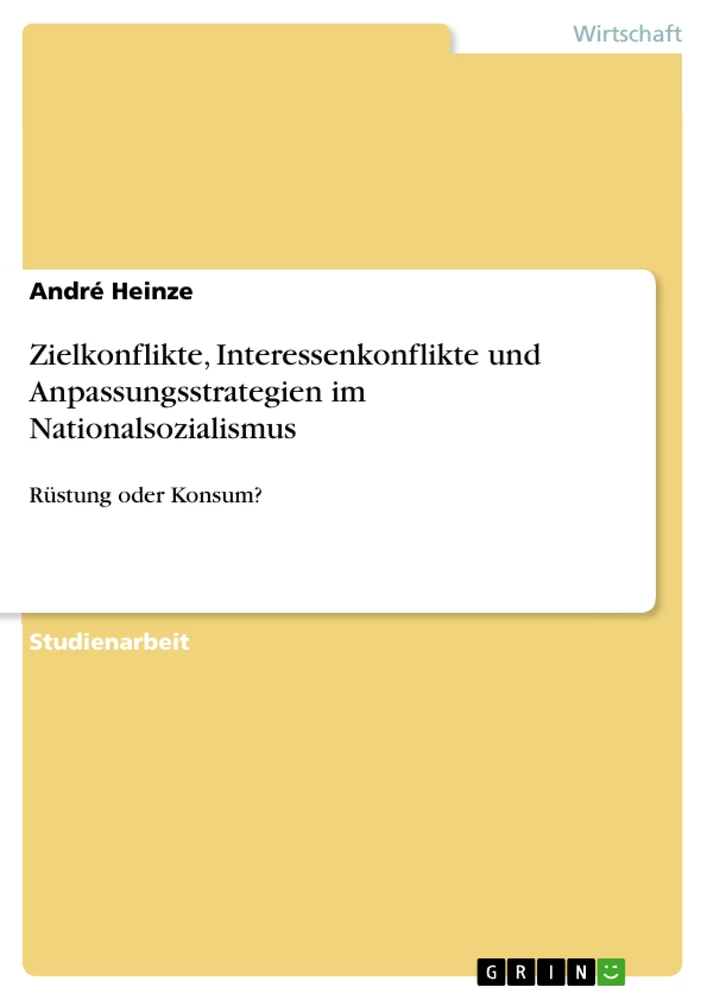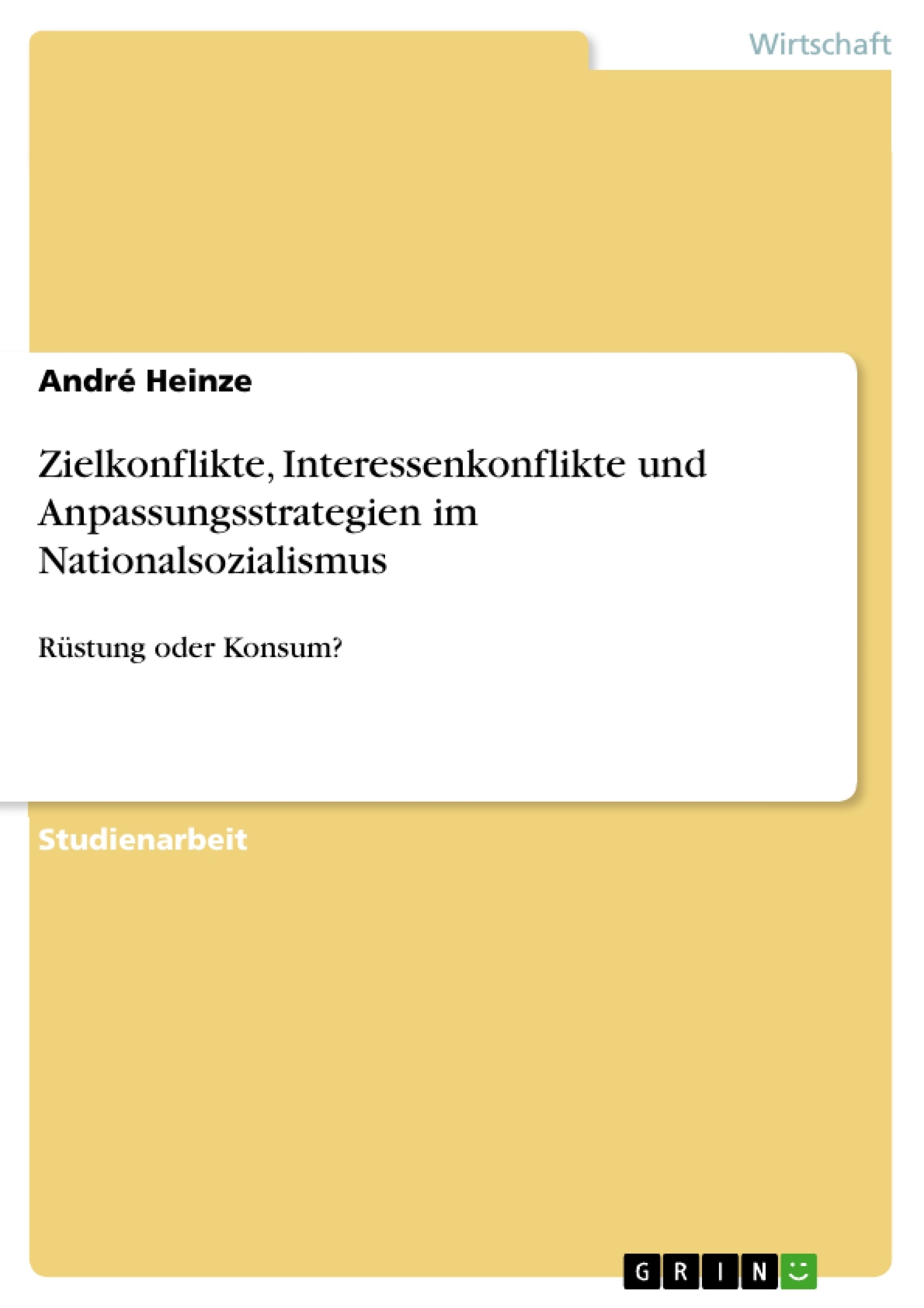Am 18. August 1933 wurde der Volksemfpänger auf der Berliner Funkausstellung erstmals vorgestellt und konnte bis Anfang 1938 über zwei Millionen Mal verkauft werden. Am 01. September 1939 entfachte Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg, der sechs Jahre andauern sollte. Die Frage, der diese Arbeit nachgehen wird, ist, inwiefern sich die nationalsozialistische Wirtschafspolitik aufgrund der Kriegsvorbereitungen auf die Konsumgüterindustrie auswirkte, da sie mit den Aufrüstungsbestrebungen kollidierte und daher Zielkonflikte verursachte, die teilweise ideologische Gründe haben.
Teil 2 dient der Darstellung zweier möglicher Antworten auf diese Frage, die als Extrema ein Spektrum eröffnen, innerhalb dessen sich die gesamte Arbeit im folgenden bewegt – weg von der Dichotomie vom Primat der Politik bzw. vom Primat der Ökonomie hin zu einer Darstellung, die die Ambivalenz des Nationalsozialismus in Form von Interessenkongruenz und Interessenkonflikten sichtbar macht. Nicht nur aus dieser Ambivalenz, sondern auch aus dem internationalen System resultierten Restriktionen, die den Handlungsspielraum der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik beschränkten. Aufbauend auf den Zielen und Restriktionen, die eine Anpassung des NS-Regimes erforderten, wird ein Modell entwickelt, aus dem sich für verschiedene Konsumgüterbranchen Thesen ableiten lassen, die in Abschnitt 2.5 zusammengetragen werden.
In Teil 3 werden einige dieser Thesen exemplarisch überprüft, weshalb drei Fallstudien zu Produkten dargestellt werden, die im Nationalsozialismus jeweils unterschiedliche Ziele erfüllen sollten: Der bereits erwähnte Volksempfänger diente als ideologisches Konsumgut, die Textilgüterindustrie diente ebenso wie die Landwirtschaft als Instrument zur innenpolitischen Absicherung. Der Mundharmonika kann allerdings kein nationalsozialistisches Ziel zugeordnet werden, weshalb deren Absatzsteigerung im Inland nicht auf wirtschaftspolitische Maßnahmen der Nationalsozialisten zurückzuführen ist, wodurch die Bedeutsamkeit dieser Fallstudie nur gesteigert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Das Modell
- Nationalsozialistische Ideologie und Konsum
- Primat der Politik oder Primat der Ökonomie?
- Primat der Politik
- Primat der Ökonomie: Der Nationalsozialismus als Instrument der Ökonomie
- Aufhebung der Dichotomie: Der Nationalsozialismus als ambivalente, dynamische Polykratie
- Kritik am Primat der Politik: Dissens und Resistenz
- Kritik am Primat der Ökonomie: Konsens
- Der Nationalsozialismus als ambivalente, dynamische Polykratie
- Internationale Rahmenbedingungen
- Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik von 1933 bis 1939
- Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik unter den Restriktionen des internationalen Systems
- Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik unter der Restriktion einer autonomen Wirtschaft (Angebot)
- Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik unter der Restriktion einer innenpolitischen Absicherung (Nachfrage)
- Fazit
- Thesen
- Empirie
- Verteilungseffekte?
- Die Konsumgüterindustrie im Aggregat
- Fallstudie I: Matthew Hohner AG
- Fallstudie II: Der Volksempfänger
- Fallstudie III: Die Textilindustrie
- Gründe für die relativ erfolgreiche Entwicklung der Textilgüterindustrie
- Gründe für die unterschiedliche Entwicklung innerhalb der Textilgüterindustrie
- Gründe für das Abweichen von Theorie und Empirie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik auf die Konsumgüterindustrie im Kontext der Kriegsvorbereitungen. Sie analysiert die Zielkonflikte, die zwischen der Aufrüstung und dem Konsum entstanden sind, und beleuchtet die ideologischen und ökonomischen Faktoren, die diese Konflikte prägten.
- Die nationalsozialistische Ideologie und ihr Verhältnis zum Konsum
- Das Spannungsfeld zwischen politischem und ökonomischem Primat im Nationalsozialismus
- Die Rolle des internationalen Systems und die Restriktionen, die die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik beeinflussten
- Die Anpassungsstrategien des NS-Regimes in Bezug auf die Konsumgüterindustrie
- Exemplarische Fallstudien zur Analyse der Auswirkungen der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik auf verschiedene Konsumgüterbranchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit vor. Das zweite Kapitel entwickelt ein Modell, das die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik im Kontext der Kriegsvorbereitungen analysiert. Es beleuchtet die nationalsozialistische Ideologie, das Spannungsfeld zwischen Politik und Ökonomie, die internationalen Rahmenbedingungen und die Restriktionen, die die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik beeinflussten. Kapitel drei präsentiert Fallstudien zu verschiedenen Konsumgüterbranchen, um die empirische Relevanz der im zweiten Kapitel entwickelten Thesen zu überprüfen.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Wirtschaftspolitik, Konsumgüterindustrie, Krieg, Aufrüstung, Ideologie, Primat der Politik, Primat der Ökonomie, internationales System, Restriktionen, Anpassungsstrategien, Fallstudien.
- Citar trabajo
- André Heinze (Autor), 2007, Zielkonflikte, Interessenkonflikte und Anpassungsstrategien im Nationalsozialismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116410