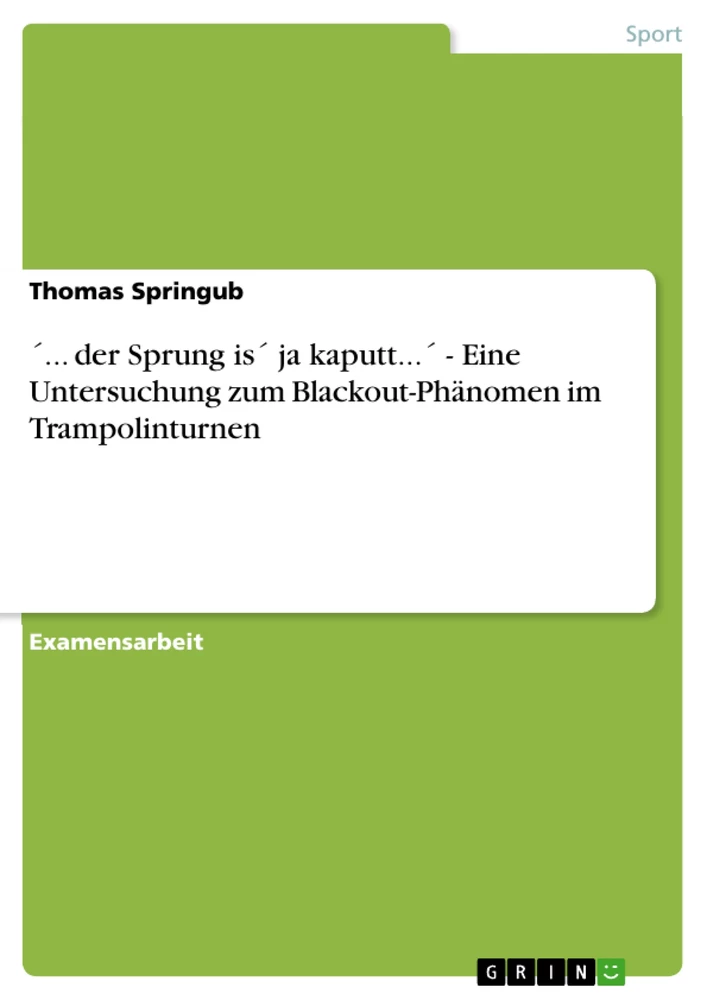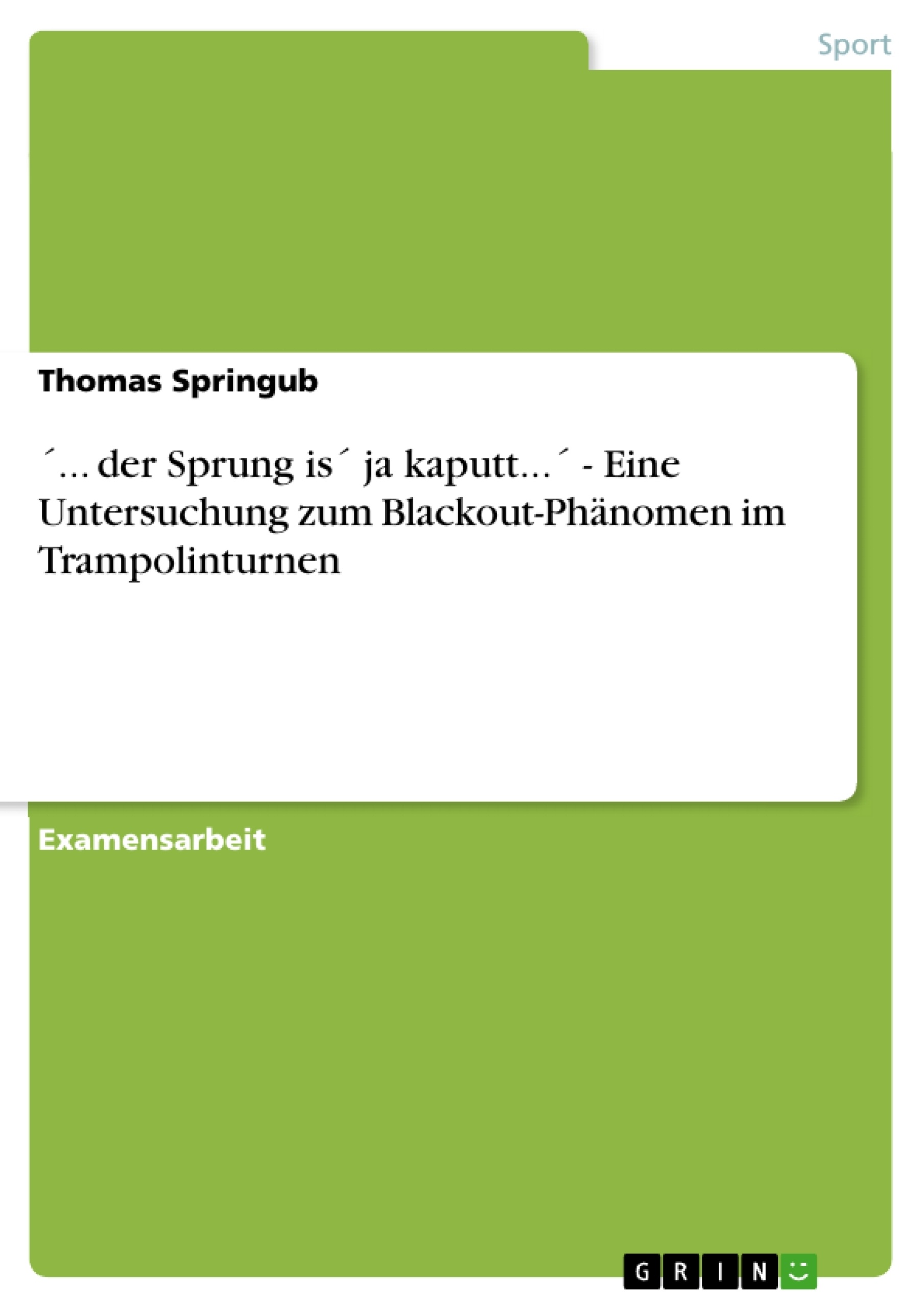Das Trampolinturnen ist eine recht junge und seit kurzem auch olympische Sportart. Im Spitzenbereich gehören Dreifachsalti mit eingebauter Längsachsendrehung bereits zum Standard-Repertoire. Die Wettkampfübungen des Leistungssports bestehen aus zehn verschiedenen Sprüngen; Mehrfach-Vorwärts- und -Rückwärtssalti zumeist mit Mehrfach-Schrauben. Um auf zehn verschiedene und dennoch schwierig und ästhetisch wirkende Elemente zu kommen, muß der Springer die Bewegungen in unterschiedlicher Körperhaltung (gebückt, gestreckt, gehockt) und v.a. die Schrauben zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Bewegung turnen. Dennoch sehen die Sprünge für den Laien `irgendwie alle gleich´ aus, und so werden Spitzenspringer manchmal gefragt: „Wie schaffst du das nur? Kommst du da nicht auch ´mal durcheinander?“
Leider muss die Antwort mancher Athleten hierauf "Ja" lauten. Plötzlich können Sprünge, die zuvor schon viele hundert Male geturnt wurden, nicht mehr abgesprungen werden. Nicht selten werden andere Sprünge geturnt, als der Athlet sich vorgenommen hatte (z. B. Salto mit zwei Schrauben, anstatt Schraubensalto). Oder die Bewegung beginnt normal, wird aber mittendrin abgebrochen. Manchmal kann ein Turner keine Ansprünge mehr machen, ohne ständig einen Salto rw zu turnen.
In der Fachsprache des Trampolinturnens hat sich für diese Erscheinungen der Begriff Blackout durchgesetzt. Obwohl im englisch-amerikanischen Bereich auch der Begriff `Lost-Skill-Syndrome´ kursiert, bevorzuge ich in dieser Arbeit die Bezeichnung Blackout (BO) - nicht nur, weil er inoffiziell schon ein Fachbegriff ist, sondern auch weil mir für ein derart komplexes Thema dieser relativ offene Begriff angebrachter erscheint.
Da nicht nur ich, sondern noch viele anderer Leistungssportler mit diesem Phänomen mehr oder weniger in Konflikt geraten sind und noch werden - einige geben deswegen den Sport sogar auf - und, weil es in der Literatur bislang so gut wie gar nicht behandelt wurde, möchte ich mich nun damit auseinandersetzen. Ich denke, daß es dringend notwendig ist, etwas Licht in das Dunkel des Blackout-Phänomens zu bringen, und daß der Schleier der Neurose von den Betroffenen genommen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Bewegungstheoretischer Bezugsrahmen
- 1.1 Abgrenzung von der Kybernetik
- 1.2 Ganzheitlicher Ansatz
- 1.3 Bewegungsformen im Trampolinturnen
- 2. Das Phänomen des Blackout im Trampolinturnen
- 2.1 Definition und Schilderung
- 2.2 Versuch einer theoretischen Eingrenzung
- 3. Untersuchung
- 3.1 Fragestellung
- 3.2 Methode
- 3.3 Durchführung
- 3.4 Ergebnisdarstellung und -interpretation
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Blackouts im Trampolinturnen. Ziel ist es, das Blackout (BO) zu definieren, verschiedene Erscheinungsformen zu beschreiben und mögliche Ursachen zu ergründen. Die Studie basiert auf narrativen Interviews mit Betroffenen und bezieht einen ganzheitlichen bewegungstheoretischen Ansatz ein.
- Definition und Beschreibung des Blackout-Phänomens im Trampolinturnen
- Bewegungstheoretische Grundlagen und deren Relevanz für das Verständnis von BO
- Analyse von Handlungsfehlern im Zusammenhang mit BO
- Ergebnisse der Interviews und deren Interpretation
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Trainingspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Phänomen des Blackouts im Trampolinturnen anhand persönlicher Erfahrungen des Autors. Es wird die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Untersuchung hervorgehoben, da das Thema in der Literatur bisher kaum behandelt wurde und viele Leistungssportler davon betroffen sind. Die Arbeit verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der die subjektiven Erfahrungen der Betroffenen berücksichtigt und diese in einen theoretischen Bezugsrahmen einbettet.
1. Bewegungstheoretischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es grenzt den ganzheitlichen Bewegungsbegriff von kybernetischen Ansätzen ab und erläutert Konzepte wie Gestaltkreis, innere Bilder und Bewegungseinstellung. Diese Konzepte bilden die Basis für das Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Bewegung, Wahrnehmung und psychischen Prozessen im Trampolinturnen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Ganzheitlichkeit und dem Einfluss innerer Bilder auf die Bewegungsausführung. Der Abschnitt integriert schon erste Beobachtungen der Befragten in die Beschreibung trampolinspezifischer Bewegungsabläufe.
2. Das Phänomen des Blackout im Trampolinturnen: Dieses Kapitel definiert den Blackout und grenzt ihn von ähnlichen Phänomenen ab. Es werden verschiedene Erscheinungsformen des Blackouts beschrieben und ein Versuch einer theoretischen Eingrenzung anhand von motorischen Handlungsfehlern unternommen. Dieses Kapitel dient der genaueren Beschreibung des Phänomens, um im weiteren Verlauf der Arbeit eine fundierte Grundlage für die Analyse und Interpretation der Ergebnisse zu schaffen.
3. Untersuchung: Das Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung (narrative Interviews) und stellt die Ergebnisse dar. Die Analyse der Interviews konzentriert sich auf die Erscheinungsformen des Blackouts, die Entstehungssituationen, die Rolle der Ichhaftigkeit, die Angstkomponenten und den Einfluss der Trainingsbedingungen. Der Abschnitt integriert Detailanalysen der Erfahrungen von Sportlern und Trainern, um verschiedene Facetten des Phänomens aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Blackout, Trampolinturnen, Bewegungstheorie, Handlungsfehler, motorische Kontrolle, Ganzheitlicher Ansatz, narrative Interviews, Ichhaftigkeit, Angst, Trainingspraxis, Prophylaxe, Rehabilitation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Blackout im Trampolinturnen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Blackouts im Trampolinturnen. Ziel ist die Definition, Beschreibung verschiedener Erscheinungsformen und die Ergründung möglicher Ursachen von Blackouts. Die Studie basiert auf narrativen Interviews mit Betroffenen und nutzt einen ganzheitlichen bewegungstheoretischen Ansatz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Beschreibung des Blackout-Phänomens, bewegungstheoretische Grundlagen und deren Relevanz für das Verständnis von Blackouts, Analyse von Handlungsfehlern im Zusammenhang mit Blackouts, Ergebnisse der Interviews und deren Interpretation sowie die Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Trainingspraxis.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Untersuchung basiert auf narrativen Interviews mit Betroffenen des Blackouts im Trampolinturnen. Die Analyse der Interviews konzentriert sich auf Erscheinungsformen, Entstehungssituationen, die Rolle der Ichhaftigkeit, Angstkomponenten und den Einfluss der Trainingsbedingungen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen ganzheitlichen bewegungstheoretischen Ansatz. Es wird der ganzheitliche Bewegungsbegriff von kybernetischen Ansätzen abgegrenzt und Konzepte wie Gestaltkreis, innere Bilder und Bewegungseinstellung werden erläutert. Diese Konzepte bilden die Basis für das Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Bewegung, Wahrnehmung und psychischen Prozessen im Trampolinturnen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der narrativen Interviews werden im Kapitel "Untersuchung" dargestellt und interpretiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Erscheinungsformen des Blackouts, die Entstehungssituationen, die Rolle der Ichhaftigkeit, die Angstkomponenten und den Einfluss der Trainingsbedingungen. Detailanalysen der Erfahrungen von Sportlern und Trainern werden integriert, um verschiedene Facetten des Phänomens aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Fazit (Kapitel 4) zusammengefasst. Die Arbeit liefert Erkenntnisse zum Blackout-Phänomen im Trampolinturnen und leitet Handlungsempfehlungen für die Trainingspraxis ab, um das Auftreten von Blackouts zu reduzieren oder zu verhindern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Blackout, Trampolinturnen, Bewegungstheorie, Handlungsfehler, motorische Kontrolle, ganzheitlicher Ansatz, narrative Interviews, Ichhaftigkeit, Angst, Trainingspraxis, Prophylaxe, Rehabilitation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Bewegungstheoretischer Bezugsrahmen, Das Phänomen des Blackouts im Trampolinturnen und Untersuchung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit einer Einführung und der Darstellung des theoretischen Rahmens, gefolgt von der Beschreibung des Phänomens und schließlich der Darstellung der Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerungen.
- Quote paper
- Thomas Springub (Author), 1997, ´... der Sprung is´ ja kaputt...´ - Eine Untersuchung zum Blackout-Phänomen im Trampolinturnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1163